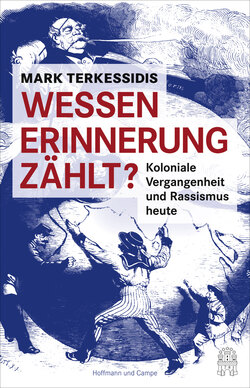Читать книгу Wessen Erinnerung zählt? - Mark Terkessidis - Страница 14
Vergangenheitsbewältigung im Museum
ОглавлениеDer Besitz von bestimmten Objekten ist also zweifellos problematisch. Noch problematischer wird es, wenn es sich um menschliche Überreste handelt, um Schädel oder Gebeine. Doch Viola König, damalige Leiterin der Ethnologischen Sammlungen, fand, dass selbst diese in Berlin besser aufgehoben seien: »Ich habe mich mal mit einer Gruppe australischer Aborigines unterhalten, wie sinnvoll es ist, Human Remains zurückzugeben, und ich habe gesagt: Ihr müsst uns wirklich konkret sagen, was ihr eigentlich mit den Human Remains dann macht. Wenn die nur im Nationalmuseum in Sidney in Kisten liegen bleiben, kann es das nicht sein.« Warum sollten die Überreste von Menschen nicht in Kisten liegen? 2014 nahm eine namibische Delegation, die sich im Auftrag des »National Council of Heritage« in Berlin aufhielt, 21 Schädel in Empfang, die sich zuvor im Besitz der Berliner Charité befanden. Diese Schädel wurden nach Namibia überführt und einen Nachmittag lang im Parlament in Windhoek aufgebahrt, damit den Toten Respekt erwiesen werden konnte. Danach beschlossen Vertreter von Herero und Nama, dass die Gebeine im namibischen Nationalmuseum eingelagert, aber nicht mehr gezeigt werden sollten. Diese Vorgehensweise erscheint von Pietät geprägt angesichts der Sensibilität von »Objekten«, die eigentlich Subjekte sind, wie Thomas Schnalke, Direktor des Medizinhistorischen Museums der Charité, auf einer Tagung 2018 bekräftigte.
Die Charité hat die Rückführung selbst in die Wege geleitet. Dort wird die Anzahl der menschlichen Schädel in deutschen Museen auf 7000 geschätzt. Nicht alle Leitungen der betroffenen Häuser halten es für selbstverständlich, dass diese Subjekte an die Nachfahren jener Gruppen zurückgegeben werden, aus deren Mitte sie einmal stammten. Die Museen tun sich offenbar schwer mit der Diskussion über die Legitimität der eigenen Sammlungen. Das trifft besonders für das Humboldt-Forum zu. 2017 schied die französische Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy im Streit aus der Expertenkommission des Forums aus – sie warf dem Projekt einen Mangel an Transparenz und eine sklerotische Struktur vor. 2018 legte sie zusammen mit dem senegalesischen Ökonomen Felwine Sarr im Auftrag des Elysées einen Bericht zur Restitution von afrikanischem Kulturerbe vor. Nun befinden sich 85 bis 90 Prozent dieses Kulturerbes außerhalb des Kontinents. In diesem Bericht wird die Anzahl der aus Afrika stammenden Objekte beziffert, die während der Kolonialzeit nach Frankreich kamen. Für das Musée du Quai Branly kommt das Duo auf die Zahl 70000 von insgesamt 90000 Objekten. Für das Humboldt-Forum spricht das Forscherteam von etwa 75000 von etwa einer halben Million Objekten.
Tatsächlich ist der gesamte Kontext der »ethnologischen Sammlungen« Berlins kolonial aufgeladen.
Viele Gegenstände entstammen der »Kunstkammer« des ehemaligen preußischen Schlosses, die auf das Betreiben des Großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg zurückgeht. Nun haben die Aktivisten von »No Humboldt 21« darauf hingewiesen, dass jener Friedrich Wilhelm 1682 die Brandenburgisch-Afrikanische Compagnie (BAC) ausstattete. Diese Compagnie gründete einen Stützpunkt an der Goldküste, dem heutigen Ghana, und beteiligte sich unter anderem von dort aus über mehrere Jahrzehnte am Sklavenhandel. Zudem waren die Kunstkammern, die auch als Kuriositätenkabinette oder Wunderkammern bezeichnet wurden, letztlich Insignien eines fürstlichen Machtanspruchs: Hier konnte sich der Herrscher an der vor ihm ausgebreiteten Fülle der Welt erfreuen. Andere Objekte wiederum stammen aus dem sogenannten Neuen Museum, das zwischen 1850 und 1855 im Rahmen des imperialen Projekts Museumsinsel eröffnet wurde. Das Neue Museum war höchst ideologisch. Die kulturelle Menschheitsgeschichte entwickelte sich gemäß dem Hegelschen Ästhetikmodell nach oben, wobei im Untergeschoss die ägyptische Sammlung gezeigt wurde. In der Höhe mündete das Gebäude in eine Eisenkonstruktion, welche die Fähigkeiten deutscher Ingenieure in puncto industrielle Bauweise dokumentierte.
Der Großteil stammt aber aus dem 1886 eröffneten Museum für »Völkerkunde«. Mitgründer und erster Direktor wurde Adolf Bastian. Bastian gilt auch als Vorreiter der Ethnologie in Deutschland, die damals noch ein vergleichsweise neues Fach war und sowohl ihre Herangehensweise als auch ihre Existenzberechtigung erklären musste. Bastian verfolgte das Modell einer Menschheit, bei der sich die »Elementargedanken« (sozusagen die kulturellen Atome) je nach Beschaffenheit der »geographischen Provinz« in »Völkergedanken« aufteilten. Diese Völkergedanken konnten sich verschieden entwickeln. Manche blieben statisch in der Nähe der Natur, manche bauten ihre Kultur so aus, dass sie die ganze Menschheitsgeschichte beeinflusste. Bastians frühe Arbeiten erinnern in den Beschreibungen an Humboldt, den er auch sehr bewunderte. Alles ist »Geschichtsbewegung«, in der die Menschheit wie in einem Naturschauspiel sich »mischt und gärt«, »durchzuckt« wird und »zündet«, »wallt« und »gewaltig genug empor« wächst. In Bastians Welt gibt es keine individuellen, handelnden Subjekte, und für die Menschen der Menschheit interessiert er sich viel weniger als für ihre »Völkergedanken« und natürlich deren materielle Ausprägungen in Objekten. Und so stellt der Ethnologe Fritz W. Kramer in einem kritischen Werk über sein Fach von 1977 ernüchtert fest, in Bastians achtzig (!) Büchern finde sich »nur wenig, was von ethnographischem Interesse ist«.
Es gibt von Bastian eine etwas ironische Beschreibung, in der er erklärt, wie sich die verschiedenen Wissenschaften über ihre Gegenstände streiten und welchen »Rechtsanspruch« dabei die Ethnologie habe. Sie befasse sich nicht mit der »sorgsam und stattlich geordneten Reihe der Geschichtsvölker«, sondern mit den »Territorien der Ausgewiesenen«, also mit »richtiger Culturlosigkeit«: »Nach Ausschluss aller streitigen Punkte werden der Ethnologie zuzuerkennen sein: Oceanien ganz, Amerika aus seiner Vergangenheit, Afrika zum grössern Theil, Asien in zerstreuten Parthien und Europa unter halb oder vorgeschichtlichen Zügen«. Da sich die Ethnologie auf die angeblich »geschichtslosen« Menschengruppen konzentrierte, also auf Gruppen ohne schriftliche Dokumente, erschien das Sammeln von Objekten als wesentliche Aufgabe.
Bastians »Rechtsanspruch« für die Ethnologie deckt sich also genau mit den Ansprüchen des europäischen Imperialismus. Wenige Jahre später dient Bastian die Ethnologie diesem imperialen Projekt regelrecht an. In seinem Buch über die Kolonien in Mikronesien betont er die Nützlichkeit des ethnologischen Wissens im »kosmopolitischen Weltverkehr« in zweierlei Hinsicht. Zum einen helfe dieses Wissen bei einer »(rationell) vernunftsgemäßen Verwaltung« in den Kolonien, einer, »die dem Mutterlande finanziell zu Gute kommt, statt dasselbe mit Unkosten (an Gut und Blut) zu belasten, wenn bedauerlicherweise gezwungen, die durch Mißverständnisse (und Mißgriffe) hervorgerufenen Störungen durch Gewaltmaßregeln wiederum in Ordnung bringen zu müssen«. Zum anderen hilft es aber auch, in der internationalen Konkurrenz die »Vorkämpfer der eigenen Nation« zu »Überlegenen (in Führung und Leitung)« zu machen und somit »den Siegespreis davonzutragen, kraft des (idealen) Stärkeren-Rechts (denn ›Wissen ist Macht‹)«.