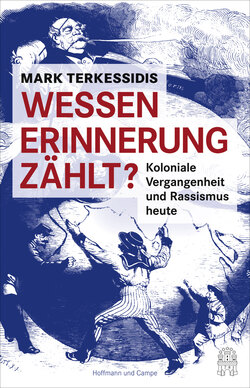Читать книгу Wessen Erinnerung zählt? - Mark Terkessidis - Страница 4
Vorwort
ОглавлениеIn kaum einem anderen Land spielen Fragen der Erinnerung eine so große Rolle wie in Deutschland. Das gigantische Ausmaß der nationalsozialistischen Verbrechen hat dafür gesorgt, dass es keinen Weg um das Erinnern herum gibt. Die Fragen, wie erinnert werden soll, wer sich dazu äußern darf und in welcher Form Erinnerung überhaupt sinnvoll ist, werden in Deutschland mit manchmal qualvoller Ausführlichkeit diskutiert. Die verständliche Konzentration auf die Shoah hat dazu geführt, dass Debatten über Erinnerung selten andere historische Ereignisse oder Perioden berühren. Häufig wird die deutsche Geschichte unter dem Gesichtspunkt betrachtet, inwiefern sie etwas mit der Vorbereitung und Durchführung des Holocaust zu tun hatte. Das war im Hinblick auf die Dimension des Völkermords nachvollziehbar und gerechtfertigt. International jedoch spielen und spielten auch andere Phänomene und Perspektiven eine Rolle. In manchen europäischen Staaten steht der Erste Weltkrieg mit seinen Folgen mehr im Vordergrund. In den USA ist in den letzten Jahren viel über den transatlantischen Sklavenhandel diskutiert worden. Dabei ging es auch darum, wie heute mit den Denkmälern etwa von Generälen der Südstaaten umzugehen ist, die für den Erhalt der Sklaverei kämpften. Stimmen aus ehemals kolonisierten Ländern sowie Initiativen und Forschende im Westen haben die Verbrechen und die Nachwirkungen des Kolonialismus wieder auf die Agenda gesetzt. Und im Hinblick auf die Nazizeit tauchen die Erinnerungen von »vergessenen Opfern« auf, jenen etwa, die in Polen oder Griechenland vom Nazi-Terror gegen die Zivilbevölkerung betroffen waren.
Mittlerweile wird auch in Deutschland der Raum der Erinnerung erweitert. So ist es auch in der Bundesrepublik vielen hartnäckigen Initiativen gelungen, das Thema Kolonialismus dem Vergessen zu entreißen. Bis vor kurzem erinnerte sich kaum jemand daran, dass das Deutsche Reich überseeische »Schutzgebiete« besaß, in Afrika (die heutigen Staaten Tansania, Ruanda, Burundi, Kamerun, Togo, Namibia sowie Teile einer ganzen Reihe anderer Staaten), im pazifischen Raum (etwa Samoa, Teile von Papua-Neuguinea oder Inselgruppen wie die Marianen) oder in China (Kiautschou). Diese Initiativen haben sich nicht nur für die Anerkennung des Völkermordes an den Herero und Nama im heutigen Namibia eingesetzt, sondern sie haben auch dafür gesorgt, dass über Straßennamen gesprochen wird, die ehemalige Kolonial-»Helden« ehren, oder über die Bestände von Museen, die aus der Kolonialzeit stammen. Auch über das »Humboldt-Forum«, das derzeit größte Museumsprojekt der Republik in der Mitte Berlins, wird unter (post-)kolonialen Aspekten heftig diskutiert. Im Koalitionsvertrag der CDU-SPD-Regierung von 2018 kommt das Thema Kolonialismus erstmals vor. Dort heißt es, zum »demokratischen Grundkonsens« gehöre neben der »Aufarbeitung der NS-Terrorherrschaft und der SED-Diktatur« auch die Beschäftigung mit »der deutschen Kolonialgeschichte«. Hingewiesen wird in dem Zusammenhang auch auf die größere Relevanz der Erinnerung an »weniger beachtete Opfergruppen des Nationalsozialismus«: »Wir stärken in der Hauptstadt das Gedenken an die Opfer des deutschen Vernichtungskrieges im Osten im Dialog mit den osteuropäischen Nachbarn.«
Aus dieser erneuerten erinnerungspolitischen Perspektive lassen sich das Ende des Ersten Weltkriegs und der darauf folgende Vertrag von Versailles noch einmal neu betrachten. Gewöhnlich wird dieser Vertrag im Hinblick auf die Entstehung des Nationalsozialismus gelesen: »Versailles« war das harte Diktat der Siegermächte, insbesondere Frankreichs, das am Ende die Kräfte des Revanchismus gegen die noch schwache deutsche Demokratie gestärkt hatte. Doch der Vertrag besiegelte auch das Ende des deutschen Kolonialismus, denn das Deutsche Reich musste seinen überseeischen Besitz dem Mandat des neu gegründeten Völkerbundes unterstellen. Zudem wurde Elsass-Lothringen Frankreich zugesprochen, das Gebiet Eupen-Malmedy ging an Belgien, Nordschleswig an Dänemark. Auf Druck der Vereinigten Staaten entstand das erste Mal seit über 120 Jahren wieder ein tatsächlich unabhängiger polnischer Staat, die sogenannte Zweite Republik. Dafür wiederum musste Deutschland fast ganz Westpreußen, die Provinz Posen und kleine Teile Niederschlesiens abgeben. Die meisten Gebietsverluste lösten in der Bevölkerung keine nachhaltigen Reaktionen aus. Die Ausnahme bildeten die Territorien im Osten – sie spielten vor allem in der konservativen und später nationalsozialistischen Propaganda eine enorme Rolle. Die Forderung nach Rückgabe der überseeischen Kolonien wurde in der Weimarer Republik zwar pro forma aufrechterhalten, aber auf wirtschaftlicher Ebene gab es nur wenig Aktivitäten. Richtung Osten hingegen, zumal in Südost-Europa, arbeiteten die politische Klasse und die Wirtschaft weiter Hand in Hand an einer imperialistischen Ausdehnung.
Wenn nun in der aktuellen Diskussion über Kolonialismus gesprochen wird, dann geht es gewöhnlich um die Besitzungen des Reiches in Afrika. Dieses Erinnern folgt, wie der kanadische Historiker Robert L. Nelson sagt, der sogenannten Salzwasser-Theorie: Hier gibt es das Mutterland, dort die Kolonie, und dazwischen befindet sich sehr viel Wasser. Daher scheint klar: Tansania oder Namibia sind als ehemalige Kolonien zu bezeichnen. Doch während die deutsche Herrschaft dort drei Jahrzehnte währte, waren Gebiete des heutigen Polen (Gebiete mit einer deutlichen polnischsprachigen Mehrheit) 150 Jahre entweder von Preußen oder später vom Deutschen Reich besetzt. In diesem Fall aber spricht niemand von Kolonialismus. Ebenso wenig werden die imperialen Bestrebungen in Südosteuropa und dem damaligen Osmanischen Reich in die Debatte um Erinnerung einbezogen, obwohl alles auf eine postkoloniale Beziehung hindeutet: Bemühungen um (ökonomische und kulturelle) Dominanz; die Aufbewahrung von erheblichen Teilen des kulturellen Erbes in Deutschland; brutale Besatzung in der Nazizeit und nach dem Zweiten Weltkrieg die Arbeitsmigration aus diesen Gebieten in die Bundesrepublik.
Tatsächlich ähnelte sich die imperiale Betrachtungsweise der überseeischen und der europäischen Gebiete. In der postkolonialen Diskussion wird oft darauf hingewiesen, dass einer der wichtigsten deutschen Philosophen, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, in seinen Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte (1822–1831) behauptete, der afrikanische Kontinent sei »kein geschichtlicher Weltteil«, er habe »keine Bewegung und Entwicklung aufzuweisen«. »Was wir eigentlich unter Afrika verstehen«, so Hegel weiter, »das ist das Geschichtslose und Unaufgeschlossene, das noch ganz im natürlichen Geiste befangen ist und das hier bloß an der Schwelle der Weltgeschichte vorgeführt werden mußte«. Allerdings klammerte Hegel in den gleichen Vorlesungen auch die »slawische Nation« im Osten von jeder Geschichtlichkeit aus: »Dennoch aber bleibt diese ganze Masse aus unserer Betrachtung ausgeschlossen, weil sie bisher nicht als ein selbständiges Moment in der Reihe der Gestaltungen der Vernunft in der Welt aufgetreten ist.« Der »Geist« herrscht nach Hegel nur im Westen.
Postkolonialismus war ein neues Konzept in den 1990er Jahren, um die westliche Hegemonie zu hinterfragen. Es ging darum, die verflochtenen Geschichten von Kolonisatoren und Kolonisierten zu beschreiben und über die Konsequenzen des imperialen Systems in der Globalisierung und der Migration zu sprechen. Die Geschichte, meinte der Literaturwissenschaftler Edward Said in seinem Buch Kultur und Imperialismus, ließ sich eben nicht nur vom Westen her erzählen. Ebenso wenig aber reichte es, die Geschichte als Befreiung vom Westen (in der Entkolonisierung) zu betrachten. Es ginge, so Said, um »sich überschneidende Territorien«. Ohne Deutschland lässt sich also keine Geschichte Ostafrikas, Polens oder des Balkans schreiben, aber ohne Ostafrika, Polen oder den Balkan auch keine Geschichte Deutschlands. Die deutsche Kolonialgeschichte ist anders verlaufen als jene Spaniens, Portugals, Frankreichs oder Englands. Sie ist widersprüchlicher, beinhaltet viele Phantasien und niemals ausgeführte Pläne und lässt sich nicht linear erzählen. Aber diese Geschichte beginnt bereits mit den »Entdeckungen« im 15. Jahrhundert.
Heute existiert zu vielen Staaten ein Verhältnis, das als postkolonial oder postimperial bezeichnet werden kann. Die Migration aus solchen Staaten hat dazu geführt, dass Erinnerungen aus anderen Kontexten mehr und mehr eine Rolle bei »uns« spielen. In Sachen Kolonialismus waren es häufig – mit Rückenwind aus den Vereinigten Staaten – schwarze Menschen in Deutschland oder »People of Color«, die die jüngsten Debatten angestoßen haben. Zugleich hat die »Flüchtlingskrise« gezeigt, wie sehr der »Export-Europameister« mittendrin in den Konflikten der Welt ist. Die meisten dieser Konflikte sind keineswegs einfach nach Deutschland »importiert« worden, wie oft behauptet wird, sondern »wir« waren an deren Entstehung häufig beteiligt.
Mit der Debatte über die koloniale Vergangenheit geht auch eine Debatte über Rassismus einher. Das haben nicht zuletzt die Reaktionen auf den Hashtag »#MeTwo« 2018 gezeigt. Der war initiiert worden, nachdem der Fußballspieler Mesut Özil dem Deutschen Fußballbund Rassismus vorgeworfen hatte. Unter diesem Hashtag berichteten dann viele Personen über ihre alltäglichen Ausgrenzungserlebnisse. Früher wurde das Wort »Rassismus« in Deutschland ungern verwendet, weil es zu sehr an die Zeit des Nationalsozialismus erinnerte. Doch Begriffe wie »Ausländerfeindlichkeit« oder »Fremdenfeindlichkeit«, die als Behelfskonstruktionen dienten, erscheinen heute kaum noch angemessen. Ich erinnere mich daran, wie ich 2013 von einer Presseagentur zum Thema Rassismus angerufen wurde. Es ging um einen Streit in der FDP, um Bemerkungen des FDP-Fraktionschefs im Bundestag und des Landesvorsitzenden der FDP Hessen über den Parteikollegen Philipp Rösler. Beide hatten die vietnamesische Herkunft Röslers in abwertender Weise ins Spiel gebracht. Nun war die Frage, ob das als Rassismus bezeichnet werden könne. Meine Antwort lautete Ja. Zu jenem Zeitpunkt war Philipp Rösler der deutsche Vizekanzler, und der deutsche Vizekanzler kann per se weder Ausländer noch Fremder sein. Wie also sollte das Phänomen anders bezeichnet werden? Rassismus hat heute nicht mehr zwangsläufig etwas mit Biologie oder »Rasse« zu tun. In diesem Buch wird dafür plädiert, über ein strukturelles Problem zu sprechen, das Rassismus heißt. Imperiale Ausdehnung und Kolonialherrschaft gehören zur Geschichte des Rassismus, und ebenso haben diese historischen Herrschaftsformen immer noch Auswirkungen darauf, wie Rassismus heute funktioniert.
Das Thema Postkolonialismus beschäftigt mich seit den 1990er Jahren. Die englischsprachige Theorie jener Jahre erschien uns in Deutschland sehr avanciert und gleichzeitig auch nützlich für eine deutsche Gesellschaft im Umbruch. Ich habe damals die wichtigen Werke dieser Theorie wie etwa Edward Saids Kultur und Imperialismus oder Homi Bhabhas Die Verortung der Kultur für Zeitungen wie Die Zeit oder die tageszeitung besprochen. 1998 erschien mein erstes Buch über Rassismus, damals in Deutschland noch ein extrem kontroverser Begriff, in dem die Kolonialgeschichte eine große Rolle spielte. Im gleichen Jahr habe ich mit der Amerikanistin Ruth Mayer den Sammelband Globalkolorit. Multikulturalismus und Populärkultur herausgegeben. Darin ging es um den »kolonialistischen Blick«, aber auch um die öffentliche Wahrnehmung der ehemaligen deutschen Kolonien in Übersee. Ich habe in diversen Texten versucht, postkoloniale Ideen für die Diskussion über die deutsche Einwanderungsgesellschaft in Deutschland nutzbar zu machen. In späteren Arbeiten ging es auch schon um die Frage, warum postkoloniale Theorie immer nur in Bezug auf Übersee eine Rolle spielen muss.
In den späten 1990er Jahren war ich Mitgründer und Aktivist bei einer Gruppe mit dem Namen »Kanak Attak«. Die nahm eine rassistische Beschimpfung auf und drehte sie selbstbewusst ins Positive. Die Aktiven zumal aus der »zweiten Generation« wollten die Frage der Repräsentation auf die Tagesordnung setzen, denn damals galten Eingewanderte und ihre Nachfahren noch als »Ausländer«: Sie durften weder ernsthaft mitbestimmen noch im öffentlichen Gespräch überhaupt mitreden. In Köln, wo ich zu der Zeit lebte, arbeitete ein Teil des Netzwerks an einem Filmprojekt namens Kanak TV. Damals war ein Geflüchteter aus der ehemaligen Kolonie Kamerun zur Gruppe gestoßen, und unser Anliegen wurde es, einen Zusammenhang herzustellen zwischen der Kolonialperiode und den aktuellen Formen der Migration. Unseren Filmen über Themen wie Weißes Ghetto oder das Märchen von der Integration folgte 2005 eine längere Doku mit dem Titel Recolonize Cologne, die sich mit der Geschichte und den Folgen des deutschen Kolonialismus beschäftigte.
Allerdings war das Thema zu der Zeit noch sehr marginal. Dritte-Welt-Gruppen befassten sich damit oder Leute aus entwicklungspolitischen Zusammenhängen – aus diesen Kreisen hatte es bereits in den 1980er Jahren Proteste gegen bestimmte Denkmäler oder Straßennamen gegeben. In der westdeutschen historischen Forschung war Kolonialismus ein Randphänomen (wenige Personen wie Horst Gründer oder Henning Melber arbeiteten kontinuierlich dazu). In der DDR hatte es eindrucksvolle Arbeiten zum Thema gegeben, doch die entsprechenden Lehrstühle und Institute waren nach der »Wende« ohne Rücksicht auf ihre Qualität abgewickelt worden. In der Öffentlichkeit spielte das Thema gar keine Rolle. In der Folge habe ich mich mehr auf Rassismus generell und die Konsequenzen der Migration in Deutschland konzentriert. An den Universitäten machten postkoloniale Ideen aber eine ziemliche Karriere – in einer ganzen Reihe von Disziplinen, von den Sozial- bis zu den Geschichtswissenschaften. Derweil hat die jüngere deutsche Historikergeneration um Jürgen Zimmerer, Birthe Kundrus, Ulrich von der Heydt, Joachim Zeller oder Sebastian Conrad die Forschungslage dramatisch verbessert. Und die Aktiven haben dafür gesorgt, dass das Thema wieder auf der öffentlichen Agenda angekommen ist.
Während der Arbeit an diesem Buch ist meine Mutter gestorben. Sie war 1924 im rheinländischen Eschweiler auf die Welt gekommen und hatte die Zeit des Nationalsozialismus als Kind und Jugendliche erlebt. Meine Mutter hatte immer ihre eigene Form der »Vergangenheitsbewältigung«. Während andere verschämt behaupteten, sie hätten nichts gewusst vom Holocaust, sprach meine Mutter offen darüber. Alle hätten es doch mitbekommen, meinte sie, wie die Juden zunächst immer mehr verschwanden und dann, im letzten Kriegsjahr, vor dem Abtransport interniert wurden. Sie erzählte auch, dass meine Oma – viele andere Familien machten es mit ihren Minderjährigen ähnlich – sie nach der Internierung losschickte, um den hungernden Menschen über den Zaun hinweg Brot zuzuwerfen. Ihre Großmutter und ihre Mutter hatten vor dem Krieg ein kleines Nähstudio besessen und vor allem für Textilgeschäfte mit jüdischen Inhabern gearbeitet. Trude war sicher keine Widerständlerin. Sie konnte plötzlich etwas »entartet« nennen, weil man das Wort halt in ihrer Kindheit verwendet hatte. Aber es blieb ihr das ganze Leben lang ein Rätsel, wie Leute auf die Idee hatten kommen können, systematisch die Nachbarn umzubringen. Sie entschuldigte sich bei den ansässigen Roma-Familien, die sie gut kannte und die nach dem Krieg wieder nach Eschweiler zurückgekehrt waren. Ihr Willen, über alles zu sprechen, ging ziemlich weit. Als ich mich als Jugendlicher brennend für die Nazi-Zeit interessierte und mehr über die SS wissen wollte, meinte sie, sie könne da nicht viel zu sagen, aber sie kenne da einen. Einige Tage später saß ein ehemaliger SS-Mann bei mir im Zimmer und fragte mich, was ich denn wissen wollte. Er war keiner von den »Schlimmeren«, wie sie meinte, aber es reichte, dass ich zur Salzsäule erstarrte.
In meiner Familie wurde oft gestritten. Innerfamiliär dominierte meine Mutter mit ihren Erinnerungen an den Krieg, aber mein Vater, der aus Griechenland eingewandert war und die Deutschen als Besatzer erlebt hatte, konterte passiv-aggressiv. Wenn meine Mutter davon sprach, wie schlimm es gewesen sei, dass meine Großmutter und sie in der Evakuierung hätten hungern müssen, knurrte mein Vater nur, sie hätten doch nur ein paar Wochen Hunger gehabt. Sie wüsste ja gar nicht, wie das wäre, wenn es jahrelang nicht genug zu essen gäbe. Oder wie es ausgesehen habe, als auf den Straßen von Athen die Leichen der Hungertoten gelegen hätten. Der familiäre Raum war stets ein Schlachtfeld der Erinnerung, von konkurrierenden Erinnerungen. Aber immerhin hat die Ehe meiner Eltern, eine große Liebe, über fünfzig Jahre bis zum Tod meiner Mutter gehalten. Vielleicht gibt mir das eine gewisse Zuversicht im Hinblick darauf, dass eine Gesellschaft mit Verantwortung für vergangenes Unrecht und mit unterschiedlichen und gar konkurrierenden Erinnerungen umgehen kann, ohne dabei auseinanderzufallen. Die Voraussetzung aber ist ein offener Umgang mit vergangenen und aktuellen Ungerechtigkeiten, ein Umgang, der nicht für schlechtes Gewissen sorgt, sondern für echten Wandel. Stolz können wir dann sein, wenn unsere Gesellschaft morgen demokratischer ist als heute.