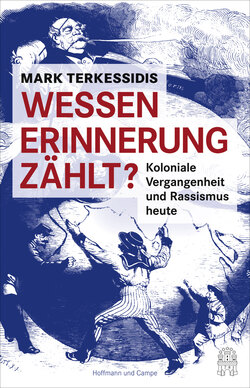Читать книгу Wessen Erinnerung zählt? - Mark Terkessidis - Страница 7
Die Bilanz der »Entdeckungen«
ОглавлениеIn Deutschland ist das Image des Kolumbus und seiner Expedition erstaunlich positiv geblieben. Im deutschsprachigen Wikipedia-Eintrag werden seine Unternehmungen weiter als »Entdeckungsreisen« bezeichnet, als habe niemand die betreffenden Inseln zuvor gekannt, geschweige denn bewohnt. In einem Unterkapitel ist von ihm als einem »umstrittenen Helden« die Rede (immer noch Held), aber die Kritik bleibt doch milde. Dabei fällt die Bilanz der »Entdeckungen« durchaus dramatisch aus, denn die Ankunft der Spanier erweist sich als regelrecht toxisch. Für diese Epoche ist jede Statistik sicher nur grobe Schätzung, doch es ist davon auszugehen, dass sich die Bevölkerung des amerikanischen Kontinents in den hundert Jahren nach Eintreffen der spanischen Entdecker von 50–80 Millionen auf etwa 8–10 Millionen reduzierte. Viele starben, als die Spanier mit der angekündigten Grausamkeit den teilweise erbitterten Widerstand niederschlugen. Manche überlebten die harten Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft oder beim Goldwaschen nicht; andere raffte die Verschleppung in die Sklaverei etwa auf die Antillen dahin. Doch der ganz überwiegende Teil fiel dem »Mikrobenschock« zum Opfer, den Krankheiten, die in diesen Breiten nicht vorgekommen und zugleich tödlich waren.
Die verbliebenen Menschen begegneten den Spaniern kaum noch mit Freundlichkeit, was ihnen zu allem Überfluss den Ruf eintrug, wankelmütig und heimtückisch zu sein. Je mehr die Spanier ihre Herrschaft in der Karibik und in Mittel- und Südamerika festigten, desto mehr Arbeitskräfte wurden etwa für die Bewirtschaftung der Plantagen benötigt. Bald galten afrikanische Sklaven als belastbarer und zuverlässiger. Die lokalen Kolonisten drängten die Krone angesichts der »Verknappung« der Arbeitskraft zum »Import« von Arbeitskräften durch Sklavenhandel. Spanien stieg aber erst im 16. Jahrhundert in den Sklavenhandel ein, zuvor waren es die Portugiesen, die das Geschäft beherrschten. Bereits seit Mitte des 15. Jahrhunderts unterhielt Portugal Niederlassungen etwa an der Küste des heutigen Mauretanien, um dort von lokalen Händlern Sklaven zu kaufen. Bei den Menschen handelte es sich um »Beutegut« aus Kriegen zwischen den innerafrikanischen Königreichen, sie wurden von arabischen Händlern über lange Distanzen an die Küste gebracht. Von dort aus ging es zunächst hauptsächlich auf die Iberische Halbinsel. Dieser Handel hatte lange Zeit den Segen des Papstes. Lissabon hatte beim Vatikan um die Zustimmung zur Gründung von Handelsposten an der afrikanischen Küste (sowie zur Annexion Madeiras und der Azoren) nachgesucht und diese auch erhalten. Zwei päpstliche Bullen übertrugen dem portugiesischen Infanten Henrique die Aufgabe, durch die Handelsaktivitäten den christlichen Glauben zu verbreiten, was das Leiden der geraubten Menschen in ein freundlicheres Licht tauchte.
In den überseeischen Territorien Spaniens entwickelte sich ein gewaltiger sozialer Abstand zwischen den weißen Herren und den »Indios« und schwarzen Sklaven, während gleichzeitig alle eng zusammenlebten. Eine Barriere wurde geschaffen, die in erster Linie sozialer Natur war, doch die Grenzlinien verliefen entlang äußerer, sofort ins Auge springender körperlicher Unterschiede, primär der Pigmentierung der Haut. Nun glaubt man heute allenthalben, die Hautfarbe, manche sprechen gar immer noch von »Rasse«, hätte eine Art natürliche Bedeutung, eine Bedeutung, die zugleich mit bestimmten Eigenschaften oder Verhaltensweisen gekoppelt sei. Doch für die Antike und das Mittelalter lässt sich sagen, dass Unterschiede in der Hautfarbe vielleicht aufgefallen sind, aber keineswegs als besonders relevant erachtet wurden – die wichtigeren Grenzen verliefen entlang der Sprache oder der Position im sozialen Gefüge. Auch die zuvor in Europa existierenden Formen der Sklaverei hatten nichts mit Hautfarbe zu tun. Der Begriff Sklave leitet sich aus dem altgriechischen Wort für Kriegsbeute ab, aber direkter noch aus der Latinisierung der Bezeichnung Slawe. Im Hochmittelalter setzte schließlich die Christianisierung dem Handel mit Menschen in Europa ein Ende – getaufte Personen durften nicht mehr zu Sklaven gemacht werden.
Für die karibischen, arawakischen oder anderen Bewohner Amerikas spielte die Hautfarbe der eintreffenden Spanier auch kaum eine Rolle. Die Spanier dagegen machten sich schamlos die Tatsache zunutze, dass die Indigenen keine Christen waren. Sie instrumentalisierten die Religion und etablierten eine Praxis der Unterdrückung. Durch den Ausschluss durch Einbeziehung wurden »weiß« und »schwarz« überhaupt erst zu relevanten Unterscheidungskriterien, denn soziale Unterschiede schlugen sich nun in (graduellen) Abstufungen der Hautfarbe nieder. In diesem Prozess, das hat der Kulturtheoretiker Tzvetan Todorov 1982 in seinem Buch über das Problem des Anderen bei der Eroberung Amerikas geschrieben, verkommt »die Verschiedenheit zu Ungleichheit, die Gleichheit zur Identität; dies sind die beiden großen Figuren, die den Raum der Beziehung zum anderen untrennbar eingrenzen«.