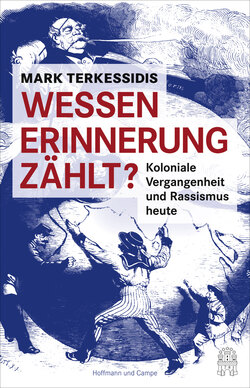Читать книгу Wessen Erinnerung zählt? - Mark Terkessidis - Страница 15
Die Sammlung des Kolonialmuseums
ОглавлениеDas »Völkerkunde«-Museum in Berlin war durch einen Bundesratsbeschluss von 21. Februar 1889 als zentrale Ankunftsstätte festgelegt worden für alle Objekte, die durch staatlich finanzierte Forschungsreisen aus den deutschen Kolonien kamen (später wurde das auf militärische »Expeditionen« erweitert). Im Beschluss hieß es, dass als Aufbewahrungsort für die Gegenstände »würdigerweise nur ein Kolonialmuseum« in Frage käme – dafür fehle aber das Geld. Der preußische Minister, so im Beschluss weiter, habe bereits zugesagt, dass Bastians Museum sich in dieser Richtung weiter ausbilden solle und so als »Ersatz für ein Kolonialmuseum des Reiches« fungieren könne. Nun war es unrealistisch, dass ein »Kolonialmuseum« seine Sammlung ohne Zwang zusammentrug. In den zeitgenössischen Darstellungen war davon auch nicht die Rede. Richard Kandt, Resident des Reiches in Ruanda, schrieb 1894 an den stellvertretenden Direktor Felix von Luschan: »Überhaupt ist es sehr schwer, einen Gegenstand zu erhalten, ohne zumindest etwas Gewalt anzuwenden. Ich glaube, dass die Hälfte Ihres Museums gestohlen ist.«
Das Ersatz-Kolonialmuseum war dann um 1900 kurz davor, ins komplette Chaos abzustürzen. Das Prestigemuseum war um diese Zeit bereits so vollgestopft mit Objekten, dass kein Besucher, geschweige denn Forscher (denn an diese adressierte sich das Museum in erster Linie) noch zurechtfinden konnte. Der Eingangshof stand voll mit Riesenobjekten ohne jeden Bezug zueinander, und im ganzen Museum waren die geographischen Zuordnungen weitgehend zusammengebrochen: Preußische Keramiken standen neben Funden aus Troja, persische Metallarbeiten neben Inka-Mumien. Das Sammeln hatte sich verselbständigt. Das hatte auch mit dem »Rettungsparadigma« zu tun. Bastian und andere Ethnologen glaubten, die »Naturvölker« seien durch den »Weltverkehr« zum Verschwinden verurteilt. Gegen das Verschwinden, auch das physische Verschwinden der Menschen selbst hatten die Ethnologen eigentlich keine Einwände, aber die kulturellen Hervorbringungen bedurften der »Rettung« in einem Berliner Museum. Und während alles zusammengerafft wurde, dessen man habhaft werden konnte, verloren die Protagonisten des Sammelns schlicht den Überblick. Bis heute hat diesen Überblick niemand zurückgewonnen. Die deutschen Museen haben so viele Objekte, dass sie manchmal nur ein Prozent ihres Bestandes ausstellen können. Die ethnologische Sammlung ist selbst der große Fetisch, der insgesamt von seiner »Provenienz« her alles andere als neutral ist.
Gewöhnlich werden Bastian und Felix von Luschan, bis 1910 auch Direktor der Afrika- und Ozeanien-Abteilungen des Museums, als der liberale Teil der deutschen »Völkerkunde« betrachtet. Ab 1900 begannen die »Rassen«-Theorien zu dominieren, die von den »liberalen« Forschern zurückgewiesen wurden. Zweifellos gingen sie im Gegensatz zu den Befürwortern der »Rassen«-Konzepte von einer Gemeinsamkeit alles Menschlichen aus, aber ihre Gedanken waren dennoch tief eingelassen in den zeitgenössischen Apparat des Rassismus und befanden sich am Übergang eines universellen zu einem superioren Modell rassistischen Wissens. Zudem verhielten sie sich als Forscher erstaunlich skrupellos. Als es während des Ersten Weltkriegs die Gelegenheit gab, anthropologische Messungen an Kriegsgefangenen vorzunehmen, zögerte Luschan als Professor keine Sekunde und sandte seine Mitarbeiter aus. Es bleibt unklar, ob er an diesen Forschungen aktiv beteiligt war, doch seine Untergebenen vermaßen ohne Skrupel die außereuropäischen Personen, die als Soldaten für Frankreich und England kämpften.
Nach dem Ersten Weltkrieg wurden die »Völkerkundler« immer extremer. Otto Kümmel, der ab 1923 das Museum für Ostasiatische Kunst (heutiger Martin-Gropius-Bau) leitete und ab 1934 den Preußischen Museen insgesamt vorstand, war glühender Anhänger des Nationalsozialismus. 1940 erstellte er im Auftrag des Reichskanzleichefs, des SS-Manns Hans-Heinrich Lammers, und des Propagandaministers Joseph Goebbels ein über dreihundert Seiten langes Gutachten über »Kunstwerke und geschichtlich bedeutsame Gegenstände, die seit 1500 ohne unseren Willen oder auf Grund zweifelhafter Rechtsgeschäfte in ausländischen Besitz gelangt sind«. Bei dieser Liste von angeblich entwendetem »arischem« Kulturgut handelte es sich de facto um eine Liste von zu plündernden Gegenständen.
Und selbstverständlich hatten die Auffassungen und Tätigkeiten solcher Personen einen Einfluss auf die Sammlung. 1935 gründete der Afrikanist Hermann Bauman als Kurator des »Museums für Völkerkunde« eine Abteilung »Eurasien« (im Übrigen trotz seiner ganz anders gelagerten Expertise). Diese Abteilung stand in Verbindung mit dem deutschen »Drang nach Osten«, also mit den Kolonialansprüchen des Deutschen Reiches etwa in Bezug auf Polen, das Baltikum und Teile der damaligen Sowjetunion – darum wird es im dritten Kapitel gehen. Baumann war bereits vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten Parteimitglied geworden und Mitglied im »Kampfbund für deutsche Kultur«, einer Organisation, die vom NS-Chefideologen und späteren »Reichsminister für die besetzten Ostgebiete« Alfred Rosenberg geführt wurde.
Diese eurasische Sammlung wurde in den 1990er Jahren ins »Museum Europäischer Kulturen« integriert. Dessen Sammlung basiert zudem auf dem ebenfalls 1935 gegründeten »Museum für deutsche Volkskunde«, das in die NS-Ideologie eingelassen war. Im Führer des »Ethnologischen Museums« von 2003 wird der Name Hermann Baumann völlig neutral erwähnt, und ebenso neutral wirkt auf der Homepage zur »Geschichte des Museums Europäischer Kulturen« der Gründungskontext der Sammlung. Wer mehr erfahren will, muss auf die recht kostspielige Publikation Zwischen Politik und Kunst: Die Staatlichen Museen zu Berlin in der Zeit des Nationalsozialismus von 2013 zurückgreifen. Baumann wechselte im Übrigen 1939 an die Universität Wien und beteiligte sich 1943 an der Arbeitsgruppe »Koloniale Völkerkunde« der »Kolonialwissenschaftlichen Abteilung« des Reichsforschungsrates. Wie so viele andere Ethnologen überlebte er die Entnazifizierung schadlos. 1951 lehrte er wieder, zunächst in Mainz und dann in München. Die ersten beiden Nachkriegsdirektoren des »Museums für Völkerkunde« stammten ebenfalls aus dem Umfeld einer ethnologischen Forschung, die dem Nationalsozialismus zugearbeitet hat.