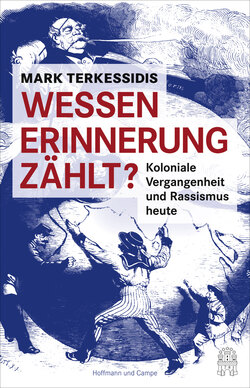Читать книгу Wessen Erinnerung zählt? - Mark Terkessidis - Страница 8
Humboldt »entdeckt« Amerika noch mal
ОглавлениеNach dem Rückzug der Welser nahmen die Deutschen allerdings fast 250 Jahre nicht mehr an der europäischen Expansion in Lateinamerika teil. Das hatte seinen Grund vor allem in der strikten Abschottungspolitik, die Madrid über die überseeischen Besitztümer verhängt hatte. Im 17. und 18. Jahrhundert hatte das spanische Weltreich mit Frankreich und England mächtige Konkurrenten bekommen, die ihre kolonialen Begehrlichkeiten nur zu gerne auf den südlichen Teil des amerikanischen Kontinents ausgeweitet hätten. So durfte niemand die Kolonien ohne eine Vollmacht des Königs betreten, die Verwaltungsgeschäfte waren in der Hand »blutsreiner« Beamter von der Halbinsel, und selbst die Kommunikation zwischen den einzelnen Teilen des Reiches wurde penibel überwacht. Doch im letzten Jahr des 18. Jahrhunderts gelang es dem Deutschen Alexander von Humboldt, durch stetiges Antichambrieren in Madrid die Erlaubnis zu einer wissenschaftlichen »Entdeckungsreise« zu erhalten. Er war der Spross einer wohlhabenden Familie aus Berlin und konnte seine Reise – vermutlich am spanischen Hofe ein schlagendes Argument – selbst finanzieren. Humboldt wollte unbedingt auf »Expeditionsreise« gehen. Seine Vorbereitungen waren penibel, was die Auswahl der Instrumente betraf, die er für seine geologischen, botanischen oder zoologischen Forschungen benötigte. Das Ziel dagegen war ihm relativ egal: Griechenland war zunächst im Gespräch, aber auch Lappland und die Westindischen Inseln. Bald interessierte er sich brennend für Ägypten. Zunächst wollte er den Earl of Bristol dorthin begleiten. Dann aber sprach er in Paris vor – mit dem Wunsch, sich jenen zweihundert Gelehrten anzuschließen, die zusammen mit der napoleonischen Armee in Ägypten einfielen.
Diese zweihundert Gelehrten waren im Übrigen eines der Beispiele, die Edward Said in seinem Buch Orientalismus erwähnt, um zu erklären, wie sehr die europäische Wissensbildung ein Teil des Eroberungsvorgangs war. Schon Kolumbus hatte sich auf seiner zweiten Reise von einem Missionar begleiten lassen, der die Indigenen studieren sollte. Stets brachten die Europäer ihre Forscher mit, um das Land und die gerade unterworfenen Völker genauestens unter die Lupe zu nehmen – die natürlichen Bedingungen, die kulturellen Errungenschaften, die Mentalität etc. Da diese Völker gerade besiegt worden waren und sich im Prozess der kolonialen Aneignung befanden, konnte nur festgestellt werden, dass sie zwar in der Vergangenheit beachtliche Leistungen erbracht hatten, nun aber unterlegen waren. Gerade in der Zeit der Aufklärung gab es zugleich das Bedürfnis, »Objekte« aus den Kolonien – seien es nun Kunstgegenstände oder auch Menschen – in die Metropole zu bringen, damit sie dort untersucht oder auch besichtigt werden konnten. Wiederum ist es bereits Kolumbus, der selbst berichtet, er habe sechs »Indianer« mit nach Spanien genommen.
Im Juni 1799 liefen Humboldt, sein französischer Partner Aimé Bonpland, deren Entourage sowie fünfzig der modernsten Messinstrumente schließlich in La Coruña aus – auf einer Fregatte, die ausgerechnet den Namen eines Konquistadoren trug: Pizarro. Über Teneriffa erreichte das Schiff schließlich Cumaná an der Küste von ausgerechnet Venezuela. Humboldt nutzt die koloniale Infrastruktur für seine Reisen, und all seine Beobachtungen finden in einem kolonialen Kontext statt.
In ihrem Buch Imperial Eyes (»Imperiale Blicke«) von 1992 nennt die Hispanistin Mary Louise Pratt die Schilderungen, die Humboldt über seine Aufenthalte verfasst, eine »Neuerfindung Amerikas«. Sein Buch Ansichten der Natur erschien 1808 und setzte den Tonfall für all die Schriften, die sich in den folgenden dreißig Jahren mit der Natur des südamerikanischen Kontinents befassten. Humboldt betrachtete in den venezolanischen Ebenen, den Llanos, in erster Linie ein »Naturgemälde«. »Das Interesse«, schrieb er, »welches dies Gemälde dem Beobachter gewähren kann, ist ein reines Naturinteresse. Keine Oase erinnert hier an frühe Bewohner, kein behauener Stein, kein verwilderter Frachtbaum an den Fleiß untergegangener Geschlechter. Schicksalen der Menschen fremd, allein an die Gegenwart fesselnd, liegt dieser Erdwinkel da, ein wilder Schauplatz des freien Thier- und Pflanzenlebens.« Auf diesem Schauplatz ließ Humboldt in durchaus ermüdender Weise ein endloses Naturdrama stattfinden, Kämpfe zwischen Erde und Himmel, Wasser und Trockenheit, Pferden und Krokodilen etc. Er inszenierte jenes harmonisch-ästhetische Naturganze, das er später dann zum »Kosmos« vereinheitlichte.
Wenn überhaupt Menschen auftauchten, dann nur als Vertreter von »Menschenarten«. Die außereuropäische Welt teilte sich in »Negerhorden, die auf mannigfaltigen Stufen der Civilisation gefunden werden«, in »mongolische Steppe, sibirische Barbarei« und in das südamerikanische »Gebiet europäischer Halbkultur«, wo Humboldt in den Städten bereits »Kunstsinn und wissenschaftliche Bildung« erwachen sah. Die Menschentypen konnten aber auch als Kuriosum auftreten, den Tieren nicht unähnlich. Jede noch beiläufige Begegnung fand ihren Weg in die Bücher. Gerade mal einen Tag verbrachte Humboldt bei Missionaren am Orinoco, konnte danach aber volle zehn Seiten seines Buches füllen mit dem, was ihm diese Weißen über eine ansässige Ethnie erzählten, die sie die »erdfressenden Otomaken« nannten. Insgesamt hat Humboldt über seine Reisen in Südamerika dreißig Bände zusammengetragen. In den letzten Jahren haben Neuausgaben seiner Werke, Bestseller wie Die Vermessung der Welt (Daniel Kehlmann), Sachbücher über Humboldt aus dem Bereich der Romanistik (Ottmar Ette) sowie erfolgreiche neue Biographien (Andrea Wulf) Alexander von Humboldt zum Vordenker von allem und jedem erklärt – einer »anderen Moderne«, der Globalisierung, des kulturvergleichenden Denkens, der interdisziplinären Forschung, einer neuen vernetzten Betrachtungsweise der Natur und der Ökologie. Allerdings ist Humboldts Einfluss auf die Naturwissenschaften – abgesehen von einigen seiner geologischen Beschreibungen – nüchtern betrachtet kaum der Rede wert.