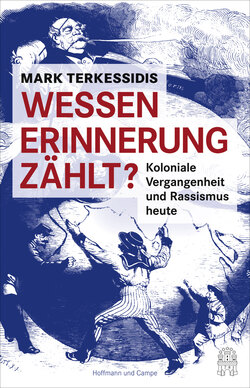Читать книгу Wessen Erinnerung zählt? - Mark Terkessidis - Страница 11
Deutsche Kolonisten, Händler und Kriegsschiffe in den Tropen
ОглавлениеUrsprünglich waren es aber die Regierungen der südamerikanischen Länder, die bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts um deutsche Kolonisten geworben hatten. Zwischen 1824 und 1830 entstanden vier solche »Kolonien« im Süden Brasiliens. Arbeitskräfte aus dem Ausland waren begehrt, weil der Sklavenhandel immer schwieriger wurde. Zudem versprach sich das brasilianische Kaiserreich von dieser Einwanderung im Sinne der damals herrschenden »Rassen«-Theorien eine »Aufweißung« der eigenen Bevölkerung. Im Großen und Ganzen verlief die deutsche Auswanderung aber völlig ungeregelt. Berichte über die bedauernswerte Armut der Deutschen in Brasilien veranlassten die preußische Regierung 1859 sogar zu einem Verbot weiterer Emigration. Erst 1897 hob dann die Reichsregierung den Bann wieder auf.
Auf Reiseblogs kursieren heute Bilder von deutschen Fachwerksiedlungen in Lateinamerika, von Blumenau in Brasilien, von Puerto Varas in Chile oder Colonia Tovar in Venezuela, die suggerieren, dort würde es ungebrochen »deutsch« zugehen. Doch die charmanten Dörfer sind heute wenig mehr als touristische Kulisse. Trotz zahlreicher Versuche der Einflussnahme aus Berlin begannen die deutschen Ausgewanderten schnell, sich als Bürger des jeweiligen Landes zu verstehen – und zwar sowohl jene, die Landwirtschaft betrieben, als auch jene, die sich als Kaufleute ansiedelten. Insbesondere die 220000 Deutschsprachigen, die (bis 1929) in Brasilien gezählt wurden, erwiesen sich, von kleineren, durchaus radikalen Gruppen einmal abgesehen, als für die Werbung des zweiten und später des Dritten Reiches wenig anfällig.
Insofern wollten die Ergebnisse der deutschen »Kulturmission« so gar nicht den Träumen der ultrakonservativen und expansionistischen Agitationsvereine entsprechen, allen voran des »Alldeutschen Verbandes«. In der Broschüren-Reihe Das Deutschtum im Ausland erschien 1900 ein Pamphlet über »Die Deutschen im tropischen Amerika« von Wilhelm Wintzer, Herausgeber der extrem nationalistischen, aber von den Wirtschaftseliten des Reiches gelesenen Rheinisch Westfälischen Zeitung. Wintzer schwadronierte über die »Weltaufgabe der germanischen Rasse«, die er in der Verpflichtung sah, »zielbewußte Ausdehnungspolitik zu treiben«. Zu diesem Zwecke müsse die Regierung alles tun, um »die Deutschen in der Ferne an die Heimat anzugliedern, ihr deutsches Gefühl zu stärken, um sie auch in weiteren Generationen dem deutschen Volkstum zu erhalten.« Eine solche Politik, die heute von Rechtspopulisten im Hinblick auf einige Gruppen von Eingewanderten unterstellt und scharf kritisiert wird, war im Deutschen Reich im Dienste der Expansion also einmal hoffähig. Und sie rief nicht überall so wenig Reaktion hervor wie in Südamerika, sondern fand während des Nationalsozialismus bei den »Volksdeutschen« im europäischen Osten durchaus ihren Widerhall.
Wintzer sprach auch davon, wie die Ausdehnungswünsche des Reiches in Lateinamerika notwendig einen Konflikt mit den USA heraufbeschwören würden. Zu diesem Konflikt kam es 1902 in Venezuela. Deutsche Unternehmer waren im Land enorm engagiert, international rangierten ihre Investitionen mit über 50 Millionen Mark an erster Stelle. Im ganzen karibischen Raum waren Unternehmer aus dem Deutschen Reich sogar mit astronomischen 1000 Millionen beteiligt. In Venezuela taten sich besonders die hamburgischen Kaufleute in Maracaibo im Kaffeehandel hervor. Zudem kamen Industrieprodukte »Made in Germany« ins Land, während Rohstoffe wie Schwefel nach Deutschland exportiert wurden. Ein Paradeprojekt der deutschen »Handels-Kolonisierung« war die große venezolanische Eisenbahn, von deutschen Banken finanziert, von deutschen Ingenieuren geplant und mit deutschen industriellen Erzeugnissen gebaut. 1894 wurde das erste Teilstück zwischen Caracas und Valencia feierlich eröffnet. Doch zu diesem Zeitpunkt war bereits klar, dass das Projekt viel mehr Geld verschlingen würde als geplant. Zudem weigerte sich die venezolanische Regierung, die für ihre Beteiligung zu ungünstigen Bedingungen einen Kredit aufgenommen hatte, unter dem Autokraten Cipriano Castro den Schuldendienst zu bedienen. 1901 zeigte sich die deutsche Flotte an der Küste Venezuelas. Gemeinsam mit den ebenfalls von der Zahlungsverweigerung betroffenen Engländern wurde der Einsatz bis hin zu einer Blockade ausgeweitet. 1903 kam es dann in Washington zu Verhandlungen.
Allerdings war die Reaktion des Deutschen Reiches weniger von klaren Interessen als vielmehr von so etwas wie beleidigter Selbstbehauptung geprägt. Reichskanzler von Bülow, der ja bereits 1897 als Staatssekretär des Äußeren Deutschlands »Platz an der Sonne« eingefordert hatte, sprach im März 1903 im Reichstag davon, Castro habe dem Reich keine andere Wahl gelassen, niemand dürfe mit dem Prestige und der Ehre Deutschlands spielen. Im Ergebnis jedoch gelang es den USA, den deutschen Einfluss massiv zurückzudrängen. Im ökonomischen Sinne erwies sich die Blockade als Desaster, der Handel mit Venezuela kam danach praktisch zum Erliegen. Die Ziele des Eingreifens blieben in Berlin umstritten und unklar. Ganz ähnlich war es bei einer anderen Konfrontation mit den Vereinigten Staaten 1898 vor Manila. Nach der Annexion von Kiautschou in China hatte der Kaiser auch die philippinische Hauptstadt als Stützpunkt ins Auge gefasst und ließ zwischenzeitlich das gesamte Ostasiengeschwader in der Bucht von Manila auflaufen. Dort lag es und wartete hauptsächlich untätig ab, bis die USA im spanisch-amerikanischen Krieg die Philippinen schließlich besetzten und letztlich kolonialisierten.