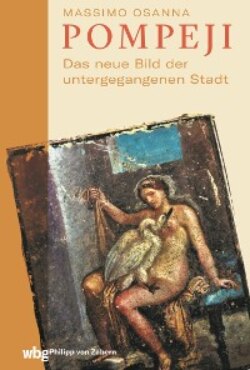Читать книгу Pompeji - Massimo Osanna - Страница 10
Die Opfergaben: Spuren ritueller Praktiken
ОглавлениеUm die Funde in ihrem Kontext50 zu betrachten, erscheint es sinnvoll, zwischen Objekten, die als Votivgaben in das Heiligtum kamen, und solchen, die als liturgische Instrumente, das heißt im Rahmen der Vorbereitung und Durchführung der rituellen Performance, benutzt wurden, zu unterscheiden. Ich bin mir bewusst, dass es keine klaren Grenzen zwischen den beiden Kategorien gibt, denn ein Gegenstand, der beim Ritual verwendet wurde, konnte im Anschluss der Gottheit geweiht werden. Das Artefakt erhält seine Bedeutung also danach, wie es in den unterschiedlichen Kontexten (vom allgemeinen Ort, dem Heiligtum, bis hin zu der spezifischen Stelle, an der es niedergelegt worden ist) verwendet wurde.
Zu den häufigsten Artefakten zählen die figürlichen Terrakotten. Sie zeugen von wiederholten Ritualen im Heiligtum, die von Einzelpersonen oder Gruppen vollzogen wurden. Ähnlich zahlreich belegt sind Thymiateria, also Räuchergefäße, und Miniaturkeramik. Gegenüber diesen Votivgaben aus Ton sind die „kostbareren“ Weihgeschenke nur in marginalem Umfang zu finden: Gegenstände aus Metall sind nur wenige bezeugt. Es zeichnet sich also eine Einheitlichkeit innerhalb der Heiligtümer ab, sowohl in den verwendeten Materialklassen als auch in der Ikonografie der Terrakotten. Das ist zweifellos auf die hellenistische koine zurückzuführen, in die sich die „samnitischen“ Heiligtümer bereits sehr früh eingereiht haben. Die Ikonografien der Koroplastik sind griechisch (denn die Matrizen, in denen die als Weihgeschenke verwendeten Statuetten serienmäßig hergestellt wurden, stammten aus der Magna Graecia; Abb. 17), ebenso wie die Formen der Vasen, die für Trankopfer oder beim Bankett verwendet wurden.
Eine wichtige Rolle für diese Gleichförmigkeit spielten, neben dem Effekt der hellenistischen ‚Globalisierung‘, mit Sicherheit die rituellen Praktiken, die in den verschiedenen Kontexten wohl ähnlich abliefen. Dies bedeutet natürlich nicht, dass überall ein und dieselbe Gottheit angebetet wurde oder die Kulte sich prinzipiell überlagerten, sondern vielmehr, dass die Heiligtümer eine ähnliche Funktion innerhalb der und für die Gemeinschaft hatten.
Abb. 17 Unter den gefundenen Weihgeschenken fanden sich viele Terrakottastatuetten. Sie wurden der Gottheit anlässlich kollektiv begangener Zeremonien dargebracht, an denen junge Frauen und Männer beteiligt waren. Die standardisierte Ikonografie ist griechisch, verweist auf die weibliche Sphäre und ist in griechischen und italischen Heiligtümern breit dokumentiert.
In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass solche Weihgaben – wie Enzo Lippolis für den griechischen Raum herausgearbeitet hat – weder als „ärmliche“ Opfergaben schwächerer sozialer Schichten noch als bescheidene Gaben zu verstehen sind, die die Kultstatue im Kleinformat wiedergaben. Ihre Verwendung innerhalb des Heiligtums, oder eher der Akt des Weihens – jener Aspekt des Kultgeschehens, der durch Bilder, Gerüche, Geräusche und kollektive Emotionen geprägt war und damit für uns heute schwer greifbar ist –, war nicht auf private und unzusammenhängende Aktionen beschränkt.51 Die Weihung von kostbaren, handwerklich oder künstlerisch bedeutenden Gegenständen könnte durch einzelne Angehörige oder Familiengruppen der Eliten erfolgt sein und war nicht unbedingt Teil der normierten und kodifizierten Ritualpraktiken. Die in großer Zahl dokumentierten Terrakotten dagegen müssen wohl als Zeugnis kollektiver Rituale verstanden werden, die gemeinschaftlich von einzelnen Gruppen eines bestimmten Geschlechts und/oder Alters durchgeführt wurden und deren Rolle und Status im Rahmen der Zeremonie betonten. Sie zeugen von kollektiven Ritualen, die das Objekt und dessen Niederlegung an spezifischen Orten der Kultstätte umfassten.
Ein signifikantes Beispiel findet sich unter dem Votivmaterial, das der späthellenistischen Phase des Apollotempels angehört (Abb. 18 und 19). Ausgrabungen, die in den 1980er-Jahren im Bereich vor und entlang des Bürgersteigs an der östlichen Seite des Heiligtums durchgeführt wurden, weil hier eine Stromleitung verlegt werden sollte, erbrachten wichtige Befunde. Unter dem Laufhorizont der westlichen Portikus des Forums wurden architektonische Strukturen entdeckt, die als Läden und Werkstätten (in denen unter anderem Parfüm hergestellt wurde) interpretiert werden konnten. Neben Verarbeitungsresten aus handwerklicher Produktion entdeckte man für liturgische Zwecke und als Weihgaben benutztes Material: Keramiken, Statuetten, Thymiateria. In diesen Ladenwerkstätten stellte man offensichtlich Objekte her, die für die rituellen Praktiken im Heiligtum benötigt wurden. Diese Annahme bestätigen auch die Funde von Gefäßen mit Farbe, wie sie für die farbliche Fassung der Votivstatuetten aus Terrakotta verwendet wurde.
Aus diesen Funden lässt sich die Spannbreite der Opfergaben des nahen Heiligtums erfassen: Thymiateria eines besonderen Typus, Salbgefäße – darunter einige sehr große Exemplare – und Schwarzfirniskeramik; außerdem Koroplastik in großer Zahl, darunter Tonscheiben, Stiere, Theatermasken, musizierende Zwerge, Puppen, elegant gekleidete Frauenfiguren (Tanagräerinnen), Kinderfiguren. Besonders bemerkenswert ist eine Gruppe von Eroten und Hermaphroditen. Die Aufhebung der körperlichen Geschlechtsmerkmale, explizit bei Letzteren, aber auch bei den Eroten, ist durch weiche Körperformen und sehr aufwendige Frisuren angedeutet. Das unterscheidet sie deutlich von der zeitgleichen Koroplastik und macht es wahrscheinlich, dass diese Figuren einem ganz spezifischen Ritus vorbehalten waren.
Abb. 18 Im Abraum unter der westlichen Portikus des Forums fand man unter anderem bemalte Theatermasken aus Terrakotta. Das Material stammt aus Ladenwerkstätten, die hier existierten, bis der Forumsplatz in hellenistischer Zeit baulich stark verändert wurde. Die Werkstätten waren auf die Herstellung und den Verkauf von liturgischen Instrumenten und Votivmaterial spezialisiert.
Abb. 19 Unter den in der Nähe des Heiligtums des Apollo gefundenen Votivgaben fanden sich diverse Terrakottastatuetten, die einen geflügelten Eros darstellen. Diese Weihgaben sind mit Zeremonien in Verbindung zu bringen, die im Heiligtum und am Forum durchgeführt wurden. Die Eroten stehen für die Jünglinge, die sich darauf vorbereiteten, in die bürgerliche Gemeinschaft aufgenommen zu werden, und dazu mit Chorgesängen und Tänzen an den Feierlichkeiten zu Ehren ihres Schutzgottes teilnahmen.
Bei diesem Befund haben wir wohl eine typische Kombination in Votivgruben, ohne eine innere Logik, ein chaotisches Flickenwerk ohne eindeutige Bezüge auf einen bestimmten Kult. Bildnisse des Gottes Apollo fehlen, aber es gibt zahlreiche Hinweise auf andere Gottheiten. Alles erscheint generisch, synkretistisch. Um diesen Fundkontext besser zu verstehen, müssen wir das Fundmaterial des Heiligtums in seiner Gesamtheit analysieren. Unter dem Skulpturenschmuck der letzten Phase des Heiligtums sticht eine Statuengruppe aus Marmor, bestehend aus Venus und einem Hermaphroditen, heraus (Abb. 20).52 Im 19. Jahrhundert nahm man deswegen an, das Heiligtum sei der Venus, deren Name in der offiziellen Nomenklatur der römischen Kolonie auftaucht, geweiht gewesen. Alternativ wurde vorgeschlagen, die Skulpturen seien nach dem Erdbeben von 62 n. Chr. aus dem Venustempel, den man in dem auf der anderen Straßenseite, nahe der Porta Marina gelegenen, monumentalen Heiligtum lokalisiert hatte, hierher verbracht worden. Die Auswertung der Koroplastik aus den Ladenwerkstätten unweit des Apollotempels kann den Grund für die Aufstellung dieser Skulpturen nun erklären: Die Präsenz der Hermaphroditen auch in diesem (älteren) Fundkontext rechtfertigt die Rolle der beiden Skulpturen als integrale Bestandteile der Definition des Heiligtums – sie spielten offensichtlich auf spezifische Aspekte des Kults an.
Tatsächlich erklärt sich der Befund des Votivmaterials aus dem Ritual, und er ermöglicht auch die Rekonstruktion der Abläufe im Heiligtum. Das Votivmaterial referiert auf ein Fest, das dem Gott Apollo galt, der hier zusammen mit Diana (Artemis)53 verehrt wurde. Die Gottheit wurde in einem feierlichen Akt verehrt, mehr noch als mit der Aufstellung eines Bildnisses. Das Fest hatte einen Namen: Ludi Apollinares. Aulus Clodius, eine herausragende Persönlichkeit des augusteischen Pompeji, hat sie zweimal auf dem Forum ausgerichtet, wie eine Inschrift in Erinnerung ruft:54
A. Clodius, A. f., Men Flaccus, IIvir i. d. ter, quinq., trib. mil. a populo. Primo duumviratu Apollinarib. in Foro pompam, tauros, taurocentas, succursores, pontarios paria III, pugiles catervarios et pictas, ludos omnibus acruamatis pantomimisque omnibus et Pylade et HS NCCIDD in publicum […].
Abb. 20 In der letzten Phase war eine marmorne Statuengruppe der Venus und eines Hermaphroditen im Heiligtum des Apollo aufgestellt. Auch das ältere Votivmaterial enthielt Hermaphroditen – sie verweisen, wie die Eroten und Theatermasken, auf die Ludi Apollinares. (Archiv PAP)
Aulus Clodius Flaccus, Sohn des Aulus, aus der Tribus Menenia, dreimal Duumvir, Quinquennal, vom Volk ernannter Militärtribun. In seinem ersten Duumvirat organisierte er während der Ludi Apollinares auf dem Forum einen Umzug, Stiere, Stierkämpfer, Hilfskräfte, drei Paare von Gladiatorenkämpfern, Gruppen von Boxern und Kämpfer, Spiele von Possenreißern jeder Art und Pantomimen jeder Art und mit Pylades, sowie eine öffentliche Verteilung von zehntausend Sesterzen […].
Auch wenn zwischen der Inschrift und dem Votivmaterial ein größerer Zeitraum liegt, passen die Terrakotten vom Ende des 2. Jahrhunderts v. Chr. dennoch gut zu den von Aulus Clodius organisierten ludi. Die Stiermasken mit infula (Stirnbinden) lassen an Tiere denken, die möglicherweise im Anschluss an Tierhetzen geopfert wurden, die Theatermasken lassen an mimische Darstellungen und Aufführungen auf dem Forum denken, die Hermaphroditen und Eroten an die Einführung der Jünglinge in die Gesellschaft im Rahmen des Festes – vielleicht mit der Teilnahme an chorischen Darbietungen –, und die Gefäße an die rituellen Mahlzeiten.
Der römische Geschichtsschreiber Livius berichtet über dieses Fest, das in Rom zur Zeit der Punischen Kriege eingeführt wurde. Er erwähnt von römischen Matronen organisierte Bankette. Außerdem ist bekannt, dass im Laufe der Zeit noch Theateraufführungen und Gladiatorenkämpfe hinzukamen.55 Auch für Cumae, deren Akropolis ein Tempel des Apollo beherrschte, sind die Ludi Apollinares bezeugt.56
Das Panorama der Opfergaben zeugt insgesamt von Einrichtungen, die für die hellenistische Welt entwickelt worden waren. Das erklärt sich aus der osmotischen Beziehung zwischen griechischen und italischen Gemeinden, insbesondere der Küstenstädte wie Pompeji, die seit Langem in ein weites Netzwerk aus Kontakten und Handelsbeziehungen eingebunden waren. Dieses Beziehungsgeflecht muss zwischen dem 4. und 3. Jahrhundert v. Chr. so stark gewesen sein, dass es auch auf bedeutende Aspekte der Kultur einwirkte und somit gemischte oder hybride Kulturformen entstanden. Es ist interessant, die Auswirkungen dieser „Osmose“ bis zum Anfang der römischen Zeit weiterzuverfolgen, etwa am Beispiel Cumae, das unter verschiedenen Gesichtspunkten seit archaischer Zeit mit dem pompejanischen Apollo verbunden war.
Die Protagonisten dieses Phänomens dürften jene sozialen Klassen von Bauern bzw. Grundstückseigentümern gewesen sein, die seit dem Anfang des 4. Jahrhunderts v. Chr. gesellschaftlich in den Vordergrund gerückt waren. Einerseits mögen sie Traditionen aus griechischem Kontext abgewandelt übernommen haben, andererseits könnten sie sich Verhaltensweisen angeeignet haben, die bereits für die herrschenden Eliten früherer Generationen typisch gewesen waren. Denn diese pflegten einen unmittelbaren, wenn auch selektiven Austausch mit der griechischen Kultur: Man war imstande, auszuwählen, was den eigenen Bedürfnissen nach Selbstdarstellung und bei der Inszenierung einer Zeremonie entsprach.