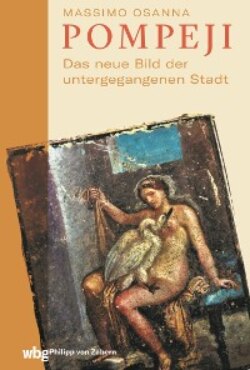Читать книгу Pompeji - Massimo Osanna - Страница 7
Kapitel 1 Pompejis langes Leben: die Heiligtümer und die Stadt
ОглавлениеPompeji wurde gegen Ende des 7. Jahrhunderts v. Chr. gegründet und war im 6. Jahrhundert v. Chr. bereits eine richtige Stadt, doch aus dieser Frühzeit sind weder Wohnbauten noch Grabanlagen bekannt. Mittlerweile können wir zwar einen Stadtplan dieser ersten Phase rekonstruieren (Abb. 1).1 Innerhalb des Straßennetzes, mit dessen Rekonstruktion man sich in den letzten Jahren systematisch beschäftigt hat, wissen wir aber wenig über konkrete Orte des täglichen Lebens. Von diesen haben sich nur wenige Mauerreste unterhalb der späteren Nutzungshorizonte, die von Archäologen als „samnitisch“ (4. bis 2. Jahrhundert v. Chr.) und „römisch“ (1. Jahrhundert v. Chr. bis 1. Jahrhundert n. Chr.) bezeichnet werden, erhalten. Unbekannt sind auch die Orte der Toten: Die ältesten Grabstätten waren zum Zeitpunkt des Vesuvausbruchs 79 n. Chr. bereits unter mehreren Metern Erdreich verborgen.2
Dagegen kennen wir Heiligtümer dieser Zeit, die den Göttern geweihten Orte. Üblicherweise suchte die Gemeinschaft an diesen Orten monumentale Strukturen zu schaffen, die sowohl der Götter als auch der Stadt selbst, als deren Schutzgötter sie fungieren sollten, würdig waren. Heiligtümer sind von vielen archaischen Städten die vergleichsweise besser bekannten Orte: religiöse Architekturen, vor deren monumentalen Kulissen Feste und Zeremonien den steten Fluss der Zeit und der Jahreszeiten strukturierten. Ungeschriebene Regeln, das Zeremoniell des Ritus, definierten ihren Ablauf. Festgelegte, aber stets erneuerbare rituelle Handlungen gaben der Gemeinschaft einen räumlichen und temporären Rahmen, in dem sich die Bürger der Stadt auch als Gruppe erkennen konnten. Tatsächlich waren Heiligtümer ein Instrument zur Integration verschiedener sozialer und ethnischer Komponenten der Stadtgemeinschaft. So wurden sie im Laufe der Jahre zu Orten der Erinnerung, an denen der Gemeinschaftssinn der Bürgerschaft bewahrt und gestärkt wurde. Für uns, die wir Jahrhunderte später die Geschicke der Stadtbewohner untersuchen, sind sie hervorragende historische Archive. Das Erdreich gleicht einem Karteikasten, in dem Dokumente und Zeugnisse der Vergangenheit, Fragmente von über Jahrhunderte hinweg verborgen gebliebenen Geschichten, Gebräuchen und Kulturen, bewahrt werden.3
Abb. 1 Das vermutete Straßennetz des archaischen Pompeji. Schwarz: die im archäologischen Befund gesicherten Straßenzüge sowie dokumentierte Überreste der ältesten Stadtmauer und die beiden Heiligtümer.
Wir wissen, dass die Stadt Pompeji in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts v. Chr. entstanden ist – zuvor war die Flussebene des Sarno durch verstreute Siedlungen charakterisiert. Beleg für diese Entstehungszeit sind eben Spuren der ersten Sakralbauten: Die Heiligtümer entstanden und entwickelten sich zusammen mit der Stadt. Sie verkörperten ihre Identität, ihr Wesen. Daneben belegt ein Befestigungsring (Abb. 2), der seit dem 6. Jahrhundert v. Chr. die 64 Hektar große Stadt umschloss, dass die Urbanisierung des Areals zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschlossen war. Der urbane Charakter ist für uns also an den Stadtmauern und den Heiligtümern ablesbar. Wo die zentralen Bereiche des öffentlichen Lebens in dieser Phase lagen, ist noch nicht geklärt, sie werden aber unter dem Forumsplatz der römischen Stadt vermutet.4
In der Vesuvstadt, wie auch an den meisten anderen Orten des antiken Italiens, an denen Antikes zu finden ist, sind es nahezu ausschließlich archäologische Ausgrabungen, die Informationen über Heiligtümer liefern.5 Wir haben keine literarischen Quellen, in denen sie erwähnt werden, und die wenigen Inschriften der Zeit – abgesehen von denen aus dem Heiligtum des „Fondo Iozzno“, auf die wir uns im nächsten Kapitel konzentrieren werden – beinhalten kaum Informationen über den Ritus, den Glauben oder die Zeremonien. Von einem stratigrafischen, archäologischen Kontext, von Schichtenfolgen und Gefäßen auf Handlungen zu schließen, ist jedoch keine leichte Aufgabe. Insbesondere dann nicht, wenn man versucht, ein Ritual zu entschlüsseln – es könnte von Fall zu Fall unterschiedlich gewesen sein und hat womöglich gar keine materiellen Spuren hinterlassen.6 Handlungsabläufe, die aus Gesten, Bewegungen, Tanzschritten, Anrufungen, Gebeten und Gesängen bestanden, sind schwer zu rekonstruieren, wenn diese kollektiven Erinnerungen nicht auch schriftlich fixiert wurden. Ohne eine Niederschrift in Stein oder anderen haltbaren Materialien, ohne „heilige Gesetze“ geraten solche Performances zwangsläufig irgendwann in Vergessenheit. Die im Ritus verwendeten Objekte bleiben meist stumm, es sei denn, man entwickelt spezifische hermeneutische Verfahren, um ihnen ihre Stimme und Sprache wiederzugeben.
Abb. 2 Fotografie aus den 1930er-Jahren: Ausgrabungen im Südosten der Stadt brachten in unmittelbarer Nähe der späteren Stadtmauern einen älteren Befestigungsring aus dem 6. Jahrhundert v. Chr. ans Licht. Er besteht aus größeren Blöcken aus sogenanntem Pappamonte und Lava tenera. (Archiv PAP.)
Genau darin besteht die Arbeit des Archäologen: jedes Fragment, jeden Hinweis, jedes Dokument zu sammeln und in ein kohärentes System einzuordnen, um dann – einfach ausgedrückt – eine Geschichte zu rekonstruieren. Es geht um die vielen Geschichten von Frauen und Männern, die lange vor uns an einem bestimmten Ort, an dem wir heute den Erdboden auf der Suche nach Antworten untersuchen, ihre Spuren hinterließen.7
In einem Heiligtum erlauben eine Grube mit Votivgegenständen, die Form eines steinernen Altars oder die Anordnung von Statuenbasen entlang eines Weges, einzelne Facetten der Gesellschaft, die diese Zeugnisse hervorgebracht hat, zu beleuchten. Sie erlauben aber auch Rückschlüsse auf die Lebenssituation derjenigen, die hierherkamen und an den religiösen Ritualen teilnahmen. Die Aufgabe des Archäologen besteht nun darin, anhand von Gegenständen, Architektur und allgemein anhand der Überreste von Ereignissen und Handlungen jene Momente des Alltagslebens zu entschlüsseln, die sich in der sakralen Atmosphäre eines Heiligtums abgespielt haben, an Orten, an denen die Präsenz der Götter spürbar und die Zeit nach anderen Parametern gemessen wurde als in der Welt der Menschen.
Auch in einer Stadt wie Pompeji muss man daher auf die Praxis der archäologischen Ausgrabung zurückgreifen und nicht nur die Schicht unter den Bimssteinlagen des Vesuvausbruchs, sondern auch die Schichten unterhalb der Nutzungshorizonte von 79 n. Chr. untersuchen. Das Erdreich birgt Hinweise auf die ältesten Phasen der Stadt. Berühmte Grabungsplätze wie der unsere zeigen neuen Forschungsvorhaben allerdings auch ihre Grenzen auf. Die Heiligtümer Pompejis waren – wie die großen Heiligtümer anderer berühmter antiker Städte, von der Akropolis in Athen über Olympia bis nach Rom – bereits in der Vergangenheit Gegenstand großangelegter und wiederholter Ausgrabungen. Und das zumeist in einer Zeit, als man auf die Auswertung der Kontexte oft weniger Wert legte als auf die Freilegung von Gebäuden mit monumentaler Wirkkraft und die Bergung von Artefakten, die ausgestellt werden oder in gelehrte Diskussionen einfließen konnten. Der Untergrund Pompejis ist schon häufig sondiert worden. Gerade in den bekannten Kultstätten wurden Grabungsschnitte angelegt, da man erwartete, hier schöne Objekte und kostbare Weihgeschenke zu finden. Man könnte also neuen Ausgrabungen und den faktischen Möglichkeiten, die Rituale auf diesem Wege zu rekonstruieren, durchaus mit einer gewissen Skepsis gegenüberstehen.8 Kurz: Viele der pompejanischen Heiligtümer sind infolge früherer archäologischer Untersuchungen, die schlecht dokumentiert und teils auch schlecht durchgeführt wurden, stark in Mitleidenschaft gezogen.
Doch trotz dieser objektiven Schwierigkeiten gab es in den letzten Jahren die eine oder andere Überraschung. Es ist nun möglich, das Kultgeschehen in neuem Licht zu betrachten. Und das bedeutet wiederum, dass es durchaus sinnvoll ist, Untersuchungen auch dort durchzuführen, wo in der Vergangenheit bereits umfassend geforscht und gegraben wurde. Voraussetzung dabei ist, dass man geeignete Methoden und alle Technologien einsetzt, die uns heute zur Verfügung stehen.9
Selbst in den Augen der ersten Ausgräber, die die Heiligtümer ohne größere Aufmerksamkeit für die archäologischen Kontexte auf der Suche nach Objekten freilegten, muss die Bedeutung und Besonderheit dessen, was sie da ans Licht holten, überdeutlich gewesen sein. Als man 1764 den Isistempel ausgrub, brachte dies das Europa der Aufklärung in direkten Kontakt mit der (alt)ägyptischen Religiosität. Und der imposante, 1767 ausgegrabene Tempel am Foro Triangolare musste die Ausgräber an die Steinarchitektur von Paestum erinnern und damit auf die älteste Phase der Stadt Pompeji verweisen. Dieser unerwartete Blick in eine fernere Vergangenheit führte dann auch zu ersten Spekulationen über die Ursprünge der Stadt. Die Ausgrabungen schritten weiter voran, und Anfang des 19. Jahrhunderts wurden weitere Kultstätten entdeckt, darunter der Tempel des Jupiter und das Heiligtum des Apollo am Forum. Letzterer wurde sehr bald als einer der ältesten Kultorte Pompejis erkannt. Die damaligen Entdeckungen lösten eine mehr oder weniger fundierte wissenschaftliche Debatte über die korrekte Zuweisung der freigelegten Heiligtümer an einzelne Gottheiten aus: Die Identifikation basierte üblicherweise auf der Analyse der literarischen und epigrafischen Zeugnisse sowie der Kultbilder und Dekorschemata.10
Wenn man die Blüte und den Niedergang der Heiligtümer des Apollo und der Minerva am Foro Triangolare (und des suburbanen Heiligtums des Fondo Iozzino) betrachtet, dann zeigt sich das gesamte, wechselhafte Schicksal der Vesuvstadt, von der beeindruckenden Entwicklung in der archaischen Zeit (6. Jahrhundert v. Chr.) über den ebenso beeindruckenden Niedergang im 5. Jahrhundert v. Chr. und die langsame, aber stetige Erholung der Stadt im Laufe des 4. Jahrhunderts v. Chr. bis zum strahlenden Höhepunkt im 2. Jahrhundert v. Chr., und weiter von den Zäsuren und Kontinuitäten im Zusammenhang mit der Gründung der römischen Kolonie im 1. Jahrhundert v. Chr. über die Schäden des Erdbebens von 62 n. Chr. bis zum „tragischen Epilog“ im Jahr 79 n. Chr. Einige Heiligtümer überdauerten die Jahrhunderte, andere kamen im Laufe der Stadtgeschichte hinzu, wieder andere wurden aufgegeben oder erfuhren in anderer Hinsicht eine neue Beliebtheit ohne topografische Veränderungen, wenn das Territorium von neuen und anderen Bevölkerungsgruppen besiedelt wurde. Alle veränderten sich sowohl in ihrer architektonischen Form als auch in der dekorativen Ausstattung. Die materielle Ausprägung des Kultes wurde den neuen Bedürfnissen der Kultgemeinschaft in der sich wandelnden Stadt und auch an Moden, die kamen und gingen, angepasst. Die Heiligtümer von Apollo und Minerva jedenfalls blieben über die gesamte Siedlungsgeschichte der Stadt vom 6. Jahrhundert v. Chr. bis zum Vesuvausbruch 79 n. Chr. bestehen.
Wie geht man nun aber vor, wenn man das Erdreich innerhalb eines heiligen Bezirks „befragen“ will? Welche Art von Informationen können wir erwarten? In der Analyse der unterschiedlichen Ausprägungen der Kulte verschiedener Völker der Vergangenheit – und auch unserer heutigen Welt – kam der „Materialität“ von Religion in den letzten Jahren erneut Aufmerksamkeit zu.11 Die Forschung lenkte den Diskurs vor allem auf die Objekte, durch die sich Religionen als symbolische Universen behaupten, die die Wechselbeziehung zwischen Gemeinschaft und Territorium bedingen und weiterentwickeln können.12 Das Thema der Erinnerung und ihrer physischen Verortung (ihr „materieller Rahmen“ – gemeint sind Orte, an denen sich Erinnerung durch ein Denkmal, ein Objekt, einen Felsen oder dergleichen vergegenständlicht) ist zu einem wichtigen Forschungsthema geworden: Die Erinnerung, das kollektive Gedächtnis, ist in der Tat oft von „religiöser Bedeutung“ durchdrungen, die sich vor allem im Ritual konkretisiert (und bewahrt). Der Ritus macht in der Regelmäßigkeit seiner Wiederholung die „Gründungs“-Vergangenheit aktuell, auf die stets verwiesen wird, um Identität und Zugehörigkeitsgefühl der Gemeinschaft zu stärken.
Indem wir die Gegenstände „befragen“ und die Aufmerksamkeit auf die materiellen Hinterlassenschaften richten, können wir also verschiedene Aspekte antiker Gesellschaften aufdecken und etwas darüber erfahren, wie diese Menschen lebten und sich die Welt vorstellten.13 Am Golf von Neapel etwa wirkten sich das prekäre Gleichgewicht in archaischer Zeit, die Phase der Rückentwicklung im 5. Jahrhundert v. Chr., die Anfänge der römischen Eroberung der kampanischen Städte im 4. Jahrhundert v. Chr., die charakteristische Öffnung der italischen Gesellschaft auf das Mittelmeer im Rahmen einer neuen koine und der Prozess der Romanisierung zwischen dem 3. und 1. Jahrhundert v. Chr. auf die Ausformung des Sakralen sowie auf seine Umsetzung und Erscheinung im steten Dialog zwischen Tradition und Erneuerung aus.
Zuallererst ist es wichtig, zu fragen, welchen Göttern die Heiligtümer geweiht waren. Welche waren die Götter der Pompejaner? Und vor allem: Welche Menschen hatten sie in die Stadt gebracht? Die aus Inschriften bekannten Götter (Apa im Heiligtum des Fondo Iozzino, Athena [Minerva] im Tempel am Foro Triangolare, Apollo im Heiligtum am Forum usw.) waren pompejanisch, obwohl sie griechische oder etruskische Namen hatten oder aus der griechischen, etruskischen, italischen oder orientalischen Welt (wie etwa die Göttin Isis, deren Kult im 2. Jahrhundert v. Chr. eingeführt wurde) stammten. Auch heute noch wird die Herkunft dieser Götter in einem Kampanien, das von verschiedenen Völkern und ethnischen Gruppen bevölkert war, diskutiert.14 Doch egal, woher sie kamen: Diese Götter wurden pompejanisch, nachdem sie mit Entstehung der Stadt eingeführt und den Bedürfnissen der neuen Gemeinschaft angepasst worden waren. In den Anfängen wird es sich wohl kaum um ein systematisch geordnetes Pantheon gehandelt haben, das etwa von den ersten Stadtbewohnern en bloc eingeführt worden wäre. Götter kamen mit etruskischen oder griechischen Namen in die Stadt, je nachdem, wer sie eingeführt hatte, und dank der Areale, die für sie innerhalb der Stadtmauern reserviert worden waren – was sich gewissermaßen strukturgebend auswirkte –, hatten sie sich schnell etabliert.15
So gemischt die Bevölkerung der neuen Stadt war, so heterogen waren ihre Gottheiten, aber auch die Werkstätten und Arbeiter, die an der Monumentalisierung der Heiligtümer beteiligt waren. In Pompeji waren zahlreiche Handwerker mit unterschiedlichem Wissen und verschiedenen Fähigkeiten aktiv, geleitet von den Erfahrungen des Architekten und den Wünschen und Vorstellungen des Auftraggebers. Gemeinsam gestalteten sie die Orte, an denen die neuen Gottheiten, die von „Kolonisatoren“ oder aus dem weiteren Umland in die neue Siedlung eingeführt wurden, ihren Sitz haben würden. Es entstanden die ersten Tempel, die Häuser der Götter: Die Stadt Pompeji weist bereits im 6. Jahrhundert v. Chr. eine monumentale Architektur auf und ist insofern mit den sehr fortschrittlichen griechischen Städten in der Umgebung, von Cumae bis Paestum, und den großen Zentren Mittelitaliens, von Tarquinia bis Rom, vergleichbar.
Bei diesen Gebäuden beeindruckte neben ihrer generellen monumentalen Erscheinung vor allem das Dach. Man betrieb einen großen Aufwand bei der Errichtung von Gebäuden mit mächtigen, reliefartig verzierten und bemalten Dächern aus Terrakotta (Abb. 3). Eine Architektur, die fachkundige Werkstätten und Architekten erforderte. Was die handwerklichen Traditionen anbelangt, so muss Pompeji in seinem mediterranen Kontext gesehen werden, das heißt als ein Ort, in dem Wissen nicht linear vermittelt wurde, in dem mobile und in ihren Fähigkeiten vielfältige Handwerker aktiv waren: Großbaustellen waren Orte, an denen neue Formen erprobt und Stilrichtungen sowie Dekorationsschemata gemischt wurden.
In einer Welt, in der sich Erfahrungen und Kulturen überlagerten, erscheint es problematisch, Denkmälern und Werkstücken ein ethnisches Etikett zuzuweisen: griechisch, etruskisch, lokal. Die Herkunft einzelner Gruppen von Handwerkern bedeutet, kurz gesagt, nicht, dass ein Produkt ethnisch als griechisch, etruskisch oder einheimisch bestimmt werden kann.16 Die Stadt und die Gruppen, aus denen sich ihre Führungsriege zusammensetzte, schöpften aus einem Universum von Wissen und formten daraus eine eigene Sprache, die mehr oder weniger an bereits vorhandene Traditionen anknüpfte. Es war weniger wichtig, sich auf eine bestimmte Handwerkstradition zu beziehen, als vielmehr zu beeindrucken: Beispielsweise gab man die Errichtung eines Daches in Auftrag, das diejenigen, die von auswärts in die Stadt kamen, in Staunen versetzen und den Eindruck einer mächtigen und blühenden Gemeinschaft vermitteln sollte.
Die Frage nach den Ursprüngen Pompejis ist komplex. Eine tragende Rolle wird seit Langem den Etruskern zugeschrieben:17 Pompeji war wahrscheinlich kein oskisches Zentrum, das von einheimischen Gemeinden (wie Nola oder Nuceria) unter Mitwirkung und Anregung von etruskischen Familien gelenkt wurde, sondern es war wohl tatsächlich eine etruskische Gründung. Damit kam der Stadt gleichzeitig eine entscheidende Position auf dem Schachbrett zu, das der Golf des Kraters (wie der Golf von Neapel in der Antike genannt wurde) vor der Gründung von Neapolis war. Hier definierten sich die Stadtgemeinschaften im Rahmen von Vereinbarungen, Verträgen und Handelsrouten als integrative Einheiten. Dieses empfindliche Gleichgewicht sollte später18 durch die Ereignisse, die zur zweiten Schlacht von Cumae führten, gestört werden. Letztlich war diese Schlacht vielleicht vielmehr die Folge und nicht die Voraussetzung der Gründung von Neapolis.19 Die Geburt einer Stadt von so großer Bedeutung war Teil eines Prozesses, in dem individuelle politische Identitäten eine neue Rolle übernahmen und das alte Gleichgewicht, auch kultureller Art, nach und nach ins Wanken kam.
Heiligtümer haben in diesem Bild immer eine führende Rolle gespielt, handelte es sich doch um Orte, die zur Integration und Konfrontation bestimmt waren – Orte, an denen die Interaktion mit den Göttern in erster Linie eine Interaktion zwischen Menschen war, die miteinander wetteiferten und Vereinbarungen trafen.
Abb. 3 Versuch einer dreidimensionalen Rekonstruktion des Dachs des Minervatempels im 6. Jahrhundert v. Chr. Die archaischen Tempel hatten monumentale Dachstrukturen, die mit flachen und halbrunden Ziegeln aus Terrakotta gedeckt waren; die Dachränder schlossen mit reich verzierten, polychrom gefassten Simen und Wasserspeiern ab. (Umzeichnung: F. Giannella.)