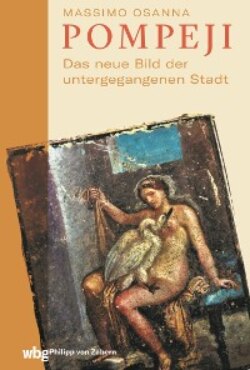Читать книгу Pompeji - Massimo Osanna - Страница 11
Ikonografie und Kult
ОглавлениеEin Aspekt, der eng mit dem Problem der Verwendung der Bilder verbunden ist, ist die Frage, ob es möglich ist, anhand eines Artefaktes aus Terrakotta zu bestimmen, welcher Gottheit es geweiht war. Ist es möglich, Ikonografien eine bestimmte Bedeutung zuzuschreiben? Ungeachtet der Komplexität der Phänomene verleitete die Einfachheit eines Objekts aus Terrakotta gern dazu, nach Konstanten zu suchen und bestimmte Typen oder bestimmte Attribute zur Identifizierung der verehrten Gottheit heranzuziehen. Das führte aber letztlich zu einer starren Gleichsetzung von ikonografischem Typus und Gottheit. Aus der Einförmigkeit wiederkehrender Typen wurde einzelnen Bildern ein bedeutender hermeneutischer Wert zugeschrieben, ohne dass man beachtete, dass es gerade der Akt der kultischen Handlung war, der den Statuetten, die bestimmte Funktionen erfüllten, eine Bedeutung verlieh.57
Lange konzentrierte man sich überwiegend auf Form und Stil, untersuchte und interpretierte die Terrakotten im Rahmen typologischer Studien – und vernachlässigte die Fundkontexte. Die mangelnde Kenntnis der Kontexte schmälerte jedoch die Möglichkeit, Funktionen und Bedeutungen zu bestimmen. Die archäologischen Daten wurden also unkorrekt benutzt, wie vor allem auf den griechischen Raum bezogene Studien belegen konnten.58 Aus einer systematischen Auswertung der Kontexte ergibt sich für die Terrakotten eine auffallende Austauschbarkeit: Im Zusammenhang mit unterschiedlichen Gottheiten begegnet uns gewöhnlich ein und dieselbe typologische Vielfalt. Zum einen mag dies in einem bestimmten Aspekt des Göttlichen begründet sein: Der Wirkungsbereich einer Gottheit war so breit angelegt, dass sich der des einen Gottes mit dem eines anderen überschneiden konnte. Zum anderen könnte dies an einer relativen Einheitlichkeit von sozialer Herkunft, Geschlecht oder Altersgruppe derer liegen, die am Ritual beteiligt waren.
Man sollte die Motive der Koroplastiken daher innerhalb ihrer individuellen Kontexte betrachten, ohne ihnen eine absolute ikonografische Bedeutung zuzuschreiben. Die Verteilung der Typen in den Heiligtümern zeigt gut, wie die Verwendung von Matrizen – bei denen es sich um bewegliche Objekte handelte – zur Entstehung einer Bildsprache führte, die meist sehr „generisch“ und für verschiedene Kulte geeignet war. So konnte es dazu kommen, dass die gleichen Typen an unterschiedlichen Kultstätten begegneten, denn standardisierte Ikonografien wurden wiederholt (sitzende weibliche Figur mit Schleier, stehende Figur mit Opfergabe oder Opferinstrument, sitzende Figur mit Kind, etc.) und spezifische Attribute fehlen – oder die gezeigten Attribute sind gewissermaßen multifunktional.
Ein bestimmter Typus hilft, die am Foro Triangolare gefundenen Votivgaben zu verstehen: die Büste einer Frau mit polos (zylindrische Kopfbedeckung; Abb. 21). Dieser Typus war im griechischen und italischen Raum weitverbreitet. Früher glaubte man, darin Demeter/Ceres oder Persephone/Proserpina beim anodos zu erkennen, also beim Aufstieg aus der Unterwelt in die sichtbare Welt,59 und man schloss aus dem Fund dergestaltiger Weihgaben in Großgriechenland und Sizilien gern darauf, dass der Fundort der Demeter heilig war. Doch diese Orte hatten mit der eleusinischen Gottheit aller Wahrscheinlichkeit nach gar nichts zu tun. Dazu ein Beispiel unter vielen: Der Fundkomplex von Sant’Aniello in Neapel weist ausgesprochen viele weibliche Büsten auf – das führte dazu, dass man das Heiligtum auf der Akropolis von Neapolis der Demeter zuordnete.60 Die Büste ist allerdings, wie kürzlich für Beispiele aus Sizilien dargelegt wurde,61 vielmehr als Verweis auf den Abschluss der parthenia zu lesen, des Status der Frau als nymphe: Dies entspricht dem Lebensabschnitt zwischen der Geschlechtsreife und der Heirat sowie der Geburt des ersten Kindes. Nymphen waren also weibliche Gottheiten, die mit dem Übergang des Mädchens in die Gemeinschaft der Erwachsenen und Bürger verbunden waren; sie unterstützten die Frau in dem Moment, wenn sie durch ihre biologische Entwicklung zur nymphe wurde,62 und beschützten die Mädchen in dieser Phase der sozialen und biologischen Veränderung – was wiederum die Nymphen mit den Chariten/Gratien verbindet. Die Chariten waren als „Untergöttinen“ mit der Welt der Aphrodite/Venus verbunden, und ihnen wurden weibliche Büsten geweiht. Es waren Gottheiten, die für die Frau in ihrem Dasein als „Braut“ standen. Gleichzeitig personifizierten die drei Chariten Anmut, Reiz und Schönheit, aber auch Vergnügen.
Abb. 21 Hellenistische Votivgaben aus Terrakotta. Büsten von Frauen mit polos. Die Ikonografie rekurriert auf die Opfernden im Moment ihrer Verwandlung zur nymphe, das heißt auf den Moment, in dem sie den Übergang vom Mädchenalter ins Erwachsenenalter vollziehen und damit zu künftigen Ehefrauen und Teil des Sozialgefüges der Stadtgemeinschaft werden. (Archiv PAP)
Wenn also die Nymphen die Gottheiten par excellence waren, die die Frau in einem bestimmten Lebensabschnitt beschützten, der länger andauert als der Begriff „Braut“ – die wörtliche Übersetzung von nymphe – suggeriert, dann lassen sie sich mit verschiedenen Gottheiten in Verbindung bringen, die sie bei dieser symbolischen Aufgabe auch ersetzen konnten: in erster Linie Aphrodite/Venus und Kore/Persephone/Proserpina. Auch in diesem Fall stand das Terrakottabildnis nicht für die Gottheit, sondern für den Status der Weihenden. Daher konnte das Weihgeschenk auch unterschiedlichen Gottheiten dargebracht werden, je nachdem, welche im jeweiligen Umfeld für den Schutz der „Braut“ zuständig war(en): allein die Nymphen, Aphrodite/Venus zusammen mit den Nymphen, Kore/Persephone/Proserpina und sogar die Jungfrau Athena/Minerva, die in mehr als einem Fall von weiblichen Gottheiten begleitet sein konnte, um das Ende der parthenia (Jungfräulichkeit und damit Kindheit) der sich verheiratenden jungen Frauen zu begleiten. Wahrscheinlich ist genau dies in unserem Heiligtum der Fall, wo die Anwesenheit der Göttin, wie wir gesehen haben, auf mehreren Ebenen dokumentiert ist: von epigrafischen Daten über die archaischen Ikonografien bis hin zum bekannten Typus der Minerva mit phrygischer Mütze. Gerade das Vorhandensein von Büsten im Heiligtum zusammen mit einem reichen Repertoire an weiblichen Koroplastiken – darunter Figuren, die typische Objekte der charis halten, also der Grazie, wie sie denjenigen ansteht, die dabei sind, sich zu verheiraten – unterstreicht die Rolle der Gottheit (oder einer der Gottheiten) als Beschützerin des menschlichen Wachstums, oder besser gesagt des Numen, das die Mädchen bei der normativen Vollendung des Statuswechsels begleitet und so das Wachsen und das Überleben der Gemeinschaft selbst überwacht.63
Am Foro Triangolare ist also für den bereits in archaischer Zeit mit Sicherheit der Minerva gewidmeten Kult, wahrscheinlich in Verbindung mit dem des Herkules, durch die zahlreichen Büsten unter den Votivgaben des 4. und 3. Jahrhunderts v. Chr. eine Verehrung der Göttin belegt, die deren Funktion als Schutzgöttin der jungen Frauen im Moment des Übergangs zwischen parthenia und ihrem Status als „Braut“ dokumentiert.64 Angesichts der in unmittelbarer Nähe gelegenen sogenannten samnitischen Palästra, eines öffentlichen Raums der paideia – für die leibliche und intellektuelle Ertüchtigung –, ist allerdings davon auszugehen, dass auch junge Männer am Kultgeschehen teilnahmen. Vor dem Hintergrund dieses Aspektes des Schutzes der dem Heiligtum anvertrauten Jugend ist es wohl kein Zufall, dass einer der Altäre vor dem großen archaischen Tempel dreigegliedert war: Möglicherweise war er für Opfer an die Nymphen bestimmt, jene Gottheiten im Plural, die oft in einer Dreigestalt verehrt wurden. Wenn diese Hypothese zutrifft, dann waren diese göttlichen Wesen der Minerva zur Seite gestellt und somit ein Hinweis auf eine ganz bestimmte Rolle der Göttin: als Schutzgottheit biologischer Veränderung, als Gottheit der Übergangsriten. Die Verbindung zu den Nymphen ließe sich über das Element Wasser bekräftigen, denn Wasser war, dank der großen Zisternen, im Areal des Heiligtums vorhanden. In diesem Zusammenhang ist auf ein kleineres Bauwerk im Tempelareal hinzuweisen: einen Monopteros, dessen im Kreis aufgestellte Säulen einen in der Mitte des Baus gelegenen Tiefbrunnen einschließen (Abb. 22). Diese Architekturform des Rundtempels lässt sich mit chthonischen Gottheiten in Verbindung bringen und könnte auf einen der Wirkungsbereiche der Nymphen verweisen: das Orakel.65
Im Heiligtum fanden dann wohl Rituale statt, die auf das Erreichen einer wichtigen Lebensphase von Mädchen und Knaben bezogen waren. Und Wasser, das reinigende Element schlechthin, muss dabei eine wichtige Rolle gespielt haben. Es ist kein Zufall, dass sich auch auf der dem Monopteros gegenüberliegenden Seite des Heiligtums, in der Nähe des Eingangsportals im Norden, ein Brunnen befand; er war mit den Zisternen des Heiligtums verbunden, und in seiner Nähe wurden die meisten Terrakottabüsten gefunden, die, wie wir gesehen haben, für den Status als nymphe gestanden haben könnten, den eine junge Frau in Vorbereitung auf ihre Hochzeit erreichte.
Minerva stand in Pompeji eindeutig für den göttlichen Schutz einer ganz bestimmten Altersgruppe. Die Gemeinschaft selbst hat also aus ihrer spezifischen historischen Erfahrung heraus diejenigen Ausprägungen einer Gottheit ausgemacht, die den Erhalt der bürgerlichen Gemeinschaft am besten verkörperte und zu schützen wusste. Es ist mit Sicherheit kein Zufall, dass sich diese besondere Ausprägung des Kultes im Umfeld griechischer Städte manifestierte, in Pompeji in Verbindung mit Neapolis. Die italischen Gruppierungen strukturierten ihre bürgerlichen Gemeinschaften und Rituale, die Stabilität und Überleben sicherten, normativ und übernahmen aus den griechischen Städten die jeweils geeignetsten Instrumente der zeremoniellen Inszenierung.
Der Epilog der langen Sakralgeschichte Pompejis ist – wie der für die übrige Geschichte – mit dem tragischen Vesuvausbruch von 79 n. Chr. verbunden. In den letzten Jahrzehnten befand sich das Heiligtum am Foro Triangolare im Wiederaufbau. Die neuen Untersuchungen konnten belegen, dass die architektonische Gestalt, die wir als heutige Besucher der Stadt vorfinden, der letzten Bauphase angehört. Diese Bauphase (Abb. 23), die weite Bereiche des Foro Triangolare umfasste, ist wohl auf die Auswirkungen des dramatischen Erdbebens von 62 n. Chr. zurückzuführen. Aus der Zeit nach dem Erdbeben stammt die Portikus (Abb. 24), die den Platz nach Westen hin abschließt und ihm die charakteristische Trapezform verleiht, von der sich der moderne Name des Forums ableitet.66 Für den Bau der neuen Portikus wurden Strukturen und Nutzungshorizonte der Vorgängerphasen, die für das neue Bauvorhaben auf einem zu hohen Niveau lagen, abgetragen: Dem Bau der westlichen Portikus mussten sowohl die nördlich gelegenen rechteckigen Raumstrukturen als auch die westliche Umfassungsmauer aus dem 2. Jahrhundert v. Chr. weichen. Letztere wurde durch die Rückwand der Portikus ersetzt, deren Flucht allerdings leicht von ihr abwich. Dies wiederum führte dazu, dass auch in den letzten Abschnitt des sogenannten Vicolo della Regina Carolina und des in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Straßenabschnitts bis zur Via del Tempio di Iside baulich eingegriffen wurde. Bei der Realisierung der neuen Portikus wurden die älteren architektonischen Bauglieder wiederverwendet. Nur so ist die scheinbare Ungereimtheit verständlich: Gemäß den Ergebnissen der stratigrafischen Untersuchung im Fundamentbereich und unterhalb der Fußböden kann die Portikus nicht vor die Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr. datiert werden; zugleich aber weist sie eine dorische Ordnung auf, die der von Gebäuden des 2. Jahrhunderts v. Chr. völlig gleicht.
Abb. 22 Am südlichen Rand des Areals, auf dem der Minervatempel errichtet wurde, befindet sich ein durch einen Rundbau mit Säulen monumentalisierter Tiefbrunnen. Wasser spielte wegen seiner Bedeutung als reinigendes Element, aber auch aus praktischen Gründen eine wichtige Rolle innerhalb der im Heiligtum vollzogenen Riten. Als Element, das die Erdoberfläche mit der unterirdischen Welt verbindet, war es mit dem Kult der chthonischen und orakelsprechenden Gottheiten, wie den Nymphen, verbunden.
Das Gebäude in der Mitte des Platzes wurde in dieser Bauphase – es war wahrscheinlich stark beschädigt – abgetragen. Die Defunktionalisierung wurde von einer Reihe ritueller Handlungen begleitet. Davon zeugen diverse kleine Opfergruben, die mit organischem Material (wie Pinienkernen etc.) und Keramik gefüllt waren; in einer davon fand sich sogar eine bronzene Strigilis (das Symbol der antiken Athleten par excellence; Abb. 25). Diese Opfergruben symbolisieren für uns das rituell begangene Ende einer Sakralgeschichte, das allerdings auch die Fortsetzung des Kults in anderer Form ermöglichen sollte.67
Abb. 23 Das Areal des Heiligtums ist durch zwei Tiefbrunnen, der eine im Norden, der andere im Süden, charakterisiert. Der südliche blieb bis zum Zeitpunkt des Vesuvausbruchs von 79 n. Chr. in Benutzung; der andere wurde, obwohl er mit dem unterirdischen Zisternensystem in Verbindung stand, im Rahmen der Errichtung der westlichen Portikus nach dem Erdbeben von 62 n. Chr. aufgegeben. Zu sehen ist hier der nordwestliche Abschnitt der Portikus: Gegenüber dem Eingang befand sich neben dem Labrum für Lustralwasser eine Statuenbasis mit der Widmung an Marcellus, den Neffen des Kaisers Augustus. (Rekonstruktion: M. Livadiotti, G. Rocco.)
Abb. 24 Die umlaufende Portikus, die das Heiligtum begrenzt, ist mit dorischen Säulen und einem in Metopen und Triglyphen untergliederten Architrav ausgeführt. Wegen des Stils und der architektonischen Ordnung wurde lange über den Zeitpunkt ihrer Errichtung diskutiert, der traditionell in hellenistische Zeit gesetzt wurde. Die jüngeren Ausgrabungen aber belegen einen Bau in der Zeit nach dem Erdbeben von 62 n. Chr. unter Verwendung älterer Bauelemente.
De facto wurde der Kult vielleicht gar nicht wieder aufgenommen. Denn der Vesuvausbruch setzte, wie überall in der Stadt, den laufenden Arbeiten ein abruptes Ende. Konserviert ist hier eine Momentaufname des permanenten ‚work in progress‘.
Die Sorge um eine würdige architektonische Ausgestaltung der Kultstätte endete also nie. Das Erdreich ist ein Archiv. Es bewahrt die Spuren von ganz unterschiedlichen Menschen und ihren Aktivitäten im und für das Heiligtum, von Priestern und Handwerkern bis hin zu den unzähligen Mädchen und jungen Männern, die hierher kamen, Generation um Generation, um einen wichtigen Moment ihres Wachsens und ihrer Biografie zu akzentuieren.
Abb. 25 Diese Strigilis wurde zusammen mit organischem Material in einer kleinen Opfergrube entdeckt. Diese Opfergruben stehen im Zusammenhang mit dem Abbau und der Defunktionalisierung des kleinen Sakralbaus, der über den grottenähnlichen Höhlungen errichtet worden war. Die Strigilis, üblicherweise aus Bronze, wurde benutzt, um den Körper nach sportlichen Übungen durch Abschaben zu reinigen. Als Votivobjekt verweist sie auf die Verbindung der im Heiligtum verehrten Gottheiten zu Sport und Wettkampf. (Foto: F. Giletti.)