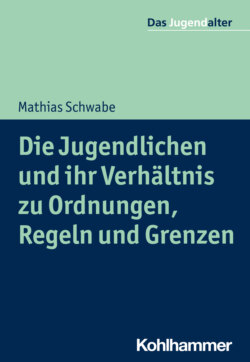Читать книгу Die Jugendlichen und ihr Verhältnis zu Ordnungen, Regeln und Grenzen - Mathias Schwabe - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.3 Kritik und Ergänzung
ОглавлениеZunächst mag sich das von Deci & Ryan geschilderte Entwicklungsprojekt attraktiv und jugendgemäß anhören. Zunehmende Selbstbestimmung, abnehmende Fremdkontrolle und die Teilhabe an Aktivitäten, die als autonome Handlungsprojekte erlebt werden, dürften für die meisten Jugendlichen genau das darstellen, was sie sich aktuell und für ihre weitere Zukunft wünschen. Wie wir in Kapitel 2 ( Kap. 2) und Kapitel 5 ( Kap. 5) sehen werden, nehmen viele Jugendliche große Anstrengungen auf sich, um diesen Wunsch zu realisieren, und schaffen sich in den Jugendkulturen, aber auch in ihren Cliquen und bei Events Orte, an denen sie Selbstbestimmung einüben und solche Projekte realisieren können.
Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie realistisch der von Deci & Ryan aufgezeigte Entwicklungsweg ist. Das stufenweise fortschreitende Gelingen der Integration von immer mehr externen Ansprüchen in das eigene Selbst und ein stetig wachsendes Autonomiegefühl aufgrund der erfolgreichen Realisierung eigener Handlungsprojekte scheinen mir einem amerikanisch-optimistischen Wunschtraum zu entsprechen. Man könnte dabei aber auch an den deutschen Idealismus denken. Denn auch für Hegel ist Freiheit vor allem Einsicht in die Notwendigkeit und freudiger Vollzug der Handlungsansprüche, die man als richtig und sinnvoll anerkennen konnte (Hegel 1817/1986, 282). Aber entspricht das der Erlebniswelt heutiger Jugendlicher?
Zudem bezweifle ich die Ausschließlichkeit der Stufenabfolge und werde aufzeigen, dass die Lebenswelten Jugendlicher sehr viel widersprüchlicher strukturiert sind und häufig komplexere Lösungen für die Normenbeachtung an unterschiedlichen Orten erforderlich machen ( Kap. 1.3). Deci & Ryan unterschätzen, dass das Projekt Autonomie beinahe ständig von zwei Seiten her bedroht wird: von innen, der Psychodynamik der Jugendlichen, die es nicht selten nahelegt, sich mit einer Pseudoautonomie zufriedenzugeben, in der man zwar über größere Freiräume verfügt, aber finanziell und/oder emotional weiter abhängig bleibt und das auch noch verleugnet. Und von außen, der Dynamik institutioneller Prozesse in Schule und Ausbildung, die häufig immer noch von weitgehender Fremdbestimmung geprägt sind und damit den Jugendlichen Scheinkooperation, Subversion und/oder offene Verweigerung nahelegen statt Verantwortungsübernahme und Mitgestaltung ( Kap. 3.3).
Gleichzeitig muss man sich klarmachen, dass soziale, normative wie ästhetische Ordnungssysteme nicht statisch sind, sondern Wandlungen unterliegen. Nur ein Beispiel: Während in der Generation der heute Fünfzig- bis Sechzigjährigen Tätowierungen randständigen Gruppen wie Seefahrern und Gefängnisinsassen vorbehalten waren, sind diese inzwischen in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Der Anteil der Tätowierten in Deutschland hat sich in den vergangenen sieben Jahren verdoppelt. Waren es 2012 noch 11,4 %, sind es 2019 21 % der Bevölkerung. Besonders verbreitet sind Tattoos unter den 20- bis 29-Jährigen: Fast jeder zweite (47,1 %) trägt eines oder mehrere (Wort & Bild Verlag 2019).
Damit hat sich eine neue Körperordnung etabliert, zu der sich jeder junge Mensch irgendwie verhalten muss im vollen Bewusstsein, dass eine Normalität einer anderen Platz gemacht hat, sich aber auch rasch wieder verschieben kann. Wer sich für ein Tattoo entscheidet, trägt die Konsequenzen ein Leben lang, auch wenn sich die Mode wieder ändert. Der Verfallswert einer Ordnung steckt aber auch andere mit Unsicherheiten an wie z. B. das Ordnungssystem von Beziehungen, von Geschlechterrollen oder beruflichen Orientierungen. Umso drängender stellt sich die Frage, was man selbst für richtig und wertvoll festhalten will und ob man sich angesichts solcher Unsicherheiten – mit Hanna Arendt gesprochen – nur noch taktisch-instrumentell »verhalten« oder noch »handeln« kann (Arendt 1967).