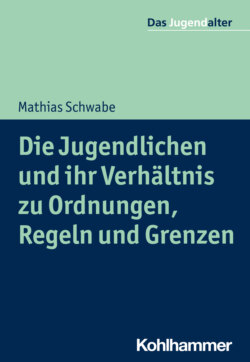Читать книгу Die Jugendlichen und ihr Verhältnis zu Ordnungen, Regeln und Grenzen - Mathias Schwabe - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.3.2 Drei Muster der Ausbalancierung
ОглавлениеWas Serkan gelingt, scheint mir der günstigste Ausgang für die Gratwanderung zwischen Regelbeachtung und der Realisierung von Autonomieansprüchen, die wir als typische Entwicklungsaufgabe für das Jugendalter propagiert haben: eine wie auch immer geartete Ausbalancierung, die sich für den Jugendlichen stimmig und halbwegs autonom anfühlt (A) ( Abb. 2). Man kann sich hier eine große Varianz von mehr oder weniger oppositionellem und/oder angepasstem bzw. subversivem Verhalten vorstellen und doch eine gewisse Zuverlässigkeit in der Orientierung, wie sie in diesem Zitat aus der 14. Shell-Studie zum Ausdruck kommt, das meiner Einschätzung nach noch immer Gültigkeit reklamieren kann:
»Die meisten Jugendlichen reagieren auf die neue gesellschaftliche Agenda nicht mit ›Protest‹ oder mit einer ›Nullbock-Einstellung‹, wie es früher in Teilen der Jugend der Fall war. Sie erhöhen vielmehr ihre Leistungsanstrengungen und betreiben ein aktives ›Umweltmonitoring‹. Das heißt sie überprüfen ihre soziale Umwelt aufmerksam auf Chancen und Risiken, wobei sie Chancen ergreifen und Risiken minimieren wollen. Mit der neuen pragmatischen Haltung einher geht auch ein ausgeprägt positives Denken. Obwohl die Jugendlichen die Gesellschaft von vielen Problemen belastet sehen, entwickeln sie eine positive persönliche Perspektive. Der ideologisch unterfütterte Pessimismus früherer Generationen, der besonders von den Studenten und Abiturienten kultiviert wurde, ist passé. Diese Einstellung passt nicht mehr zu dem unideologischen und leistungsorientierten Habitus dieser neuen Generation« (Jugend 2002, 4).
Dass die Ausbalancierung zwischen Regelbeachtung und Autonomiespielräumen unter Wahrung von Zugehörigkeiten zu verschiedenen sozialen Systemen gelingt, ist allerdings nicht selbstverständlich. Für beinahe alle Jugendliche stellt sie eine Herausforderung dar, an der sie sich abarbeiten, bei der sie immer wieder in Unsicherheiten, Entscheidungsdilemmata und Krisen geraten und eigenen wie fremden Anzweiflungen ausgesetzt sind. Häufig ist es erst am Ende einer längeren Entwicklung klar, dass sich das eigene Hin
Abb. 2: Drei Grundmuster bezogen auf die Ausbalancierung von Regelbeachtung und Eigensinn
und Her zwischen verschiedenen Orientierungen gelohnt und Früchte getragen hat.
Einige Jugendliche scheitern aber an dieser Aufgabe, weil sie die Spannung nicht aushalten und einseitig aufzulösen versuchen, was kurzfristig zu einer Entspannung, langfristig aber zu einem Anwachsen an inneren wie äußeren Konflikten führt.
Das eine Muster (B) zeichnet sich dadurch aus, dass Autonomieansprüche von den Jugendlichen in den Vordergrund gestellt werden, während sie für die Beachtung von Regeln bzw. für Anpassungsleistungen, die von ihnen gefordert werden, wenig Energie aufbringen; meist an mehreren sozialen Orten wie Familie, Schule oder Öffentlichkeit gleichzeitig. Dadurch ziehen sie viele Konflikte auf sich und geraten häufig unter Stress. Einige dieser Jugendlichen sind aufgrund bestimmter Entwicklungsrückstände wie fehlender Antizipation von Konsequenzen oder mangelhafter Impulskontrolle oder aufgrund eigener traumatischer Erfahrungen kaum in der Lage, mehrere Regeln zu beachten und die Grenzen anderer zu respektieren; andere machen den Eindruck, es nicht zu wollen, sei es, dass sie sich mit der Rolle des Rebellen identifizieren, die negativen Identitätszuschreibungen ihrer Umwelt bereits angenommen haben oder deutliche Vorteile aus dissozialem Handeln ziehen. Manche scheinen es auch zu genießen, Erwachsene in Machtkämpfe zu ziehen und zu demontieren.
Klar ist, dass es diesen Jugendlichen viel schwerer fällt, Ausgleichsbewegungen mit Teilanpassungen hier und kleinen Fluchten dort zu verbinden; man könnte ihnen das Motto unterstellen: »I want it all and I want it now!« Häufig erleben sie Erwachsene als feindselig, als Personen, die Jugendlichen nichts gönnen oder sie überflüssigerweise belästigen, oder haben sich enttäuscht von diesen zurückgezogen, weil sie sie als unzuverlässig und unfair erlebt haben (wie Matthias in Kap. 4.3). Wem zuliebe sollen sie die Mühen von Anpassungsleistungen auf sich nehmen? Ihr Bedürfnis nach Zugehörigkeit leben sie mit Peers aus, die ähnlich fühlen und handeln wie sie. In dieser Ersatzfamilie vermittelt man sich gegenseitige emotionale Rückendeckung. Das stärkt sie für ihren Konfrontationskurs, aber genau damit provozieren sie die Reaktionsweisen von Erwachsenen, die dann als feindselig erlebt werden. Ein circulus vitiosus hat sich in Gang gesetzt. Solche Jugendlichen bewegen sich in Richtung einer Eskalation, die mit gegenseitigen Verletzungen, Beziehungsabbrüchen, Konfliktsystemerweiterungen und immer drastischeren Exklusionserfahrungen und Sanktionen einhergeht. Diese Eskalationen können sich im Rahmen der Familie, eines wie auch immer gearteten Helfersystems oder im Rahmen der Strafverfolgung durch Polizei und Justiz ereignen oder häufig in allen drei Systemen parallel oder hintereinander. Solche Eskalationen führen zu Krisen, die zu Wendepunkten werden können (wie bei Frank Kap. 4.3) oder in Chronifizierungen münden. Stellvertretend dafür schildere ich das Schicksal von Tobias und Ulrike (siehe Kap. 4.5).
Das andere Muster (C) zeichnet sich dadurch aus, dass die jungen Menschen auf das Projekt der Autonomieentwicklung verzichten, sei es, weil es ihnen zu viel Angst macht (Angst, bei den Peers keine Anerkennung zu finden, Angst vor der eigenen Sexualität, Angst, das behütete Nest zu verlassen), sei es, weil sie sich zu wenig davon versprechen. Deswegen ziehen sie es vor, an eingespielten Beziehungsformen vor allem innerhalb der Familie festzuhalten, in der sie häufig bestimmte Rollen eingenommen oder zugewiesen bekommen haben, die sie nicht verlassen zu können glauben, weil sonst etwas Schlimmes passiert (siehe Fallgeschichte Celine Kap. 4.1). Solche Rollen können darin bestehen, Papas oder Mamas kleiner Liebling zu sein oder der Prellbock, der die Eltern davon abhält, sich gegenseitig etwas anzutun, oder die Fürsorgerin, die andere emotional oder physisch versorgt, oder das kränkelnde Genie, das vor dem Schmutz der Welt bewahrt werden muss, um sich optimal entfalten zu können etc. Der Familienkreis bleibt häufig ihr emotionaler Lebensmittelpunkt. Sie verhalten sich weiter brav und angepasst, besitzen oft eine hohe schulische Leistungsmotivation, neigen aber zur Abkoppelung von den Peers und zu einsamen Beschäftigungen, die sie teilweise zwanghaft betreiben. Sie handeln über weite Strecken im Modus introjizierter Regulierung, sind aber mit einigen Werten wie Leistung oder Fürsorge hoch identifiziert und haben diese in ihr individuelles Selbst integriert. Damit können sie es durchaus zu guten Schulabschlüssen und einer Einmündung in ein selbstständiges Leben bringen. Die Mehrzahl dieser Jugendlichen entwickelt aber Symptome, die das Unpassende ihrer Haltungen und Verhaltensweisen zum Ausdruck bringen. Zu den häufigsten zählen Essstörungen, die Ausbildung von Zwängen oder Depressionen und/oder soziale Phobien mit und ohne Suizidgedanken oder suchthafte Beziehungen z. B. mit dem Computer. Der Verzicht auf ein selbst initiiertes Autonomieprojekt bzw. die Angst vor der damit verbundenen Loslösung von Eltern und Kindheit rächen sich (siehe Celine in Kap. 4.1). Man könnte aber auch denken, dass sie aus ihren Symptomen bzw. der psychischen Krankheit ihr Autonomieprojekt gemacht haben. Das kann zu Dauertherapien und Drehtüreffekten in die und aus der Psychiatrie führen, irgendwann aber auch zu neuen Öffnungen der biographischen Verlaufskurve (Schütze 1999). Auch hierzu werde ich in Kap. 5 eine Fallvignette präsentieren. In diesem Zusammenhang besteht für weibliche Jugendliche auch die Möglichkeit, schwanger zu werden und ein Kind zu bekommen, womit ein forciertes Autonomieprojekt und zugleich der Verzicht auf Freiheit verbunden ist und häufig eine tiefe Ambivalenz bezogen auf Autonomie und Heteronomie zum Ausdruck kommt (Hohner 2010, 94).
Überschneidungen und Mischformen zwischen den Mustern von A mit B oder A mit C sind durchaus weit verbreitet. B und C schließen sich dagegen weitgehend aus. Männliche Jugendliche scheinen eine Prävalenz für das ungünstige Muster B mitzubringen, weibliche Jugendliche dagegen für das Muster C. Für A scheint so etwas nicht zu gelten. Der Phänotyp kann hier wie oben erwähnt beträchtlich variieren. Es sind auch noch weitere Dehnungen des Normativen möglich wie bei Serkan (vgl. Frank Kap. 4.4).