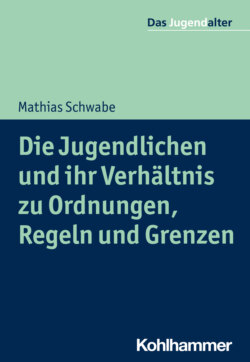Читать книгу Die Jugendlichen und ihr Verhältnis zu Ordnungen, Regeln und Grenzen - Mathias Schwabe - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.2 Jugendspezifische Moralentwicklung als Entwicklung selbstbestimmter Ziele
ОглавлениеJugendliche bauen auf vielem auf, was sie in der Kindheit gelernt haben, um damit neue und alte Aufgaben zu bewältigen (vgl. Zimmermann 1999; Göppel 2019, 164, von Salisch/Seiffge-Krenke 2008). Insbesondere Empathie und Perspektivenübernahme, aber auch das Spielen werden zuverlässige Stützen für die Bewältigung der Anforderungen in der nächsten Lebensetappe. wenn auch in erweiterten bzw. neuen Formen ( Kap. 2 und Kap. 5). Aber das moralische Selbst kann, will und muss sich weiterentwickeln. Die wichtigsten jugendspezifischen Aufgaben bestehen in einer Autonomisierung der Moral, die sich von externen Autoritäten ablösen können muss, und der kontextspezifischen Ausbalancierung von Normenbeachtung und Eigensinn. Wie wir sehen werden, geht es in diesem Lernprozess nicht nur darum, »hinreichend gut«, sondern immer wieder auch »hinreichend schlecht« oder besser »hinreichend unangepasst« handeln zu können (Bittner 2016, 31). Denn an unterschiedlichen Orten wird von den Jugendlichen Unterschiedliches erwartet und erwarten sie auch von sich selbst die Beachtung je anderer Werte und Regeln wie auch je andere Formen dieser Ausbalancierung. Es kommt demnach darauf an, sich flexibel verhalten zu können, was Nicht-Angepasstheit impliziert, ohne dabei gegen zentrale Werte zu verstoßen oder die eigene, sich formierende Identität ins vollends Diffuse entgleiten zu lassen.
Was meint Autonomisierung der Moral? Für Kinder stellt es häufig kein Problem dar, sich einem fremden Regime wie dem der Schule unterzuordnen und dort gleichsam mitzuschwimmen, vor allem, wenn sie erleben, dass dies von allen gefordert wird. Sie spüren häufig sogar einen gewissen Stolz darüber, dass sie diesen Disziplinanforderungen außerhalb des Elternhauses gewachsen sind, und wenden dafür mitunter ein Ausmaß an Impulskontrolle auf, zu dem sie zu Hause manchmal nicht (mehr) bereit sind. Zugleich betrachten sie andere, denen das nicht gelingt, mit Missbilligung oder gar Verachtung.
Für Jugendliche wird eine solche fraglose Anpassung in dem Maße schwieriger, in dem sich ihr Selbstbild verändert (King 2004, 55; Müller, B. 2010, 397 f.). Die Unterwerfung unter fremdbestimmte Regeln kollidiert mit ihren Autonomieansprüchen. Entweder gelingt ihnen, was von ihnen gefordert wird, als sinnvoll anzuerkennen und sich zu eigen zu machen, weshalb sie solche Regeln auch einhalten oder es zumindest von sich selbst erwarten. Oder aber sie erleben diese als fremdbestimmt, zweifeln deren Sinn an und unterstellen, dass man sie damit unnötig gängeln möchte, weshalb Widerstand und/oder Ignorieren zur Wahrung der eigenen Autonomieansprüche geboten erscheinen.
Serkan, ein gerade 14 Jahre alt gewordener türkischstämmiger deutscher Junge, bringt das so auf den Punkt:
»Ey, Mann ich bin jetzt doch schon groß. Nachmittags helfe ich meinem Onkel im Laden und geb’ Wechselgeld (aus der Kasse) und so was alles bis abends um zehn. Ohne Pause, oder nur mal kurz so 5 Minuten, wenn’s grade geht. Mit so ne Kunden, manchmal …, die sind nicht gerad nett (verdreht die Augen). Aber mein Onkel sagt: der Kunde hat immer Recht. Also kneif Arsch zusammen und lächel! (grinst breit). Glaub mir Alter, das is kein Sahneessen, das is Maloche, richtig hart. Aber hier (gemeint ist die Schule) werd ich immer noch behandelt wie Kindergarten! Von wegen keine Kappen im Unterricht, nimm die ab, und Handyverbot und keine Musik hören in der Pause und diese Musik geht nicht und die Texte von dem Heino sind verboten und von jenem und keine Filme anschauen, und schon gar keine Pornos und noch tausend so Sachen. Mann, wo sind wir da? Und dann die ganze Zeit stillsitzen und das Gelaber anhören. Und dann noch ja, Frau S. und ja Herr B. danke für die Fünf in Mathe … bin ich selbst schuld, dass ich das nicht kapiere und lauter so Faxen …«
Wie man hört, gibt es auch im Laden seines Onkels viele, explizite und implizite Regeln, an die er sich halten muss, wenn er dort arbeiten will (nicht erwähnt hat er in diesem Interviewabschnitt das strikte Rauchverbot, was für ihn, der regelmäßig heimlich raucht, eine große Herausforderung darstellt). Aber er hält sich an sie. Der Unterschied ist, dass er sich im Laden und mit den Kunden in der Welt der Erwachsenen bewegt und von diesen als Großer ernst genommen wird, während für ihn in der Schule immer noch die gleichen Regeln gelten wie seit seiner Kindheit. Zudem hat er das eine Betätigungsfeld selbst gewählt und verdient dort eigenes Geld und ist deswegen auch bereit dazu, Neues zu lernen und gewisse Härten in Kauf zu nehmen. Bei Schule handelt es sich aber für ihn um eine seit Jahren auferlegte Pflichtveranstaltung, bei der er sich von den Erwachsenen als Kind behandelt sieht und mehr Misserfolgs- als Erfolgserlebnisse bilanziert und damit – ganz anders als im Laden des Onkels – wenig Gelegenheit für Selbstwirksamkeitserfahrungen und den Aufbau einer positiven Identität erhält.
Sicher könnten Vertreter*innen der Schule häufig ausführlicher begründen, welche vernünftigen Gründe hinter den unverhandelbaren Regeln stehen, und könnten andere Regeln zur Aushandlung freigeben, sodass diese auf Klassenebene als selbst- oder mitbestimmt erlebt werden könnten. Das würde nicht schaden, aber ob es dabei hilft, dass sich die Jugendlichen vermehrt an die Regeln halten, bleib fraglich. Offensichtlich hält sich Serkan an die Regeln im Laden seines Onkels, weil er dort sein will, nicht weil sie ihm gut begründet erscheinen und er ihre Geltung einsehen könnte. Die Bedeutung von Einsicht für die Einhaltung von Regeln scheint ein häufiges rationales Missverständnis vieler Erwachsener im Umgang mit Jugendlichen darzustellen. Es motiviert sie zu langen Erklärungen, die viele Jugendliche gar nicht interessieren. Jugendliche können sich an die (in Erwachsenensicht) absurdesten und pingeligsten Regeln halten, wenn sie sich mit dem Rahmen identifizieren können wie z. B. mit einer bestimmten Jugendkultur oder der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Clique ( Kap. 2). Beachtung oder Missachtung von Regeln hängt in erster Linie von der performativen Attraktivität des Rahmens ab, konkret davon, ob das Handeln in diesem Rahmen Freude macht und/oder neue interessante Erfahrungen bietet oder glaubhafte Zukunftsperspektiven eröffnet. Nur wenn Aushandlungsprozesse dazu beitragen, werden sie auch einen Beitrag zu regelkonformen Verhalten darstellen.
Bei der Frage, ob Regeln eingehalten und Grenzen beachtet werden, stellt sich für Jugendliche demnach zunächst die Frage, aus welcher Motivation heraus das geschehen kann und soll, oft noch vor der Frage nach den konkreten Inhalten der Erwartungen. Dafür ist die von Deci & Ryan ausdifferenzierte Unterscheidung von extrinsischer und intrinsischer Motivation zentral (Deci & Ryan 1993 und 2017). Bei einer intrinsischen Motivation gibt es »keinen vom Handlungsgeschehen separierbaren Kontrollimpuls« (222). Aus einer intrinsischen Motivation entsteht freudvolle Aktivität, die mit Neugier, Explorationslust, Spontaneität und Interesse einhergeht (ebd.). Misserfolge werden als Herausforderungen betrachtet, die man überwinden kann und will. Liegt eine intrinsische Motivation vor, braucht es keine Aufforderung zum Handeln und müssen auch keine Ordnungsregeln dafür formuliert werden. Noch bevor der Lehrer die Klasse betritt, hat das Kind z. B. sein Buch aufgeschlagen und liest den Text, weil ihn der Inhalt interessiert. Intrinsische Motivationen können aber auch zu Problemen führen, z. B. weil das Kind ganze Nächte durchliest oder – wahrscheinlicher – sich auch nach vielen Stunden nicht von seinem Computerspiel lösen kann.
Extrinsische Motivationen werden dagegen durch eine Aufforderung in Gang gesetzt, die von außen gestellt und deswegen als fremdbestimmt erlebt wird, aber dennoch mehr oder weniger internalisiert werden kann. Mit Blick auf diese Möglichkeit unterscheiden Deci & Ryan vier Stufen extrinsischer Motivation:
A) Externale Regulation: Man befolgt die Regel, weil damit Belohnungen oder Bestrafungen verbunden sind. Das eine ist erwünscht, das andere gefürchtet oder geht sogar mit Angst einher: Angst vor den unangenehmen Folgen einer Anzeige, wenn man im Supermarkt gestohlen hat, oder der Meldungen über schulisches Fehlverhalten an die Eltern, aber auch Angst vor einer öffentlichen Beschämung (wenn man z. B. beim Schwarzfahren erwischt wird und meint, von allen Passagieren missbilligend angestarrt zu werden). Wer sein Verhalten über externale Regulation steuert, wird seine Umwelt beobachten. Wenn diese aufhört zu belohnen oder zu bestrafen, wird man auch die eigene Handlungsregulierung zurücknehmen. Sie bleibt sozusagen auf Nachschub angewiesen. Das bedeutet aber auch, dass die externen Regulatoren, um zuverlässig lohnen und strafen zu können, leibhaft oder vermittelt z. B. über eine Beobachtungskamera präsent sein müssen. Als extern Regulierter versucht man, das, was man abweichend von den Regeln machen will, in den Momenten der Abwesenheit der Kontrollierenden oder in toten Winkeln zu praktizieren. Man verändert sein Verhalten nicht, sondern passt es nur so lange an, wie man sich davon Vorteile bzw. die Vermeidung von Unlust verspricht.
Man mag externale Regulation als eine niedrige Stufe der Moralentwicklung einschätzen. Sie ist auch weit davon entfernt, als autonom gelten zu können. Und doch stellt sie eine Stufe dar, die manche Jugendliche nicht zuverlässig bedienen können – oder wollen. Ihre egozentrische Weltsicht und ihre Unfähigkeit zum Bedürfnisaufschub sind so groß, dass sie trotz möglicher Sanktionen bestimmte Regelverstöße begehen. Die Unlust einer späteren negativen Konsequenz kann entweder nicht vorausgesehen werden oder verblasst angesichts des momentanen Lusterlebens und bleibt deswegen für die Steuerung des eigenen Verhaltens irrelevant.
Andere Jugendliche – wenn auch nur wenige – fühlen sich von beinahe jedem Versuch der externen Regulierung herausgefordert und lassen es auf einen Machtkampf mit dem Regelvertreter ankommen. Die Ansprache lautet dabei oft. »Was wollen Sie von mir? Sie haben mir gar nichts zu sagen!« Hierbei kann es sich um ein Omnipotenzgebaren handeln, mit dem der Jugendliche schon seit Langem, auch schon als Kind, aufgetreten ist mit der Folge, dass sich die meisten Erwachsenen zurückgezogen und Regelübertretungen geduldet haben, um eine Konflikteskalation zu vermeiden. Es kann sich aber auch um eine Kompensationshaltung handeln, denn manchmal werden (oder wurden) solche Jugendliche in anderen Kontexten brutal gezwungen, sich zu unterwerfen (Familie, Peers), und versuchen, diese Kränkung durch auftrumpfendes Verhalten an anderen Orten, an denen sie mit weniger drastischen Maßnahmen rechnen, zu reparieren. Es kann sich aber auch um einen radikalisierten Autonomieanspruch eines Jugendlichen handeln, der sich vor einigen Jahren an fremdbestimmte Regeln anpassen konnte, die ihm heute aber als eine Form der Unterwerfung erscheinen, die er nicht mehr mit seinem Selbstbild vereinbaren kann (siehe oben Serkan).
B) Introjizierte Regulation meint, dass sich interne Anstöße zur Verhaltenssteuerung mit internem Druck verbinden. Zu den internen Anstößen kommt es, weil das Kind inzwischen die Gebote von Respektspersonen (Eltern, Lehrer*innen) verinnerlicht hat. Sie sind und bleiben in ihm präsent und beanspruchen Geltung, unabhängig davon, ob diese Personen anwesend sind oder nicht. Das Kind würde leiden, wenn es diesen verinnerlichten Ansprüchen nicht Folge leistete. Entweder brächte es seine Selbstachtung in Gefahr oder bekäme ein schlechtes Gewissen und zwar unabhängig davon, ob externe Autoritäten seine Regelverletzung mitbekommen oder nicht. Mit den Stichworten »Selbstachtung« und »schlechtes Gewissen« spielen Deci & Ryan auf die Konzepte Ich-Ideal und Über-Ich an. Mit diesen beiden entsteht das, was Fritz Redl control from within genannt hat (Redl & Wineman 1976). Introjizierte Regulation wäre nach diesem Verständnis eine Form der inneren Kontrolle, deren Inhalte auf die Wünsche und Gebote relevanter Anderer (Eltern, größere Geschwister, geachtete Lehrer*innen) zurückgeführt werden können, sich aber von diesen zuverlässig abgelöst hat. Diese relevanten Anderen müssen nicht mehr explizit erinnert werden. Die Inhalte können vor- oder unbewusst geworden sein. Die Regulative sind so verinnerlicht, dass sie sofort wirksam werden und in den laufenden Handlungsprozess intervenieren und diesen mitsteuern oder aber sofort nach Beendigung ins Bewusstsein schießen oder sich als Gefühl von Stolz oder Unwohlsein Präsenz verschaffen. Damit ist viel erreicht, aber noch keine autonome Handlungsregulierung.
Deci & Ryan schreiben:
»Eine introjizierte Handlungsregulation ist insofern internal, als keine äußeren Anstöße mehr nötig sind, aber sie bleibt doch weiterhin vom Selbst separiert. Metaphorisch gesprochen: Regulator und Regulierender sind verschieden, obwohl sie beide derselben Person innewohnen« (ebd. S. 226).
Auch hier lässt die Sprache von Deci & Ryan Vertrautheit mit der psychoanalytischen Terminologie vermuten. Denn dort würde man etwas Introjiziertes als Introjekt bezeichnen und damit ein inneres Objekt mit dem Charakter eines Fremden meinen. Es kann als unterstützend erlebt werden, als eine wohlwollende innere Stimme, oder als innerer Verfolger, dessen Einredungen einen bedrängen oder quälen und die man mit noch so viel Anstrengung nicht zur Ruhe bringen kann. Oder aber, das wird im folgenden Zitat von Bittner deutlich, sie bleiben unverbindlich und irrelevant:
»Wird nur (…) das verbal formulierte Gebot oder Verbot des Vaters oder der Mutter verinnerlicht, dann handelt es sich um keine ›innere‹, sondern nur um eine wahrscheinlich wenig wirksame ›internalisierte‹, sozusagen nach innen geklappte äußere Grenze. Eine innere wird daraus erst, wenn ich sie in mein Bild von der Welt aufgenommen habe – und das kann niemand für mich, das kann ich nur selbst tun« (Bittner 2016, 29).
Der Fremdheitscharakter vieler Ansprüche im eigenen Selbst dürfte der Grund sein, weshalb sich Kinder und in noch sehr viel stärkerem Ausmaß Jugendliche gegen diese Art der introjizierten Regulierung wehren. Wenn sie diese – teilweise oder überwiegend – als eine fremde Macht erleben, die ihr Innenleben besetzt hat, liegt es nahe, diese Stimme zu überhören, sich über sie hinwegzusetzen oder sie auszutricksen, indem man z. B. einen Keil zwischen diese Stimme und den eigenen Handlungsplan treibt. Dann ergreift man die Rolle des Regulators und bringt eine Handlung so zur Ausführung, wie man es gewünscht hatte, und beruhigt den Einspruch des Gewissens (des Regulierenden) dadurch, dass man diesem weis macht, es wäre in dieser Situation nicht anders gegangen, würde sich nur um eine Ausnahme handeln oder hätte gravierende Nachteile für sich und andere bedeutet, wenn man der Stimme gefolgt wäre. In der Sprache der Psychoanalyse sind das Rationalisierungen, mit denen man nachträglich Abweichungen von Ansprüchen des Über-Ichs oder Ich-Ideals rechtfertigt, um sich Schuld- oder Schamgefühle zu ersparen.
Wie wir gehört haben, kann dieses Stadium nicht autonom genannt werden. Gleichzeitig wären viele Eltern und Pädagog*innen glücklich darüber, wenn so viel an »innerer Kontrolle« halbwegs zuverlässig abrufbar wäre, prospektiv handlungsregulierend oder zumindest nachträglich in Form von Schuld- oder Schamgefühlen. Aber offensichtlich kann man nicht mehr davon ausgehen, dass Über-Ich und Ich-Ideal noch immer so effektiv wirken wie in der Stufe davor.
C) Das Stadium der identifizierten Regulation ist erreicht, wenn ein Verhalten vom Selbst als persönlich wichtig oder wertvoll anerkannt und deswegen auch praktiziert wird (ebd. 228). Man tut etwas nicht (mehr) deswegen, weil man es tun soll(te) oder sich bei Nichtbeachtung des Anspruchs auf unterschiedliche Formen von äußerem oder innerem Druck einstellen muss (schlechtes Gewissen, Selbstvorwürfe, Beschämung, diffuses Unwohlsein), sondern, weil man davon überzeugt ist, dass es sinnvoll und richtig ist und einem selbst und/oder anderen guttut und/oder mit einer gewünschten und erreichbaren Zukunft in Verbindung steht. »Diese persönliche Relevanz resultiert daraus, dass man sich mit den zugrunde liegenden Werten und Zielen identifiziert und sie in das individuelle Selbstkonzept integriert hat« (ebd.).
Man beachte den Unterschied zwischen internalisiert und identifiziert bzw. integriert. Etwas Internalisiertes verweist auf etwas ursprünglich Externes, während etwas, mit dem man sich identifiziert, die Spuren der Fremdheit abgestreift hat und zu einer eigenen Sache geworden und Teil oder Ausdruck des eigenen Selbst ist.
Vergleichen wir das mit der Situation von Jugendlichen: Viele betreiben Sport mit hoher Motivation und bringen dafür auch ein hohes Maß an Disziplin auf. Sie betrachten es als ihr Projekt, für das sie sich Ziele setzen und eigenen Regeln unterwerfen. Handelt es sich hierbei um ein autonomes Handeln? Nach Deci & Ryan, käme es auf die Art der Motivation an. Die Jugendlichen können den Sport verbissen betreiben und dabei unter Druck stehen. Bei Nichtbefolgung ihrer eigenen Handlungsregeln würden sie mit Selbstvorwürfen oder schlechter Stimmung rechnen oder mit Kritik von Seiten der Peers, weil sie sich in Gefahr sehen, dicker zu werden, als sie sein wollen, oder einen weniger muskulösen Körper zeigen zu können, als sie gerne hätten. Damit würden sie sich im Bereich von introjizierter Regulation bewegen. Es handelt sich um ein eigenes, aber nicht um ein selbstbestimmtes oder autonomes Projekt. Anders verhält es sich, wenn sie die Disziplin aufbringen, weil sie sich nach dem Sport ausgeglichen fühlen, sich besser konzentrieren können und es genießen, gesund zu sein. Und wenn sie sich hin und wieder einen faulen Nachmittag oder zwei Sport-freie Tage in der Woche gönnen, also engagiert, aber zugleich locker mit dem eigenen Handlungsprojekt umgehen. In diesem Fall kann man davon ausgehen, dass die Integration des Anspruchs in das eigene individuelle Selbst stattgefunden hat, während sich die anderen Jugendlichen eher noch mit den Ideen eines kollektiven Selbst identifizieren, in dem sich die eigenen und die Ansprüche der Peers vermischen.
Selbstbestimmtes Handeln stellt sich also ein, wenn sich Jugendliche mit (ursprünglich fremden) Regeln und Ansprüche identifizieren und diese ins individuelle Selbst integriert haben. In psychoanalytischer Terminologie ausgedrückt, hätten die Jugendlichen in diesem Stadium die Ich-fremden Anteile am Über-Ich und Ich-Ideal überwunden oder ausgeschieden und reifere Formen dieser Instanzen entwickelt, die eher als unterstützend und motivierend, weniger als fordernd und kontrollierend erlebt werden.
Damit stellt sich freilich die Frage, was diejenigen Jugendlichen erleben, die auf Grund von befürchtetem oder tatsächlich einsetzendem inneren Druck Sport machen? Sicher würden sie einräumen, dass ihr Handeln nicht wirklich als autonom gelten kann. Andere würden aber weiter behaupten, selbstbestimmt zu handeln, sei es, weil sie den Druck nicht spüren, den sie sich selbst machen (bzw. verleugnen), sei es, weil sich für sie »selbstbestimmt« und »Druck empfinden« nicht ausschließen. Das könnte daran liegen, dass es neue und andere Gebote sind, die sie in sich errichtet haben. Denn tatsächlich sind mit dem Jugendalter im Ich-Ideal neue Bilder entstanden, an denen man sich von da an misst (z. B. schlank, aber mit Muskeln). So wie auch dem Über-Ich Mängel ins Auge stechen, die es vorher nicht gesehen hat, wie z. B. die eigene Gier (mehr essen als geplant) oder der innere Schweinehund (auf dem Sofa liegen statt aktiv sein). Das können in der Kindheit noch zweit- und drittrangige Themen gewesen sein, die keinerlei Kontrolle unterworfen worden waren, neuerdings aber schon.
Insofern hätten die Jugendlichen recht. Sie haben – wenn auch mit Blick auf Peers und/oder motiviert durch die Werbung – ausgewählte neue Leitbilder in sich zugelassen und reklamieren dafür Selbstbestimmung, auch wenn diese noch immer mit innerem Druck verbunden sind. Somit hätten sie die Inhalte der introjizierten Regulierung gewechselt, aber noch nicht deren Form.
Daneben wird man bei vielen Jugendlichen aber auch Mischungsverhältnisse annehmen können, in denen sich »innerer Druck« und »Freiheit zu«, also introjizierte und identifizierte Regulierung im Übergang befinden bzw. abwechseln.
D) »Integrierte Regulation ist die Form der externalisierten Regulation mit dem höchsten Grad der Integration in ein kohärentes Selbstkonzept« (ebd. 229). Diese Form stellt die Endstufe der Internalisierung dar. Sie ist das Ergebnis der Integration verschiedener, eventuell auch in Spannung zueinander stehender Ziele, Normen und Handlungsstrategien in eine Struktur, die Deci & Ryan als Kernselbst bezeichnen. Neu an dieser Stufe sind also einerseits die Unterschiedlichkeit von Zielen, die auftreten, wenn man mehrere Handlungsprojekte verfolgt und sich in unterschiedlichen Systemen bewegt, und andererseits die Idee eines Kernselbst. Dieses scheint wie ein Filter zu wirken, der nur die zentralen, wirklich wichtigen Selbstverpflichtungen »durchlässt« und in sich integriert, während andere Ziele, die das individuelle Selbst bewegt haben, dort keinen Eingang finden, auch wenn man sich mit ihnen durchaus identifiziert. Vieles ist wichtig, aber nur weniges existenziell wichtig. Bittner schreibt dazu:
»Wirkliche Grenzen sind solche, die ich nicht nur im Gehorsam gegen ›internalisierte‹ externale Grenzen respektiere, sondern weil ich gar nicht anders kann als sie zu beachten, wenn ich mich nicht selbst unglücklich machen will« (Bittner 2016, 27).
Deci & Ryan schildern als Beispiel einen jungen Menschen, der wissenschaftliche Interessen verfolgt und eine Karriere an der Hochschule anstrebt und gleichzeitig ein erfolgreicher Baseballspieler werden will (Deci & Ryan 1993, 228). Es ist klar, dass diese Ziele miteinander in Konflikt geraten können. Beides verlangt Engagement und Zeit. Seine begrenzte Zeit wird nicht immer für beides reichen. Gleichzeitig sind damit verschiedene Rollen mit unterschiedlichen Spielregeln verbunden: Der Student, der sich zurückzieht, stundenlang liest und sich an akademischen Diskussionen beteiligen will, bedarf ganz anderer Fähigkeiten und muss ganz anders auftreten als der Sportler, der Teil eines Teams ist und in der Mannschaft auf einer bestimmten Position spielen möchte. Zudem werden seine Freunde und Bekannten ebenfalls eher sport- oder eher wissenschaftsorientiert sein. Beide Kreise erwarten Unterschiedliches von ihm und beäugen ihn immer wieder auch als einen, der nicht wirklich zu ihnen gehört. Der junge Mann muss deswegen nicht nur zwei Wertesysteme in sich integrieren, sondern auch lernen. sich in zwei Welten mit unterschiedlichen Ansprüchen zu bewegen und dabei immer wieder einen Ausgleich zwischen beiden herzustellen. Zugleich hat er genau dieses Doppelleben gewählt und fühlt sich diese seine Entscheidung autonom an. Oder er beweist sich seine Autonomie dadurch, dass er zwischen diesen Werten und Welten wechseln kann.
Das Beispiel ist bei Deci & Ryan so angelegt, dass zum Kernselbst des jungen Mannes beide Projekte gehören. Er würde eine Art von Amputation an sich vornehmen, wenn er nur das eine oder nur das andere leben würde. Aber es wäre durchaus denkbar, dass der Prozess der Integration ins Kernselbst eine Entscheidung für das eine gegen das andere ermöglicht oder sogar erforderlich macht. Was wirklich zum Kernselbst gehört und was »nur« zum Selbst und deswegen zurückgestellt werden kann, kann man nur selbst herausfinden. Wichtig ist, dass sich die Tätigkeiten und das Leben, das man führt, nur dann selbstbestimmt und autonom anfühlen, wenn man diesen Prozess zu einem halbwegs stimmigen Ergebnis gebracht hat.