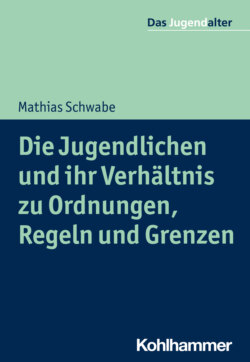Читать книгу Die Jugendlichen und ihr Verhältnis zu Ordnungen, Regeln und Grenzen - Mathias Schwabe - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.1 Was Kinder an Regelbewusstsein und Selbststeuerungs-Kompetenzen ins Jugendalter mitbringen sollten
ОглавлениеAufgrund ihres hohen Spezialisierungsgrades trennt die Entwicklungspsychologie häufig emotionale, kognitive bzw. sprachliche und soziale Entwicklung voneinander ab. Damit sich ein Kind in einem bestimmten Ordnungssystem an Regeln halten und Grenzen beachten kann, müssen aber alle diese Dimensionen in Austausch miteinander treten und auf komplexe Weise zusammenspielen. Nur wenig hängt dabei vom guten Willen des Kindes ab oder seiner Bereitschaft zu regelkonformem Verhalten.
Worin bestehen die Erwartungen an Regelbeachtung/Selbstkontrolle, die an Kinder zwischen 4 und 12 Jahren gerichtet werden? Kinder sollten
körperliche Gewalt (schlagen, schubsen, treten, spucken etc.) gegen andere beenden können, wenn sie dazu aufgefordert werden, oder (bei Älteren ab 8 bis 10 Jahren) gar nicht erst damit anfangen;
schwächere Kinder nicht ärgern und drangsalieren bzw. dies auf Aufforderung unterlassen, auch wenn Erwachsene nicht kontrollierend danebenstehen;
die Intimzonen und intime Verrichtungen anderer Kinder (und Erwachsener) respektieren; z. B. nicht die Toilettentüre öffnen oder die Genitalien berühren, wenn das andere Kind nicht damit rechnet;
Unmut und Ärger zunehmend äußern, ohne zu schreien oder zu schlagen;
fremdes Eigentum respektieren; fragen, wenn man sich etwas von einem anderen nehmen will bzw. es auf Aufforderung wieder zurückgeben;
sich an festgelegten Orten aufhalten; sich nicht unerlaubt aus Elternhaus oder Schule entfernen; nicht ohne zu fragen, Räume betreten, die von anderen genutzt werden;
Aktivitäten beenden, von dem Erwachsene meinen, dass sie gefährlich oder schädlich wären (z. B. zu viel essen, zu wild rennen);
jemandem eine Hilfestellung anbieten bzw. geben, wenn sie darum gebeten werden, oder wenn sie selbst sehen, dass jemand in Not ist oder sehr traurig;
etwas auf Aufforderung einer Autoritätsperson holen, beenden oder aufräumen, auch wenn man dafür eine andere Aktivität unterbrechen muss (spielen);
eine Situation verlassen, in der sich ein Konflikt zugespitzt hat, alleine oder an der Hand eines zugewandten Erwachsenen;
für eine gewisse Zeit zuhören, stillsitzen und selbst nicht sprechen (von 5 Minuten bis 4 Stunden Schule unterbrochen von Pausen) bzw. sich melden und warten bis man aufgefordert wird, sich zu äußern;
aufmerken, wenn eine offiziell ernannte Autoritätsperson das Wort an es wendet, und dieser Auskunft geben;
auf Aufforderung darüber nachdenken, was ein Anderer anderes von einem erwartet hätte, bzw. darüber nachdenken, inwieweit man mit dem eigenen Handeln die Handlungspläne anderer behindert oder verunmöglich hat;
kollektiven Ordnungsanweisungen Folge leisten wie z. B. sich in einer Reihe aufstellen und an der Hand fassen. Gemeinsam losgehen oder stehenbleiben, wenn man dazu aufgefordert wird etc. Auf ein Klingelsignal achten und ihm Folge leisten wie z. B. ins Klassenzimmer zurückkehren.
Die aufgezählten Beispiele umfassen sicher nicht alle Erwartungen, die an Kinder im Alter von vier, fünf bis zwölf Jahren bezüglich Regelbeachtung herangetragen werden, summieren sich aber bereits zu einer eindrucksvollen Liste. In der Regel wird von Kindern nicht verlangt, dass sie alle Regeln jederzeit in ihrem Verhalten umsetzen können. Gleichwohl wird von ihnen erwartet, dass sie Hinweise auf Regelverstöße ernst nehmen und sich damit auseinandersetzen, d. h. ein generalisiertes Regelbewusstsein entwickeln (Textor 2005) und auf dessen Grundlage zu Befriedigungsaufschub und Frustrationstoleranz in der Lage sind (Mischel 2015; Peters 2007, 200; Rosenzweig 1938). Kinder, die in einem oder mehreren Ordnungssystemen häufig gegen Regeln verstoßen und kein Regelbewusstsein zeigen, fallen damit auf und werden sich mittelfristig weder im Kindergarten noch der Schule wohlfühlen, keine guten Lernerfahrungen machen und wohl auch keine Freunde gewinnen (vgl. dazu Opp/Otto 2016, 186 f.).
Gebote und Verbote werden von Kindern in der Regel nicht einzeln und isoliert wahrgenommen und angeeignet, sondern im Rahmen von Beziehungen mit Personen aus dem Nahraum und als miteinander verbundene Elemente von Ordnungssystemen. Weil man als Mitglied eines Systems betrachtet wird und auch selbst zu diesem gehören möchte, schenkt man den dort vertretenen Regeln Beachtung. Im jeweiligen System beziehen sich die Regeln jeweils aufeinander, ergänzen sich und stabilisieren sich wechselseitig. Dasselbe gilt zwischen den Ordnungssystemen wie Elterhaus, Schule und Öffentlichkeit: Auch wenn es in jedem System spezifische Regeln gibt und nur ein Teil von ihnen überall mit der gleichen Dringlichkeit eingefordert wird, nehmen Kinder doch wahr, ob die Erwachsenen in den verschiedenen Systemen in zentralen Werten übereinstimmen und ihnen Ähnliches oder das Gleiche abverlangen.
Viele Erwartungen werden zunächst im Ordnungssystem Familie thematisiert und eingeübt (Unmut, Ärger und Gier kontrollieren; Gewaltverbot beachten; Verhandlungen führen; Hilfe annehmen und anbieten) und aus dieser Keimzelle in andere Ordnungssysteme übertragen (Krappmann 1983). Einige der Anforderungen stehen überwiegend im institutionellen Ordnungssystem KiTa und/oder Schule im Fokus (Regeln, die mit Autoritäts- und Aufsichtspersonen zu tun haben, mit Raumregeln, Stillsitzen und Disziplin). Hier stellt sich die Frage, ob das, was zum Funktionieren der Institution beträgt, auch der Entwicklung der Kinder dient oder diese belastet und/oder behindert? Häufig wird sowohl das eine als auch das andere der Fall sein ( Kap. 3.3). Das in Institutionen gebildete Regelbewusstsein kann wiederum in informelle soziale Begegnungen wie einen Spielplatz oder einen Kindergeburtstag eingebracht werden (Eigentum respektieren, Hilfeleistungen erbringen, Empathie gegenüber Schwächeren). Davon profitieren vor allem die sozialen Beziehungen mit den Peers. Gemeinsam bilden diese Regeln ein gesellschaftliches Ordnungssystem, das einen bestimmten Zivilisationsstandard repräsentiert, der für alle Teilnehmer*innen ein gewisses Maß an Sicherheit und Berechenbarkeit garantiert (Elias 1939/1976, Reemtsma 2008).
Was sind die entwicklungspsychologischen Voraussetzungen dafür, dass ein Kind diesen Ansprüchen nachkommen kann, ohne damit zu sehr unter Druck zu geraten? Für die sechs wichtigsten halte ich diese ( Abb. 1):
1. eine basale Fähigkeit zur Besorgnis (D.W. Winnicott) und die Entstehung eines moralischen Selbst (M. Hoffmann)
2. Grundlagen von Empathie (H. Kohut) und Mentalisierung (P. Fonagy/M. Target)
3. Grundlagen der Selbstregulierung von Erregung (arousal) und Stimmungen sowie Impulskontrolle (P. Fonagy und M. Target; M.Dornes)
4. Erste und zweite Schritte bei der Fähigkeit zur Überwindung einer ausschließlich egozentrischen Weltsicht (J. Piaget)
5. Erste und zweite Schritte bei der Fähigkeit zur Perspektivenübernahme (H. Kohlberg und J. Selman)
6. die Fähigkeit zum Spielen als Raum der Transformation von triebhaften Impulsen und als Ort der Verständigung über Regeln (G. Bateson, D.W. Winnicott, J. Piaget, P. Fonagy).
Zu (1): Mit der Fähigkeit zur Besorgnis meint D.W. Winnicott einen Entwicklungsprozess, der in der frühen Kindheit noch vor dem ersten Lebensjahr stattfindet (Winnicott 1988, 134 f.). Wie Melanie
Abb. 1: Entwicklungspsychologische Voraussetzungen für das Befolgen-Können von Regeln und das Einhalten von Grenzen
Klein unterstellt auch er dem Säugling aggressive und sadistische Impulse, die sich gegen die Brust bzw. die Mutter richten (Klein 1972). Sie entwickeln sich, weil das Kind nach und nach erkennt, dass das, was es am meisten braucht und am heftigsten begehrt, zugleich etwas ist, was es nicht kontrollieren kann. Vorher hatte es die Mutter als verlängerten Teil des eigenen Selbst empfunden und behandelt. Nun dämmert ihm, dass sie ein eigenes Wesen darstellt, das ein Eigenleben führt. Nach Winnicott bewegt sich das Kind zunächst in einem Stadium der Unbarmherzigkeit (Winnicott 1988, 136). Es würde die Brust mit der geballten Ladung seiner Destruktivität angreifen, teils aus Hass aufgrund ihrer Nicht-Verfügbarkeit, teils weil eine gewollte Zerstörung immerhin noch eine Form von Kontrolle darstelle. Irgendwann in diesem Prozess würde der Säugling aber Ängste entwickeln, weil die Brust bzw. die Mutter, die es angreift, zugleich die ist, die er liebt, und er mit deren Vernichtung auch die Gemeinschaft mit ihr zerstören würde. Das ist mit dem Begriff Besorgnis (concern) gemeint. Es handelt sich um eine Form einer Rücksichtnahme, die sich auf ein Objekt bezieht, von dem sich das Kind abhängig sieht, mit dem es einerseits immer wieder verschmilzt und das es andererseits schon als Gegenüber erleben kann. Diesem gegenüber mäßigt es seine Aggressionen und zeigt Gesten des Bedauerns und/oder der Wiedergutmachung, wenn es die Mutter doch wieder einmal heftig angegriffen haben sollte. Aus der Fähigkeit zur Besorgnis entwickeln sich nach Winnicott nach und nach reifere Formen des Schuldgefühls und der Verantwortungsübernahme bzw. der Wiedergutmachungsbereitschaft, die durch kognitive Schemata und über Sprache verfestigt werden. Diese bauen jedoch auf einer präverbalen, leibnahen und unbewussten emotionalen Grundlage auf. Wenn diese fehlt, können die kognitiven Schemata moralischen Denkens und Handelns schnell brüchig werden und/oder bleiben die Selbst- oder Fremdeinredungen, mit denen Aggressionen kontrolliert werden sollen, wirkungslos, weil sie nicht tief genug ansetzen. Wer aber über eine Erlebnisschicht verfügt, in der er sich mit anderen bzw. mit dem Angewiesen-Sein und der Bedürftigkeit aller Lebewesen identifizieren kann und mit diesen eine Art Körpergemeinschaft bildet, der kann nicht quälen, foltern oder töten, weil ihn sonst sein eigener Leib schmerzen würde. Der würde, selbst wenn er wütend wird und hasst, nicht mehr unbarmherzig zerstören wollen, sondern seine aggressiven Handlungen mäßigen können oder anschließend bedauern und reparieren wollen. Mit der Fähigkeit zur Besorgnis wäre somit ein leibseelisches Bollwerk gegen ungebremste Gewalt und Sadismus errichtet. Dabei müssen wir davon ausgehen, dass dies nicht in jeder Frühentwicklung gelingt und dass wir auf Kinder, Jugendliche und Erwachsene stoßen können, denen die Fähigkeit zur Besorgnis abgeht.
Sicher spielen für die Bezähmung der Aggression auch andere emotionale Grundlagen eine Rolle, die sich weit unspektakulärer ausnehmen. Nach Hoffman (1984, 1991, 2000) vollzieht sich die Entwicklung der moralischen Gefühle in zwei Etappen: In der ersten vollziehen Kinder nach, dass Handlungen negative Auswirkungen auf andere haben und diese traurig sind oder enttäuscht oder Schmerzen haben, weil man sie geschlagen oder ihnen ein Spielzeug abgenommen hat. Die Kinder entwickeln also zunächst eine nachträglich einsetzende empathische Kompetenz, zumindest, wenn sie danach gefragt werden. In der zweiten Phase entdecken Kinder, dass ihr Verhalten moralische Beurteilungen anderer nach sich zieht, und erleben, dass diese Fremdurteile Folgen für ihre Selbstbewertung haben. Sie können sich nicht länger gut fühlen, wenn andere davon überzeugt sind, dass sie etwas Unrechtes getan haben. Auch wenn diese Gefühle im Eifer des Gefechts von anderen, stärkeren Gefühlen dominiert werden können, so formieren sie doch immer stärker eine eigene emotionale Wirklichkeit, die zur Ausprägung eines moralischen Selbst führt. In diesem verbinden sich das Vermögen zur sozialen Empathie (Segal 2011) mit dem zur Wahrnehmung von Fremdbeurteilung und ihre Anwendung auf die Bewertung des eigenen Verhaltens. Dieser Trias gelingt es, das eigene Handeln immer stärker zu kontrollieren; sei es prospektiv bezogen auf die Handlungsplanung oder die Antizipation von Handlungsfolgen, sei es retrospektiv hinsichtlich der Reflexion bereits vollzogener Handlungen (Nunne-Winkler & Sodan 1988). Bei dem Konzept des Moralischen Selbst handelt es sich demnach um eine wichtige alternative Theorie zur Entstehung des Gewissens.
Zu (2) und (3): Alle Kinder werden immer wieder von heftigen Erregungszuständen (arousal) ergriffen und erfahren über die Reaktionen ihrer Bezugspersonen, wie diese abklingen und Entspannung zustande kommen kann. Konkret vollzieht sich das mit Hilfe beruhigender Worte, rhythmischer Bewegungen wie Schaukeln, Streicheln oder Pressen von Körperteilen oder mit dem Aufsuchen anderer, ablenkender Aktivitäten oder Orte (Dornes 2000, 45). Das Kind erlebt auf diese Weise leibhaft, welche Formen der Fremdberuhigung ihm guttun, fordert deren Wiederholung ein, wenn es ihrer bedarf, und kann diese irgendwann auch selbst auf sich anwenden. Das entwickelt sich in kleinen und kleinsten Schritten und einem stetigen Pendeln zwischen Selbstberuhigungsversuchen und der Suche nach Beruhigung durch vertraute Andere. Dafür ist das Kind auf eine halbwegs sichere Bindung zu seinen primären Bezugspersonen angewiesen (Großmann u. a. 1989). Das Gleiche gilt auch für die Regulation anderer Stimmungen wie Traurigkeit, Wut oder ungestüme Lebensfreude. Auch hier sind es zunächst Erwachsene, die solche Gefühle von Kindern wahrnehmen, als berechtigt anerkennen, sie benennen und adäquat darauf antworten, d. h. sich bei Freude mit dem Kind freuen und bei Ärger, Kummer und Schmerz diesen zunächst teilen, noch bevor sie trösten. Es ist klar, dass Kinder anderen nur dann empathisch begegnen können, wenn sie selbst ausreichend Empathie erfahren haben (Körner 1992, Kohut 1979 und 1989; Segal 2011, Stern 1992, 34 f.). Durch die Bildung von Sprachmustern für Emotionen und ihre Benennung entsteht ein erster Abstand zu ihnen, der irgendwann in die Fähigkeit der Mentalisierung mündet (Fonagy, Gergely & Target 2002, Dornes 2000, 58). Damit ist ein Zustand gemeint, in dem ich noch in meinem Gefühl bin, aber zugleich schon darüber sprechen kann und dadurch weiter Abstand dazu gewinne. Das Gefühl überschwemmt mich nicht mehr, aber ist noch präsent. Gerade diese mittlere Distanz scheint die beste, um über das, was passiert ist, so zu sprechen, dass man belastendes Geschehen aufklären und etwas daraus lernen kann (Fonagy, Gergely & Target 2002, 163 ff.; Redl & Wineman 1972, siehe hier insbesondere die Methode des »Life Space Interview«).
Empathie auf Seiten der Eltern bedeutet nicht, dass man vor lauter Mitgefühl die eigenen Ansprüche aufgibt oder Regeln außer Kraft setzt, sondern dem Kind spiegelt, dass und warum es ihm schwer fällt, sich z. B. aus einem Spiel zu lösen und zum Essen zu kommen. Dadurch lernt das Kind einerseits, dass seine Gefühle geachtet werden, dass man sich aber auch daraus lösen kann und muss. Nicht immer, nicht immer sofort, aber immer wieder.
Auch Impulskontrolle stellt das Hineinnehmen einer Bewegung ins eigene Selbst dar, die zunächst von außen kommt. Eltern halten ihr Kind fest, wenn dieses mit seinem Handeln in Gefahr zu kommen droht. Den Schaden, den sie dadurch verhindern, kann das Kind noch nicht überblicken. Dennoch etablieren sich die Eltern dadurch zu mächtigen Wesen, mit deren Aktionen man rechnen sollte. Schon Kinder mit einem Jahr schauen deswegen häufig zu ihren Eltern, wenn sie etwas tun wollen, was verboten ist, oder von dem sie nicht wissen, ob sie es dürfen. Sie haben gelernt. mit der Aufmerksamkeit ihrer Eltern zu rechnen, und wollen zugleich verhindern, dass diese plötzlich und ohne dass das Kind damit rechnet, in sein Handeln eingreifen. Das scheint das Kind zunächst zu erschrecken und später auch zu kränken. Die zweite Bewegung, die von außen kommt, ist das Verzögern einer Aktion des Kindes: Es darf die Handlung ausführen, nur muss man noch rasch z. B. etwas Verletzungsträchtiges aus dem Weg räumen, damit es ungefährdet krabbeln oder laufen kann. Hier werden Bedürfnisaufschubmuster trainiert, bei denen das Kind umso williger mitmachen wird, je häufiger es erkennt, dass sich Abwarten und Kooperation lohnen, weil es gerade damit zu seinem Recht kommt. Die dritte Form liegt in der Verbindung mit Sprache. Die Eltern rufen »Stopp« und unterbrechen eine unerwünschte Aktion, kommentieren sie mit »Nein«, geben dem Kind aber anschließend die Möglichkeit, damit fortzufahren oder ihr Nein zu beachten. Kann das Kind sich selbst kontrollieren, ist es gut, falls nicht, folgt ein erneutes Nein oder eine Form der Abwendung, die dem Kind signalisiert, dass es sich besser selbst kontrolliert hätte – was es das nächste Mal vielleicht tut oder auch nicht. Viele der hier geschilderten Eingriffe werden von den Kindern zunächst als unerwünschte Störungen erlebt. Älteren Kindern gegenüber sollten sie zunehmend so begründet werden, dass sie diesen einleuchten. Zunächst reicht aber, dass die Eltern davon überzeugt sind, dass die Unterbrechung richtig ist, und sie diese auch ohne Zustimmung des Kindes durchsetzen. Nur damit entwickelt sich das innere Bild eines klaren Nein und einer verhindernden Instanz, die ins Kind einwandern und aus deren Position es zu sich selbst »nein« sagen kann.
Zu (4) und (5): Schritte bei der Überwindung des egozentrischen Weltbildes (Piaget), Entwicklungen von Ordnungen der Moral (Kohlberg) und die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme (Kohlberg und Selman). Ein Schema soll der ersten Orientierung dienen, es wird auf der folgenden Seite erläutert.
Die Stufe 1 des so genannten präkonventionellen moralischen Urteils wird wie bei Piaget als egozentrisch gekennzeichnet, da die Interessen anderer mit den eigenen gleichsetzt werden oder das Kind die Unterschiede von eigenen und fremden Handlungsplänen zwar erkennt, aber den eigenen Priorität gibt. Moralische Urteile gelten als selbstevident und sind in der Setzung von Autoritäten begründet.
Autorität und moralischer Wert werden kategorial und physikalistisch bestimmt (zum Beispiel ist der Vater deshalb der »Boss«, weil er stärker ist). Negative Konsequenzen im Falle einer Regelverletzung werden nicht nur als unvermeidliche Folge einer Verletzung von Regeln und Geboten betrachtet, sondern die Tatsache der Bestrafung durch Autoritäten weist diese Handlung als moralisch falsch aus.
Moralische StufeOrientierungPerspektive
Die Stufe 2 des präkonventionellen moralischen Urteils beruht auf der Fähigkeit zur Koordination konkreter individueller Perspektiven (zwischen 4 und 8 Jahren). Dazu muss der Egozentrismus bereits ein Stück weit aufgebrochen worden sein. Der moralische Realismus der Stufe 1 wird durch einen moralischen Relativismus abgelöst. Was moralisch richtig ist, wird aus der Situation sowie der Perspektive des jeweiligen Handelnden bestimmt. Interessen anderer, die den eigenen entgegenstehen, können wahrgenommen werden. Man versucht Regelungen für solche Konflikte zu entwickeln und bietet z. B. Kompensationen an. Die Person verfolgt pragmatisch-instrumentelle Motive: die möglichst maximale Befriedigung eigener Interessen und/oder die Vermeidung negativer Folgen für einen selbst. Es gilt die einfache Handlungsregel des tit for tat: »Wie du mir, so ich dir.«
Auf Stufe 3 des so genannten konventionellen moralischen Urteils werden die individuellen Perspektiven in eine Beobachterperspektive der dritten Person integriert (ca. 7–12 Jahre). Dies ermöglicht zugleich eine Perspektive der Beziehung, in der die individuellen Interessen den gemeinsamen Interessen der Gruppe untergeordnet werden. Der Egozentrismus ist überwunden, auch wenn er in bestimmten Momenten immer wieder die Oberhand gewinnt. Die sozialen Beziehungen beruhen auf der gegenseitigen Anerkennung von Normen der Reziprozität. Das drückt sich in der Regel aus: »Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem andern zu.« Als emotionale Grundlagen für diese Verabredung auf Gegenseitigkeit fungieren Vertrauen und Dankbarkeit bzw. die Anerkennung der Leistung des Anderen als Leistung für mich. In einem Gruppenzusammenhang entwickelt sich Loyalität und wird als Verpflichtung erlebt. Die Geltung dieser Normen resultiert aus einer Perspektive, die sowohl die eigenen wie auch die Interessen der Anderen im Blick hat (zu Kohlberg: Kapitel 17 bei Göppel 2019).
Zu (6): Spielen-Können stellt in zweierlei Hinsicht eine nicht zu unterschätzende und wahrscheinlich nicht ersetzbare Voraussetzung für moralisches Verhalten dar. Zum einen lassen sich ins Spiel gefahrlos aggressive, sadistische oder verführerische Impulse einbringen, weil sie nicht tatsächlich ausgeführt, sondern nur angedeutet werden (Bittner 1983; Schwabe 2019, 210 ff.). Im Spiel jemanden totzuschießen oder ihm einen Kinnhaken zu verpassen oder – wie bei Mädchen beobachtet – einem untreuen Ehemann Nägel und Scherben ins Bett zu legen oder das eigene Kind in den Keller zu sperren, schadet niemandem, der sich auf das Spiel als einem der Wirklichkeit enthobenen Rahmen eingelassen hat. Winnicott hat für die Welt des Spiels den Ausdruck intermediär geprägt und meint damit einen eigenen Bereich zwischen Realität und Traum (Winnicott 1987, 49 ff.). Die dort eingebrachten Impulse fühlen sich echt an und werden doch fiktionalisiert, indem sie mit Gesten angedeutet (das Hineinstreuen der Glasscherben) oder kontrolliert ausgeführt werden (z. B. der Schlag stoppt weit vor dem Körper des mitspielenden Kindes). So werden für diese Impulse, die im Alltag nicht mehr toleriert werden, Orte gefunden, wo sie einerseits ausgedrückt werden dürfen und andererseits beherrscht werden. Dass sie zuverlässig einen Platz im Spiel haben, hilft dem Kind dabei, in der Realität auf sie zu verzichten und sich dort strengeren Maßstäben zu unterwerfen.
Freilich kann die mit diesen Impulsen verbundene Erregung ins Spiel einbrechen (die Kontrolle gelingt nicht) und es verderben, weil es damit entgleist. Das passiert immer wieder, wobei Kinder lernen, damit umzugehen, und sich diesbezüglich genau beobachten und kontrollieren. Insofern handelt es sich beim Spielen um einen Selbstbildungsprozess par excellence, der die Kinder weiterbringt, meist ohne dass Erwachsene eingreifen müssten. Freilich wird das Mitspielen von Erwachsenen diese Prozesse mit befördern.
Genauso wichtig für die moralische Entwicklung wie das Phantasiespiel ist das Regelspiel wie Mensch-Ärgere-Dich-Nicht, Mau-Mau oder auch Fangen und Fußballspielen. Alle diese Spiele operieren mit vorgegebenen Regeln, denen sich das Kind unterwerfen muss, wenn es »richtig« spielen will (Krappmann 1983). Schon bei sechsjährigen Kindern kontrollieren beide Spieler die Einhaltung der Regeln und geben sich darüber Rückmeldungen: »Schummeln gilt nicht!«. In den Rahmen von Spielen mit Wettkampfcharakter kann man (Größen-)Phantasien vom Besiegen eines Gegners einbringen, muss aber damit zurechtkommen, dass das Gegenüber ähnliche Phantasien hegt. Das Spiel eröffnet einen Raum und organisiert einen geordneten Prozess, in dem Sieg und Niederlagen erlebt und zugleich begrenzt bleiben (G. Bateson, ebd. 246 ff.). Dazu müssen die Gewinnchancen und damit die für das Spiel erforderlichen Fähigkeiten halbwegs gleich verteilt sein (wenn die Chancen zu unterschiedlich verteilt sind, macht das Spiel keinen Spaß). Im besten Fall erlebt man, dass es eine nächste Runde gibt und sich Sieg und Niederlage abwechseln. Auch hier kann die mit dem Spiel verbundene Erregung ins Spiel einbrechen, sodass man versucht, die Regeln zu verändern oder zu unterlaufen, wenn man zu verlieren droht. Nirgendwo wird so oft diskutiert und gestritten wie bei Regelspielen, da diese den Rahmen, aber nicht alle Eventualitäten festlegen (Krappmann, ebd. 116 f.). Manchmal entstehen daraus neue Abmachungen, die sich noch echter anfühlen, weil man selbst bei ihrer Aushandlung mitgewirkt hat. Manchmal eskaliert der Streit aber auch und läuft ein Spielpartner anschließend wütend weg und erklärt den Sieg des Anderen für ungerecht. Dennoch machen die meisten Kinder immer wieder neue Anläufe mit Spielen nach Regeln, so als hätten sie verstanden, dass sie weder um diese Form noch um das Aushalten der damit verbundenen Frustrationen herumkommen, sondern daran wachsen.
So weit ein Überblick über das, was Kinder ins Jugendalter mitbringen sollten, um den Erwartungen von Schule und Freunden an regelkonformes Verhalten und die Einhaltung von Grenzen halbwegs gerecht werden zu können. Diese Ansprüche lassen sich nicht mit Hilfe von ein, zwei oder drei Kompetenzen erfüllen, schon gar nicht mit isolierten Fähigkeiten wie dem moralischen Räsonieren oder einem prompten Gehorsam. Das Entscheidende ist, dass von außen gesetzte Regeln zu inneren Strukturen und Grenzen werden.
Dazu bedarf es eines ganzen Netzwerks interagierender Fähigkeiten auf unterschiedlichen Ebenen (emotional, kognitiv, sozial) und in unterschiedlichen Modi der Existenz (Erleben, Reflektieren, Handeln). Anders als aus einem Netzwerk – oder aus einem individuellen Dickicht –, aus persönlichen Befähigungen ist das, was Kinder und Jugendliche brauchen, um sich sozial verträglich zu bewegen und Konflikte auf faire Weise auszutragen, nicht zu bekommen.
Es ist klar, dass es diesbezüglich eine erhebliche Varianz zwischen Kindern und Jugendlichen einer Klasse oder einer Konfirmandengruppe etc. geben wird. Kinder sind in diesem Alter hinsichtlich ihrer kognitiven und emotionalen Kompetenzen unterschiedlich weit entwickelt. Es ist gut möglich, dass manche sprachlich genau anzugeben wissen, was von ihnen erwartet wird, und das auch selbst richtig finden. Aber sie sind noch nicht in der Lage, ihr Verhalten entsprechend zu steuern. Andere verhalten sich zwar diszipliniert, lassen es aber an Interesse an Anderen und an Empathie fehlen und können sich nicht gut mit anderen abstimmen. Wieder andere haben keine Probleme damit, sich in offizielle Ordnungen einzufügen, verhalten sich aber unsozial, wenn sie sich unbeobachtet wähnen.
Neben individuellen Variationen, die mit angeborenem Temperament und unterschiedlichem Entwicklungstempo zu tun haben, muss man damit rechnen, dass die skizzierten Voraussetzungen nicht überall gleichermaßen gefördert bzw. erreicht wurden und sich einzelne Kompetenzen häufig nicht so verbunden haben, wie es nötig wäre, um sich gegenseitig unterstützen zu können. Ähnlich wie bei der sprachlichen Entwicklung und dem Zugang zu Bildung sind die familiären Bedingungen dafür nicht immer günstig. Die Lernprozesse, die in KiTa und Schule stattfinden, können hier einiges kompensieren, aber nur eingeschränkt Grundlagen dafür schaffen. »Wissenschaftliche Studien zeigen übereinstimmend eine Prävalenz psychischer Störungen bei Kindern in Deutschland zwischen 15 und 20 % in Verbindung mit einer deutlichen Risikoverschärfung von Kindern und Jugendlichen aus niedrigen Statusgruppen« (Opp & Otto, 2016, 186). Nach einer Untersuchung von Groos & Jehles weisen dort etwa 30 % der Kinder mit zehn Jahren deutliche Entwicklungsverzögerungen auf (Groos & Jehles 2015; Alt & Beier 2012), die, wenn sie erkannt werden und förderlich mit ihnen umgegangen wird, durchaus noch aufgeholt werden können (Dornes 2012, 400). Für emotionale Grundlagen, insbesondere die Frage von Bindungsformen, können sich aber Entwicklungsfenster bereits geschlossen haben (Großmann u. a. 1989). Solche Entwicklungen können, wenn überhaupt, nur noch unter therapeutischen Bedingungen nachgeholt werden. Dabei können sie in sozialpädagogisch ausgerichteten Erziehungshilfen oft besser hergestellt und genutzt werden als in klassischen Therapieformen, weil sich Jugendliche oft schlicht weigern, dort hinzugehen, oder nicht über die inneren Strukturen verfügen, regelmäßige Termine pünktlich wahrzunehmen (Baer 2019, Schmid 2004).