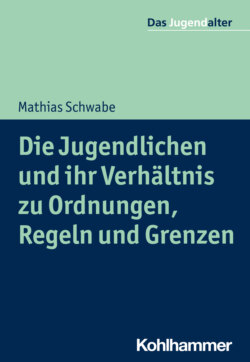Читать книгу Die Jugendlichen und ihr Verhältnis zu Ordnungen, Regeln und Grenzen - Mathias Schwabe - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.3.1 Autonomie trotz Heteronomie: Jugendliche als Tänzer*innen zwischen Ordnungssystemen und Hybrid-Moral(en)
ОглавлениеKehren wir zu Serkan zurück, der sich darüber beschwert, dass er in der Schule weiter wie ein Kind behandelt wird, und auf der anderen Seite mit Stolz davon berichtet, was er im Gemüseladen seines Onkels leistet. Warum stellt sich dieser Ort trotz seiner zahlreichen Anforderungen für ihn so attraktiv dar? Auf der Habenseite steht die stundenweise Integration als Arbeiter in einem kommerziellen Betrieb und damit sein Einstieg in die Erwachsenenwelt; die damit einhergehende Anerkennung, die er dafür von Seiten des Onkels und seiner Eltern erfährt; eine für ihn attraktive Bezahlung und Erfahrungen einer positiven Identität mit Zukunftsperspektive. Auf der Anspruchsseite steht dem gegenüber, dass Serkan auf einen Gutteil seiner Freizeit verzichten muss, nicht rauchen kann und auch sonst den »Arsch (zusammen)kneifen« muss, weil er in Gestik, Mimik und Wortwahl stets höflich aufzutreten hat. Zudem muss er noch einen Teil des Geldes zu Hause abgeben, weil man dort knapp bei Kasse ist, oder bekommt es manchmal gar nicht erst ausbezahlt, weil Vater und Onkel seine Arbeitsleistung in einer Art bargeldlose Tauschökonomie einbeziehen.
Handelt Serkan selbstbestimmt? Verfolgt er ein autonomes Handlungsprojekt? Ja und nein. Manche der Regeln, die im Laden gelten, sind eindeutig fremdbestimmt und sein Handeln ist extrinsisch motiviert. Das Nicht-Rauchen bewältigt er z. B. im Modus einer externalen Regulation, hinter der die Angst vor einem möglichen Rauswurf steht. Serkan raucht dann eben vor und nach der Zeit im Laden.
Mit Blick auf das Wechselgeld oder das »Arsch kneifen« bewegt sich Serkan im Modus einer introjizierten Regulation. Er hat die Werte Genauigkeit und Höflichkeit verinnerlicht. Er legt sie auch an den Tag, wenn sein Onkel sich nicht im Geschäft aufhält, was gerade gegen Abend häufig vorkommt. Er ist stolz darauf, die Kasse bedienen zu dürfen, zugleich setzt ihn das auch unter Druck. Einmal hat er nachts nicht geschlafen, weil er sich unsicher war, ob er auf 50 statt auf 20 Euro herausgegeben hat. Manchmal nennt er seinen Onkel aber auch einen Geizkragen und denkt, dass es auf ein oder zwei Euro nicht ankommt.
Bezogen auf die Höflichkeit im Kundenkontakt könnte man von einer Mischung zwischen introjizierter und identifizierter Handlungsregulation sprechen. Einerseits weiß Serkan, dass es viele Gemüseläden im Bezirk gibt und man Kunden gewinnen oder halten muss. Sein Onkel macht ihm immer wieder vor, wie es geht und wie man mit den richtigen Worten und Gesten mehr verkaufen kann, als die Leute eigentlich wollten. Das imponiert Serkan und so macht es ihm häufig Freude, ähnlich gewandt und charmant aufzutreten und die Kunden um den Finger zu wickeln. In anderen Situationen kostet es ihn aber durchaus Mühe, freundlich zu bleiben, und er beschimpft die Kunden, wenn sie gegangen sind, leise für sich oder mit den anderen Angestellten.
Was das Geld betrifft, das er teilweise abgeben muss bzw. das in andere Transaktionen einfließt, scheint Serkan hin- und hergerissen. Einerseits identifiziert er sich durchaus mit der Rolle als Miternährer der Familie. Sein großer Bruder leistet das in noch viel größerem Umfang. Serkan wäre bereit, regelmäßig die Hälfte des Geldes abzugeben. Die Unklarheit seiner wöchentlichen Einnahmen erlebt er als fremdbestimmt. Mal geht er am Samstag mit 20 Euro ins Wochenende, andere Male nur mit 5 Euro oder einem großen Gemüsekorb für die Familie. Gleichzeitig hat er Angst vor den Reaktionen seines Vaters, wenn er die gängige Bezahlungspraxis in Frage stellen würde. Hier wird er – ähnlich wie in der Schule – wie ein Kind behandelt, über das die Erwachsenen bestimmen.
Wie lautet nun das Fazit? Autonomes Handeln: Ja oder nein? In Teilbereichen sicher nein. Aber bezogen auf die Motivation, sich diesen Ort zu erhalten, wohl ja.
Denn alles in allem ist das Arbeiten im Laden »mein Ding«, wie er sagt. Ein autonomes Projekt, auch wenn es von mehreren Strängen unterschiedlicher Fremdbestimmungsgrade durchzogen wird. Es verschafft ihm Status und Prestige bei allen, die er kennt. Nur wenige Peers, die mehr Wert auf Freizeit legen, bedauern ihn, was ihn aber nicht zu verunsichern scheint. Man kann vermuten, dass das Leitbild eines höflichen, charmanten und dabei auf seinen Vorteil bedachten Verkäufers in sein Kernselbst eingewandert ist und ihn stolz macht, wenn er diesbezüglich in eine Art »Flow« gerät (Csikszentmihalyi 2008). So will er sein oder werden und das kann er im Geschäft seines Onkels. Dieses Leitbild strahlt eine große Bindungskraft aus, obwohl er daneben noch eine weitere Zukunftsperspektive verfolgt.
Erinnern wir uns, wie heftig sich Serkan über die Schule beschwert hat: Was man dort alles nicht darf. Wie stark er die beiden Welten, Schule und Laden, kontrastiert hat. Aber auf die Frage des Interviewers, wann er sie denn verlässt, um ganz bei seinem Onkel zu arbeiten, führt er aus:
»Nee, nee, nee (schüttelt den Kopf, hebt die Hände). Stopp mal! Schule muss sein (macht eine Grimasse) ich brauch den Abschluss … mindestens Quali (d. h. qualifizierten Hauptschulabschluss) oder, falls es irgendwie geht, den MSA (mittlerer Schulabschluss). So isses, Mann, (lacht) ich will nämlich ins Krankenhaus (nickt mehrfach schnell hintereinander), ja, das können Sie ruhig wissen. Weil, ich will so ein Pfleger mit weißem Kittel und so was machen, mit Verbänden und Spritzen und allem so. Am liebsten so auf Intensiv, mit den ganzen Maschinen und dem technischen Kram. Das wär mein Traum. Ich weiß (nickt mehrfach), hört sich komisch an, und das will auch keiner, keiner, wo ich kenne. Aber ich wollte das schon als Kind (nickt, Pause). Mit so klein (gibt die Höhe für einen Fünf-, Sechsjährigen an). Und Arzt (macht eine Grimasse), so blöd bin ich ja nicht, das werde ich nie. Keine Chance! Obwohl meine Mama das immer gesagt hat, dass ich das kann. Aber die hat halt keine Ahnung von Schule und so. Aber Pfleger im Urban (Krankenhaus in Kreuzberg), das will ich und das, das schaff ich. Und deshalb, sag ich mir ›Serkan, Arsch kneifen‹ auch in der Schule (lacht). (Na)türlich hauen wir oft mal ab. Eine Stunde oder zwei … Ich rauch auch, so oft es geht, ich hab mein Handy heimlich dabei und wir lassen es krachen, wo’s geht (nickt, Pause). Aber. A-a-aber (gedehnt mit hochgezogenen Augenbrauen) ich mach meine Hausaufgaben, ja-a-a (lacht wie über einen Scherz), ehrlich! Ich bin nicht der Einzige, aber fast unter den Jungen, fast. Die Mädchen zähl ich da jetzt nicht. Die (anderen Jungens) lachen mich sogar aus deswegen. Ist mir egal. Ich mach’s, ich versuch’s jedenfalls, und wenn ich nur die Hälfte hab oder noch weniger und manchmal nur so Krickelkrackel fünf Minuten vorher, damit sie (die Lehrer*innen M.S.) was sehen (nickt, seufzt). Aber ich lege mich halt nicht mit denen an, wie manche von uns meinen, dass sie müssen. So von wegen große Fresse und Schläge androhen den Lehrern … Das muss ich nicht! Ich will mein Abschluss und wenn ich den hab, wenn ich den hab, dann brenn ich die Schule ab! Nein Spaß … (schüttelt den Kopf, lacht).«
Schule stellt für Serkan eine weitgehend fremdbestimmte Welt dar. Er handelt dort über weite Strecken im Modus externaler Regulierung und passt sich so weit an, wie man ihn kontrollieren kann. Wo er kann, trickst er das System aus und nimmt sich seine Auszeiten bzw. das, was er als seine Rechte ansieht (rauchen, eine Stunde schwänzen, Handy etc.). An anderen Stellen scheint er sich Regeln zu eigen gemacht zu haben. So hat er sehr wohl verstanden, dass der Verzicht auf Gewalt ganz oben auf der Erwartungsliste seiner Lehrer*innen steht und es ihm Vorteile verschafft, wenn er sich diesbezüglich berechenbar und verlässlich zeigt. Ähnlich strategisch bedient er das System, indem er Hausaufgaben macht. Er kalkuliert, dass die Hälfte des Aufgegebenen ausreicht, um die Lehrer*innen zufriedenzustellen, und dass selbst »Krickelkrackel« für diese ein willkommenes und ganz und gar nicht selbstverständliches Engagement darstellt, weil die meisten männlichen Jugendlichen gar nichts mitbringen. Dabei handelt es sich um dieselben Jungen, mit denen er abhaut und rauchen geht und nimmt sogar in Kauf, dass diese ihn auslachen. Er glaubt aber, dass die Lehrer*innen seine Geste honorieren und er damit seinem Ziel, dem Schulabschluss näher kommt (wahrscheinlich auch mit Hilfe einer gnädigen Versetzung, falls diese einmal wackelig sein sollte). All das kostet ihn viel Mühe, auch in der Schule muss er »Arsch kneifen«. Aber das Ganze lohnt sich für ihn, weil er ein Ziel hat: den Abschluss und das Erlernen des Berufs eines Pflegers. Den scheint er sich als den kleinen Bruder des Arztes vorzustellen. Das mag naiv sein, aber es beinhaltet auch einen Gutteil Realismus, denn ein Studium der Medizin ist wirklich nicht drin bei ihm. Die »Weiße-Kittel«-Idee« scheint noch inniger zu seinem Kernselbst zu gehören als der Typ des levantinischen Händlers, der ihn für die Arbeit im Geschäft motiviert.
Mischformen, wie sie Serkan schildert, kommen bei Deci & Ryan nicht vor. Weder, dass junge Menschen in einer Stufe ganz unterschiedliche Motivationsmodi nebeneinander praktizieren, noch dass massive Fremdbestimmungsanteile in einem Handlungsfeld trotzdem erlauben, dass dort ein autonomes Handlungsprojekt stattfindet und über längere Zeit motiviert verfolgt wird. Angesichts der Möglichkeit, neue Fähigkeiten auszuprobieren und zu entwickeln, und bezogen auf die Anerkennung als verantwortlich Handelnder und Beinahe-Erwachsener steht der Laden bei Serkan viel höher im Kurs als die Schule. Deswegen ist es auch kein Wunder, dass er die dort geltenden Ge- und Verbote beachten will und kann. Gleichzeitig ist er mit seinem Zukunftsbild als Krankenpfleger so stark identifiziert, dass er für den in Aussicht gestellten Schulabschluss auch dort die geforderten Anpassungsleistungen bedienen kann und – am wichtigsten – dies als seine autonome Entscheidung verbucht. Die Anforderungen an den beiden Orten sind zum Teil ganz unterschiedliche. Die Menschen, die sie vertreten, stammen aus unterschiedlichen Kulturen und vertreten unterschiedliche Werte. Aber mit der Formel »Arsch kneifen« hat Serkan eine Handlungsorientierung gefunden, mit der er hier wie dort über die Runden kommt. Zugleich wirkt er durchaus zufrieden mit dem Ausmaß der Freiheiten, die er sich nimmt, und lässt es immer wieder mal »ordentlich krachen«.
Entwicklungspsychologisch betrachtet sind diese Leistungen nur möglich, wenn man annimmt, dass Serkan neben einer gut entwickelten Wahrnehmung für die Erfordernisse fremder Ordnungssysteme über ein hohes Ausmaß an Impulskontrolle verfügt, das ihm ermöglicht, im Hier und Jetzt so zu agieren, dass er seine Zukunftspläne damit nicht gefährdet. Zudem zeichnet ihn offensichtlich eine lebendige Phantasie aus, in der sich Rollen wie die des Verkäufers oder Pflegers mit unbewussten, vermutlich aus der Kindheit stammenden Identifikationen aufladen, sodass sie für ihn zu einer Berufung werden. Gleichzeitig sind die Anpassungsleistungen gepaart mit einer großen Treue zu seinen eigenen (triebhaften) Wünschen. Wo ihm das möglich erscheint, geht er diesen nach und schafft sich auch mit Hilfe von Regelbrüchen und Grenzüberschreitungen die dazu erforderlichen Freiräume. Mit Krappmann kann man hier die Bedeutung von Ambiguitätstoleranz sehen, da es Serkan zu gelingen scheint, sich als beides zu sehen, als Regelbefolger und Regelbrecher (Krappmann 2000, 45 f.). Mit Bittner könnte man formulieren, dass Serkan nicht nur »hinreichend gut« sein will, sondern auch »hinreichend schlecht« sein kann (Bittner ebd. 31). Erst damit gelingt ihm eine Balance zwischen dem Bedienen von fremden Erwartungen und dem Ausleben von Eigensinn. Eigensinn meint hier mit Baer & Baer das Sich-Besinnen auf das, was man selbst braucht, damit es einem gut geht, durchaus auch im Bereich körperlicher und sinnlicher Bedürfnisse (wie bei Serkan das Rauchen oder die Stunden, in denen er die Schule schwänzt etc.) (Baer & Baer 2018).
Und das ist das Besondere: Diese Ausbalancierung gelingt ihm an drei oder gar vier sozialen Orten: in der Schule, im Geschäft seines Onkels und in der Familie, wobei in der letzteren am wenigsten Platz für Eigensinn zu sein scheint und die Verpflichtungen überwiegen; offensichtlich ist ihm Verbundenheit mit den Mitgliedern seiner Familie aber so wichtig, dass er dafür einiges auf sich nimmt und erduldet (Angst, so schien mir, spielt bei ihm dagegen keine Rolle). Eine andere Ausbalancierung gelingt ihm mit seinen Peers: Einerseits lässt er es als Kumpel mit ihnen »krachen«, andererseits grenzt er sich von deren Machogebaren und Gewaltandrohungen gegenüber den Lehrer*innen ab und macht, anders als die meisten anderen, Hausaufgaben.
Damit zeigt sich Serkan in meinen Augen als Tänzer zwischen Wertewelten, der eine Hybridmoral (Bahbah nach Müller 2010) entwickelt hat, d. h. mehrere neben- und miteinander entstandene und aktuell mal enger, mal loser miteinander verbundene Moralsysteme in eine Art Metastruktur integriert hat. So kann er mehrere Handlungsweisen nebeneinander auf unterschiedlichen Stufen der Moral- und der Autonomieentwicklung praktizieren, ohne dabei eine Identitätsdiffusion zu erleiden (siehe dazu auch die Geschichte von Deborah Kap. 5.3). Wie schafft er das? Er scheint sich durchgängig als ein steuerndes Zentrum zu begreifen. Je nachdem, wie er den jeweiligen Kontext in Bezug auf dessen emotionale Bedeutung für sich selbst, in Bezug auf seine Relevanz für seine Zukunft, aber auch in Bezug auf Machtverhältnisse und Spielräume für abweichendes Verhalten einschätzt, reguliert er sein Verhalten auf dieser oder jener Motivationsstufe und zeigt demnach eine beträchtliche Flexibilität, die von Gehorsam über Regelverletzungen bis zu selbst gewollter Verantwortungsübernahme reicht.