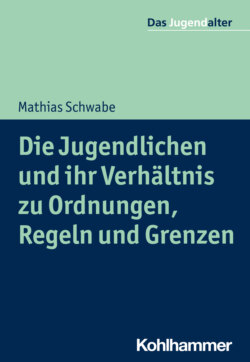Читать книгу Die Jugendlichen und ihr Verhältnis zu Ordnungen, Regeln und Grenzen - Mathias Schwabe - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1 Entwicklungsgrundlagen und -herausforderungen
ОглавлениеBeobachtet man Jugendliche beim Übergang von der Kindheit ins Erwachsenenalter, stellt sich die Frage, in welchen Bereichen sie Umbrüche erleben und mit Neuorientierungen beschäftigt sind und in welchen anderen sie bisher Entwickeltes weiter nutzen können oder lediglich ausbauen müssen. So ist z. B. der Bereich der Sexualität einer, bei dem mit dem Einsetzen der Pubertät eher Um- und Aufbrüche zu erwarten sind (vgl. Wendt 2019). In sexueller Hinsicht wird vieles erstmalig erlebt und ausprobiert und drängt darauf, alleine oder im Austausch mit anderen verarbeitet zu werden ( Kap. 4.1). Dagegen stellt die Orientierung des eigenen Verhaltens an Normen und Regeln und die Beachtung von Grenzen Anderer einen Bereich dar, in dem im Verlauf der Kindheit bereits vieles grundgelegt wurde. Daran können junge Menschen und Pädagog*innen unmittelbar anknüpfen. Es kann sich im Übergang zur Adoleszenz allerdings auch zeigen, dass in der Kindheit diesbezüglich einiges versäumt wurde und nun, angesichts gestiegener Erwartungen an Selbstregulierung, fehlt, sodass es über kurz oder lang zu Konflikten mit Vertretern der Gesellschaft kommen muss, auch weil mit 14 Jahren die Strafmündigkeit einsetzt.
Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Denn bei aller Gewöhnung an den Anspruch, dass Regeln und Grenzen zu beachten sind, kann es geradezu als Beweis für den Eintritt ins Jugendalter gelten, wenn Jugendliche auf Verhaltensvorschriften zunehmend widerständig reagieren und den Anspruch erheben, selbst bestimmen zu wollen, wie sie ihr Leben und ihre Beziehungen gestalten. Konkret bedeutet das z. B. für das Ordnungssystem Familie: Jugendliche wollen selbst entscheiden, ob bzw. wie oft sie ihr Zimmer aufräumen oder weiter am gemeinsamen Abendessen teilnehmen, wann sie ihre Hausaufgaben erledigen oder Samstagnacht von der Disko nach Hause kommen etc. Auch wenn damit über Jahre eingespielte Regeln angezweifelt werden und ihre Beachtung brüchig wird, bedeutet das in den meisten Fällen nicht, dass die Jugendlichen das Beziehungsgefüge Familie oder die Werte ihrer Eltern grundsätzlich in Frage stellen ( Kap. 3.2). Die »alte« Ordnung der Familie wird umgebaut, flexibilisiert und an neue Bedürfnisse angepasst, aber nicht aufgelöst. Dabei zeigt sich aber, dass Jugendliche sehr genaue Vorstellungen davon haben, was ihre eigenen Domänen sind oder sein sollten, und wo sie glauben, sich gegen Einmischungs- und Kontrollversuche zur Wehr setzen zu müssen, auch wenn das zu Konflikten führt.
Aber damit ist nur die eine Seite einer umfassenderen Autonomieentwicklung skizziert, der Strang, in dem es um Ablösung, Orientierung an den eigenen Bedürfnissen und mehr Freiräume geht. Denn parallel dazu lassen sich viele Jugendliche in durchaus verbindlicher und disziplinierter Weise auf neue Aktivitäten ein, die wir (mit Deci & Ryan 1993) Autonomieprojekte nennen wollen. Damit ist die Arbeit an und in einem Rahmen gemeint, in dem sich Jugendliche organisieren und in dem sie alleine oder gemeinsam etwas Eigenes, Neues gestalten: Musik Machen in einer Band; stundenlanges Üben auf dem Skateboard, um einen anspruchsvollen Sprung zu meistern; eine Umweltschutzinitiative auf die Beine stellen oder sich als Influencerin im Internet etablieren … oder … oder. Dies alles machen Jugendliche in erster Linie für sich selbst bzw. weil es ihnen unmittelbar Freude macht, entwickeln dabei aber beinahe zwangsläufig auch Kompetenzen und Wertehaltungen für ein zunehmend Eltern-unabhängiges, selbstständiges und zugleich auf Gemeinschaften bezogenes Leben. Die meisten Jugendlichen – so die These dieses Buches – begeben sich auf die Suche nach solchen für sie passenden Autonomieprojekten (vgl. hierzu den Begriff der Generativität bzw. des Neuen bei King 2004 oder des Offenen bei Kristeva 1987). Viele realisieren sie auch und sind dafür bereit, Verbindlichkeiten einzugehen und harte Arbeit auf sich zu nehmen.
Mit Blick auf die eingangs gestellte Frage können wir also formulieren: Bezogen auf das Verhältnis von Jugendlichen zu Regeln, Grenzen und Ordnungssystemen haben wir es mit beidem zu tun: mit Kontinuitäten und mit Auf- und Umbrüchen, die zu Neuorientierungen führen. Deswegen schildere ich in diesem Einführungskapitel zunächst, was Kinder in Bezug auf die Beachtung von Normen ins Jugendalter mitbringen (sollten) ( Kap. 1.1). Danach stelle ich den Ansatz von Deci & Ryan vor, der die Entwicklung von Autonomie und damit den Übergang von extrinsischen Formen der Beachtung von Regeln zu einer Identifikation mit diesen als zentrale Aufgabe des Jugendalters erachtet ( Kap. 1.2). Ich unterziehe ihn aber auch einer Kritik und schlage vor, Kontextorientierung und hybride Formen der Moral (Bhabha 2000) als ebenso wichtige Entwicklungsziele für das Jugendalter anzusetzen ( Kap. 1.3).