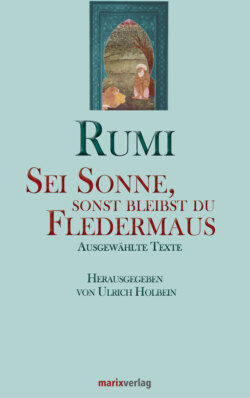Читать книгу Sei Sonne, sonst bleibst du Fledermaus - Maulana Dschelaluddin Rumi - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Seele des Gläubigen ist ein Stachelschwein
ОглавлениеRumi, Fariduddin ’Attar und Omar Khajjam
Rumi, wie alle Sufis trunken vom Becher liebesdurstig hochgeschaukelter Unvergänglichkeit, sah Diesseits und Jenseits Tür an Tür wohnen, schwelgte unbeirrbar und zutraulich in Evidenzen, sprach als Dichter vom Kuß auf den Todesbecher und von seliger Ankunft hinter dem Vorhang. So sehr Rumi sich die Augen von »Schielblick und Irrtum« wusch: In der Überfülle und Fülle all seiner Gedanken, der Formulierfiguren tiefsinntriefenden Parabelurwalds, tauchte lebenslang ein Gedanke nicht auf, vermutlich nie, oder wenn, dann nur kurz, der im Kopf Omar Khajjams und auch Fariduddin ’Attars Kopf durchaus auftauchte.
Omar Khajjam schrieb den Vierzeiler: »Wenn du das Weltgeheimnis lebend lüftest, / kannst du’s vielleicht in deinen Tod hinüberretten. / Doch was du nicht bei Lebzeit schaust, wie willst du’s greifen, / sobald dir dann die Sinne schwinden?«
Dieser Gedankengang wurde von ’Attar und Rumi bis hin zu allen heutigen Nahtoderfahrungsenthusiastinnen à la Prof. Elisabeth Kübler-Ross geflissentlich überlesen, aus Überlebensstrategie heraus. Er entzieht reihenweise den Mystikern aller Zeiten und Zonen die Basis ihrer Gewißheiten, zieht also den Stöpsel aus jeglicher Mystik und wird deshalb nur selten bis nie formuliert, außer viel später einmal von Eduard von Hartmann: »Es liegt hier der immer wiederkehrende Selbstwiderspruch aller Mystik vor, das Aufgehen des Seins und Bewußtseins in Gott mit einem fortbestehenden Sonderbewußtsein doch noch genießen zu wollen, und die Hoffnung auf dieses widerspruchsvolle Ziel ist es, welche als Abschlagszahlung der schließlichen absoluten Seligkeit auf den verschiedenen Annäherungsstufen dargeboten wird.«
Stattdessen hielten sich Fariduddin ’Attar und Rumi – und vorher Mansur al-Halladsch und alle anderen Sufis – mit Omar Khajjams einfallsreicher, fast atheistisch angehauchter Skepsis nicht weiter auf und klammerten sich ans lebenslang anvisierte, angepeilte, angeforderte, ersehnte, verdiente, herbeibeschworene Gotteslicht, das aber erst eine Viertelsekunde, nachdem das lebenslang im Weg stehende dunkle kleine Körperchen, samt Ich und lichtsüchtigem Bewußtsein, niedersinkt, erstmals so richtig glorios und gültig aufflammt. Aber einmal blitzte in einem trunkenen Vierzeiler Rumis doch eine Ahnung kurz auf, daß das verheißungsvolle Fana, das arabisch-persische Nirwana, orientalisches Entwerden, durchaus nicht als lustvolles Nichts aufwarten könnte, sondern auch einfach nur ausbleiben, mangels Vorhandenheit: »Wir sind zur Not auch ohne Wein betrunken, / schon früh vor Tag erleuchtet, und überfließend selbst spätabends; / man droht, es bliebe uns am Ende nichts. / Wir sind zu guter Letzt vergnügt mit weniger als nichts.«
In ultimativem Atheismus wäre Omar Khajjam näher dran an unaushaltbarer Wahrheit als Rumi, der dann bloß, wie alle weltweit gottestrunken verblendeten Geister, definitiv als heiliger Narr dastünde, als einer, der ausgerechnet im Leeren und Finsteren höchste Fülle und Licht erwartete, schluckweise schon vorher am Türspalt zu ernten glaubte, um alsdann, sobald die Tür richtig aufspringt, bzw. zerebrale Endorphinüberflutung abtropft, genau ab diesem wichtigsten Moment nicht mehr dabei zu sein. Doch indem Rumi vorher den falschen Wunschtraum aufbaute und sich an ihm hochzog und in dieser Glut und Sehnsucht zu Rumi wurde, steigerte er sich zum Rubin, derweilen der von vornherein relativ illusionsfrei sich eher an Wein als an Gott berauschende, ohne Meer der Seele auskommende Omar Khajjam einsilbig, ja kümmerlich, Kieselstein blieb. Daß aber ein gottferner Kieselstein über einen gotterfüllten Rubin recht behielte, das könnte nimmermehr die Wahrheit sein, selbst wenn es zuträfe.
Fast immer bog und log Rumi seines Meisters Fariduddin ’Attars Glaubenszweifel und Glaubensverzweiflungen, also traurige in fröhlichere Wissenschaft um.
Allen vorhandenen Motiven seines Zeitalters gab er einen Drall ins Komische: Ibrahim Adhams »Kamel auf dem Dach« wurde durch Rumi zum »Kamel in der Regenrinne«. Die von Propheten prognostizierten zweiundsiebzig Sekten, die zu einer Inflation der Zahl 72 führten, tummelten sich bei Rumi als zweiundsiebzig Krankheiten und zweiundsiebzig Verrücktheiten. Den Hadith »Vereinige mich mit dem Duft des Paradieses!« ließ Rumi einen aufsagen, der sich soeben sein Gesäß wusch: »Wie kann der Duft vom Paradies durch diesen Popo wehen?« (Mathnawi, Buch 4, Vers 2224) Selbst Koranverse funktionierte Rumi per Kontextverschiebung seltsam um: Muhammads Understatement »Ich bin auch nur ein Mensch wie ihr« zitierte Rumi so: »Der Mond sagt zu Erde und Wolke und Schatten: ›Ich bin auch nur nur ein Mensch wie ihr‹.«
Wunderliche Anachronismen: Leute des siebten Jahrhunderts redeten im Mathnawi problemlos von Alparsalan, einem persischen König des elften Jahrhunderts, genau wie nebenan, im altteutschen Mittelalter, die Schergen Christi mit den Schlitzärmeln und Sacktaschen Nürnberger Zunftgewandung von 1589 auftraten. So sehr auch Dichter in alle, denen sie Stimme verleihen, hineinzufließen pflegen: Rumis sogenannte Götzendiener nannten ihre höchsten Götter alogisch »Götzen«, konnten also über ihren muhammadanischen Tellerrand nicht so recht hinausgucken (ideologische Grenze).
Mongolensturm, Zerstörung von Kalifat und Bagdad, oder daß Balch 1220 von Dschingis Kahn überrollt wurde, erwähnte Rumi fast nie, und wenn, dann so: »Menschen fliehen vor Mongolen. Wir dienen dem Schöpfer der Mongolen…« Rumi fand Türke und Hindu im Mutterleib ununterscheidbar (und außerhalb?), folglich durchschaute er doch wohl Feindbilder, und schwerlich hätte man mit ihm – hoffentlich – in irgendeinen Dschihad ziehen können. Doch solch weltverbrüdernd berauschende Tat-twam-asi-Erkenntnis setzte sich offenbar selten irgendwo durch. Andere Weltanschauungen relativierte Rumi mit dem Satz »Ebenso wird dir die Falschheit jedes Gedankens, der dich begeistert, verborgen«, ohne diesen Satz je auf sich selbst anzuwenden. So oder so: Wer den Käfig sprengte, taumelte nur von Käfig zu Käfig. Indem Rumi 1001 einfallsreiche Varianten des Käfigsprengens ausspendete, verblieb er im Käfig dieses seines Lieblingsthemas. Obwohl er als Mystiker hoch über vielen Dingen schwebte, auch beklagte, die meisten Gottsucher seien bloß Nachahmer, weil sie nicht den Mut besäßen, unmögliche Situationen zu erleiden, übernahm selbst Rumi, so wie ’Attar, Bayazid u. v. a. im Käfig musulmanischer und monotheistischer Konditionierungen, Denkschienen, Widersprüche und pogromauslösender Hauptirrtümer, fast alle religiös vorgegebenen Inhalte, Dogmen, Theoreme möglichst unhinterfragt. Aus seinem koranfesten Gotteslob, Anrufungen, pausenloser Waschsucht, Ritualgebet tauchten schön schräge Denkbilder und Formulierrosinen immerhin gelegentlich auf, schade drum; bisweilen öfter, in Ekstase noch öfter; nur selten bezeichnete er das Glaubensbekenntnis originellerweise als »Schaum vorm Maul eines Kamels«. Indem er die irakische Mystikerin Rabia al-Adawiya totschwieg, aber x mittelmäßige Derwische ständig nannte und eine ihrer Geschichten einem namenlosen Asketen zuordnete, schien er sich größere Frauenverachtung zuschulden kommen zu lassen als ’Attar.
Rumi, statt Muhammads Diktum, der Fatalist sei schlimmer als der Ungläubige, anzuzweifeln, bejahte und begründete es. In etlichen Versen schien er metaphysisch Unbegabte wenigstens nicht zu hassen, sondern bloß zu bedauern; er steckte sie mit Amusischen in einen Topf, verglich sie moderaterweise mit Mistkäfern, die Mond und Sonne nicht schön finden können, also in einem Erdloch göttliches Licht vermissen. Wenigstens schimpfte er nicht ganz so einfallslos auf Ungläubige, verglich Unglauben putzigerweise mit dem »Stein der Un-Weisen«. Einen Alchimisten veranlaßte er, nie wieder Gold herzustellen, da es sich ja bloß um diesseitiges Gold, also Kot, handelte. Seinen eigenen Standpunkt legte er auch gern mal seit sechshundert Jahren toten Muhammad-Gegnern in den Mund. Im Rauschtrank von Rumis Poesie pflegten sogar Abstrakta sich öfters wechselseitig zu köpfen. Ein Musulmane reiste zusammen mit einem Christen und einem Dschahudi (Juden), wie die Vernunft mit der Triebseele und dem Teufel. (Mathnawi, Buch 6, Vers 2378) Rumi ließ sogar Abneigung gegen Farbige durchblicken, vor allem gegen betrunkene Neger; Türken hingegen fand er hell und also schön. Haschischkonsum, obwohl der Koran ihn gar nicht verbot, sah Rumi als so verwerflich an wie Päderastie (seinem Biographen Aflaki zufolge). Gegen seine korankompatiblen Passagen lassen sich seine weisheitsvollen Tat-twam-asi-Passagen mit der Lupe suchen. Auch als Dichter verharrte er im Käfig jener Formalitäten, die seit Saadi und Fariduddin ’Attar das Genre Lehr-Epos ausmachten: Jeder funkelnden Parabel hängte er eine brave, dürre Moral von der Geschicht’ an, oft eine enge und schematische, wenig erhellende. Kaum erzählte Rumi die Mär eines alten Narren, der mitten auf einer Durchgangsstraße einen Baum pflanzte und dessen Ausreißung ständig zugunsten des Baums verschob, sodaß spätere, ökologisch vorbelastete Leser im Abendland lächeln mußten und mit Baum und Mann sympathisierten, hieß die enttäuschende Moral dann bloß, man solle Untugenden schon im Keim rechtzeitig ausrupfen – schade drum!