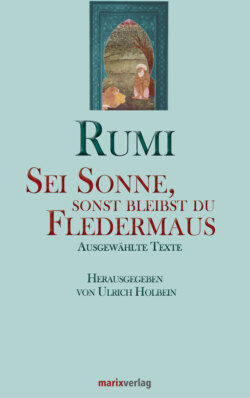Читать книгу Sei Sonne, sonst bleibst du Fledermaus - Maulana Dschelaluddin Rumi - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Übersteige dich, bis dir die Sterne untertan sind!
ОглавлениеDie Lebensgeschichte von Rumis Seelenfreund Schamsuddin von Täbriz (1204–1248)
Der Geburtsname von Schamsuddin (Schamseddin = Sams ad-Din Mohammed Ben Ali ibn Malakad Tabrizi = Sonne des Glaubens) lautete Muhammad Malekdad. Drei Jahre vor Rumi geboren, in der erdbebengeschüttelten, von Sarsam (Meningitis), Maschara (Blutgeschwülsten) und Hunaq (Diphterie) heimgesuchten Seldschuken-Metropole Täbriz, von Türken überlaufen und unterwandert, sah er bereits als Kind Allah, alle Engel und anderes Übersinnliche mit Selbstverständlichkeit und wunderte sich dann bald, daß andere nichts dergleichen sahen. Sein Vater, ein Textilexperte, alias: Tuchhändler, und er: die alte archetypische Konstellation: Geschäftstüchtiger Realist (à la Tuchhändler Giovanni Bernardone oder Hermann Kafka) zeugt Taugenichts mit höheren Interessen (à la Francesco von Assisi oder Franz Kafka).
Nachdem er, der ab irgendwann Schamsuddin hieß, von den Täbrizerinnen Goldstickerei gelernt hatte, wanderte er als analphabetischer, umso beredterer Qalandar (Wanderderwisch) unstet durch die Lande, leicht verlottert, stets in schwarzen Filz gehüllt. Manchmal webte er Hosenbünde mit Hosenkordeln und trug bald den Beinamen Zarduzi (Goldsticker), und auch Tayyar (Fliegender), genau wie Dschaffar ibn Ali Taleb, der von Allah zwei Flügel erhielt, um zum Paradies zu fliegen. Er hieß auch Paranda (fliegender Schams), weil es oft so aussah, als vollzöge er verblüffend schnelle Ortswechsel, geographisch gesehen. Regeln und Rituale, gute Laune, Heuchelei, Lob verachtete er. Sein Lehrer Abu Bakr-i Tabrizi-i Sallabaf, der Körbe flocht, genügte ihm nicht. Auhaduddin Kirmani (gestorben 1238), der sein Schüler werden wollte, ward abgeschmettert; Schamsuddin suchte selber einen Lehrer. Seine Gegner, die sich vermehrten, stieß er mit geistlichem Hochmut genauso oft und gern vor die Köpfe wie seine Anhänger, die sich kaum vermehrten. Schriftgelehrte beschimpfte er als »Ochsen und Esel«. Er handelte wie alle Lehrmeister, die nicht zum Götzen werden und ihre Schüler auf Verblüffungs-Basis von der Verehrung des Individuums heilen wollten (von Meister Marpa in Tibet, der seinen Schüler Milarepa zur Verzweiflung trieb, bis zum späteren Sufi Gurdijeff, der Vegetariern Fleisch vorsetzte und Carnivoren Körner).
Vom Wort her klang »Schams« arg vorislamisch; Schams war ein Götze der Banu Tamim gewesen, und Hauptgottheit der alten Sabäer (Sure 27,24), und auch, nach Stabo, Hauptgottheit der alten Nabatäer, also nicht ganz unidentisch mit Helios. Mitten im Monotheismus, der die Morgengebete extra vor Sonnenaufgang vorverlegt hatte, um der Gefahr, zur blendenden Sonne – statt zum unsichtbaren Allah – zu beten, kleinzuhalten, ging in Schamsuddin al-Täbriz erneut die poetische »Sonne des Glaubens« auf, knapp zur Genitivmetapher verdünnt und erniedrigt.
Da das Paradies von Widerwärtigkeiten umgeben sei, Schamsuddins Lehre zufolge, habe man just bei Unbill Grund zum Jubel. Wenn Wechselfieber ihn schüttelte, tanzte er lachend vor Vorfreude auf seine baldige Genesung; und umgekehrt: In gesunden Tagen lief er finster herum aus Bange vor Umschwung und Erkrankung. Bei einer anderen Sitzung lag gedrückte Stimmung auf allen Derwischen. Schamsuddin behauptete, irgendwer hätte sich eingeschlichen. Man fand aber keinen Eindringling, sondern bloß ein Paar Schuhe, die keinem gehörten. Die entfernte man – prompt wurde die Gesellschaft heiter und gelöst. Rühren ließ er sich nur von einem mystisch frühreifen Knaben, der in seinem Zimmer, den Kopf auf den Knien, sich Ekstasen und dem Gelalle von Versen hingab, die die Eltern nicht zu unterbrechen wagten und um deren Wiederholung der lauschende Schamsuddin bat, doch der Knabe verweigerte dies und starb mit achtzehn.
Gelegentlich verglich sich Schamsuddin mit Sagenheld Rostam, der in Firdusis »Schahname« auf die Frage des mythischen Riesen »Wohin soll ich dich schleudern?« nicht um Gnade winselte, sondern erwiderte: »Wirf mich auf den höchsten Berggipfel, damit meine Knochen von dort aus meinen Ruhm verkünden.«
Gern erzählte er von jenem Mann, der jahrelang sein Ziel vergeblich gesucht hatte, dann seinen Kopf auf einen Ziegelstein legte, davon träumte, was er gesucht hatte, aufwachend den Ziegelstein küßte, ihn immer mit sich trug, vor jedem rühmte, ihn jedem zum Begrüßen und zum Berühren hinhielt.
Scheich Schamsuddin, der Rattenfänger von Täbriz, lehrte nicht Mystik für Anfänger, sondern für derart Fortgeschrittene, daß er selbst sattelfest eingesessene Obergurus zu verblüffen verstand. Keiner verstand ihn, wenige mochten ihn. Zu Allah betete er: »Gibt es nicht ein einziges unter Deinen Geschöpfen, das meine Gesellschaft zu ertragen begehrt?« Das konnte beides heißen: seine Provokationen oder seine optische Schönheit zu ertragen. Dieses Geschöpf fand er bald. Eine Eingebung verwies ihn zum nicht unbekannten, drei Jahre jüngeren Dozenten juristischer und religiöser Wissenschaften (nach anderen Quellen: zwanzig Jahre jünger). In Konya traf er Ende Oktober 1244 ein, stieg zunächst im Khane (Zunfthaus) der Zuckerbäcker ab, oder auch im Gasthaus Princiler. Mit seiner unorthodoxen, schier blasphemischen, jedenfalls wahnwitzigen Frage, wer größer sei, Muhammad oder Bayazid, ließ er Rumi erbleichen und ohnmächtig zu Boden sinken, manche sagten hinterher: vom Kamel aus; andere sagten später: Schamsuddin saß hierbei auf einem Sofa am Eingang der Karawanserei. Nach wieder anderer Überlieferung war das Kamel ein Esel, und Schams pöbelte den konsternierten Akademiker an, riß diesem dessen Manuskript aus der Hand und warf es in einen Brunnen mit den Worten: »Soll ich’s wieder rausfischen? Es wird ja dann trocken sein.« Ein Matrose berichtete später, die erste Begegnung sei die zweite gewesen; sie hätten sich bereits früher in Damaskus getroffen, und zwar mitten im Menschengewühl. Alsbald hieß es zudem, Schamsuddin sei vorher die Begegnung mit Rumi verheißen worden. Eine seltsame Beziehung zwischen diesen beiden ergab sich, die sofort in Freundschaft ausartete. Zwischen den fast Gleichaltrigen pendelte sich die Frage, wer von beiden als wessen Schüler oder auch Meister sich aufspielen oder sich erweisen würde, zunächst nicht sofort fraglos und sonnenklar ein. Der Wanderderwisch jedenfalls hebelte den Schullehrer ziemlich aus, durch sinnverwirrende Suada, prüfte ihn, legte ihn rein, machte ihm seine Lieblingslektüren madig, befehligte ihn herum, verlangte verbotenerweise mit Wein bedient zu werden, was dieser sofort untertänigst ausführte – geistlicher Härtetest? Machtkämpfe? Psychospielchen mit viel Peitsche und viel Honig? Fopperei?
Wenn Rumi masochistisch gekrochen kam, sein Leben als Pfand anbot, winkte Schamsuddin ab: »Was fällst du zur Last? Verpiß dich!« Altertümlicher übersetzt: »Hebe dich von hinnen!«
Verabschiedete Rumi sich zaghaft und wollte nicht stören, lachte Schamsuddin: »Bleib doch!« oder: »Du Tor, komm!« Wenn Rumi irgendwas wünschte, vertagte Schamsuddin: »Morgen.« Wenn Rumi einen nicht genehmen Vergleich aussprach, wie »Rose«, schlug der laut Rumi »rosenwangige« Schamsuddin dem Dichter auch mal auf den Mund, vermutlich recht unmetaphorisch. Schamsuddins bitteres Angesicht wurde zum Zentrum von Rumis Heiligtum. »Ich will deinen Kopf!« sagte Schamsuddin, und Rumi reichte ihn ihm als Gabe.
Schams verlangte ein Shahid (Beweisstück), ohne näher zu spezifizieren, was für eins. Zögernd ward ihm Kira Khatun, Rumis Ehefrau, zur Verfügung gestellt, die aber Schams als Dienerin plötzlich ablehnte, um statt ihrer einen Knaben zu verlangen, den der dann auch bekam. Rumis Erstgeborener, Baha’uddin Sultan Walad, diente zeitweise seinem Herrn Schams.
Da ließ Schamsuddin den Befehlston fallen und beugte selbst sein Haupt vor dem Unterwürfling. Im Lauf von Wochen und Monaten krempelte Schams Rumi um, polte ihn um, holte ihn auf die frühere, nämlich nomadische, analphabetische, oft schriftfeindliche, schamanistische Kultur- und Religionsstufe (ewenkisch: schaman = erhitzt) zurück, um zugleich diese zu der Zeit historisch längst überholte Stufe als die attraktivere, höhere zu verkaufen, aber nicht als Bauernfänger, sondern als Bauer oder Handwerker. Ein Goldsticker fing einen studierten Mann ein und verstand ihn abhängig zu machen, bis süchtig. Die inhaltlich lehrbare Weisheit des Schamsuddin kann es schwerlich gewesen sein. Nie gehörte Gedankeninhalte kamen da kaum zum Zuge. In seinen Aufzeichnungen flackerte er rätselhaft und sprunghaft herum. Die halbseidenen Aussprüche, Repliken und Parabeln, die er runterrasselte, in denen Kamel und Ameise Gewässer überqueren wollen und von denen Rumi eine im »Fihi ma fihi« überlieferte, allwo Stricke in eimerlosen Brunnen reißen, in denen schwarze Gespenster hausen und knifflige Quizfragen stellen, flachten neben Rumis eigener Bildersprache deutlich ab. Dieser Derwisch wirkte vielmehr durch seine spezifische, irritierende, suggestopädische, halb farbig, halb düster schillernde unrekonstruierbare Eigenart, durch möglicherweise halladsch- oder rasputinartig brennende Blicke, die als lebendiges Augenspiel rüberkamen (späterer Psycho-Jargon würde das alles »Persönlichkeitsausstrahlung« nennen und zum Befund kommen, daß er polarisiere). Schwarze Locken, laut Rumi, trug er, die er beim Kämmen heftig zurückzuwerfen pflegte, sowie ein Kinngrübchen (also keinen Bart?!).
Schams maßte sich an, bekannte verstorbene Mystiker nach Grad und Art ihrer Trunkenheit und ihrer Relation zum Hawa (Schwarmgeisterei) und zum Ruh (wahren Geist) abzustufen, rechnete Auha’uddin Kermani ganz zum Hawa. Einem namens Imad wurde zugebilligt, später dann doch noch vom Ruh berührt worden zu sein. Sayyid Burhanuddin Muhaqqiq, Rumis Lehrer, hingegen sei, sagte Schams, von wahrem Geist trunken gewesen, mehr als Rumi. Schamsuddin, der alle nur herunterputzte und überall nur die Luft rausließ, erkannte in seinem plätzeverteilenden Drang immerhin Rumi den Rang eines Rubins zu, während er dem damals in toto viel berühmteren Universal-Giganten und Eckpfeiler der Gelehrsamkeit Muhiuddin ibn Arabi nur die Stufe eines Kieselsteins zubilligte. Viele debattierten, ob Schams ein wahrer Heiliger sei oder nicht. Er kümmerte sich nicht um diesbezügliche Zwischenergebnisse. Um Rumi davon zu befreien, sich ständig einseitige falsche Vorstellungen von ihm zu machen, nahm er sich vor, sich einmal ungeschminkt zu zeigen. Er behauptete, Rumi bestehe bloß aus Dschamal (Schönheit), er selber aber aus einer Mixtur aus Dschamal und Zischti (Häßlichkeit).
Die Sonne (Schams), vor der – laut Rumi – die Welt als Vorhang hing, sah sich vom schmeichelnden Sonnenstäubchen Rumi umkreist. Und ließ sich von ihm gnädig mit hochgezogener Augenbraue »Lebensspender« titulieren, »Wonne des Wissens und des Handelns«, »Rosenbeet und Garten der Welt«, »Auge und Lampe der Welt«, bis hin zu »Ränkeschmied«, »Schalk« »unheilbares Leiden«, und zu »einem Meer voll Perlen, mit bitterem Angesicht«.
Den Dauer-Höhenflug der närrisch wahnverwandten Quasi-Dioskuren besah die normalgebaute Umgebung immer skeptischer, mißgünstiger, scheelsüchtiger. Schamsuddin war allen ziemlich unsympathisch, oder gar unheimlich. Man zerriß sich das Maul über seine dubiose Abstammung. Es hieß, er könne Dämonen bezwingen und triebe Geheimkünste, aber in Gesellschaft konnte er davon genauso wenig wie alle anderen, oder hielt sich zurück. Einmal rühmte dieser Derwisch in zweischneidiger Hymne auf einen Henker, daß dieser die Seelen aus dem Kerker ihres Leibes befreie, und schon lief ihm dieser Henker, den noch nie einer gelobt hatte, als Muride (Schüler) zu. Weil Schams sich über den Derwisch Qutbuddin Ibrahim ärgerte, ließ er ihn ertauben, gab ihm später das Gehör zurück; ihm blieb aber eine Beklommenheit zurück (was spätere Zeiten wohl mit »Depression« übersetzen würden), die sich auch durch Schamsuddins Auffordungen, fröhlich zu sein, nicht auflockern ließ, bis dann Qutbuddin auf dem Markt hinstürzte und rief: »Es gibt keinen Gott außer Gott, und Schamsuddin ist sein Prophet!« Daraufhin ließ Schams einen Mann, der Qudbuddin verdrosch, tot umfallen. Entweder kursierten Gerüchte, Schams habe in einer Moschee, in der er übernachtete, einem Muezzin oder Türhüter, der ihn rauswerfen wollte, durch Geisteskraft Hals und Zunge anschwellen lassen und dann dessen klägliche Erstickung nicht verhindert, oder man bauschte erfundene Geschichten auf, um den Derwisch noch zwielichtiger finden zu können. Oder Schamsuddin-Biograph Aflaki übertrieb hier heillos die »Lizenz zum Töten« eines religiösen Agenten 007. Fiese Ansichten wie »Was also heult ihr beim Märtyrertod von Aliden!?!« (Maqalat, Abschnitt 271) verstreuten ihre Spur bis hinauf und hinein in Rumis späteres Mathnawi, Buch 6, Vers 797 f., falls dies nicht sowieso Zeitgeist diktierte.
So oder so, man strebte den Störenfried rauszuekeln. Man erhoffte Rumi zu beruhigen, durch Abschwächung der allzu geistlichen Flöhe, die der hergelaufene Spinner ins Ohr des ortsansässigen Gottsuchers gesetzt hatte. Schamsuddin al-Täbriz setzte sich selbst rechtzeitig, nach zwei strapaziösen Jahren, 1246, spätestens nach allerlei Flüchen und Drohungen, freiwillig ab. Er ging zurück nach Syrien, nach Täbriz, wohin ihn Dutzende, dann Hunderte sehnsüchtiger Klage- und Lockbriefe seines Busenfreundes verfolgten, ehe Baha’uddin, Rumis just volljähriger Sohn, ihn nach Monaten in Damaskus aufspürte, mit Edelmetallgeschenken und vorbereitetem Reittier zurücklockte. Auf vierwöchiger Rückreise bediente Sultan Walad Schamsuddin persönlich und lernte tiefsinnige Weisheiten von ihm. Obschon Schams sich weniger abhängig gab von dieser seltsam heftiglichen Freundschaft, fiel das Wiedersehen beidseits überaus überschwenglich, kuß- und tränenreich aus. Schamsuddin heiratete nun Kimiya (d. h. Elixier) Khatun, ein Pflegekind des Rumi-Clans, laut Faridun Sipahsalar Rumis Tochter; die Verbindung war eingefädelt von Rumi, sehr zum Mißfallen von dessen zweitem Sohn Alla’uddin Celebi, der Kimiya längst liebte und sie sich nun fortgeschnappt sah. Um in sein Zimmer zu kommen, mußte Alla’uddin in der Enge des gemeinsamen Hauswesens stets durch Schamsuddins Zimmer, der ihm Vorschriften machte, und dies in Alla’uddins Vaterhaus! Schamsuddin, von Anfang an gewaltsam einquartiert, machte sich immer unbeliebter, stand als narzißtischer, möglicherweise auch objektiv sehr gutaussehender, scharfzüngiger, unkeuscher Yussuf im Dunstkreis benachteiligter, dumpfer, sich dauerhaft verulkt fühlender und arrogant abgefackelter Brüder, Familienmitglieder, Hausdiener. Eine neue Variante auf die archetypische Situation zwischen dem schönen hochnäsigen Yussuf (Joseph) und seinen normalgebauten Brüdern. Im immer verfilzteren Chaos hausinterner Klimaverschlechterung, Querelen, Mobbing, altertümlicher gesagt: von Häme, Rangelei, Fama und Kabale, drohte Schamsuddin wiederholt, für immer zu verschwinden. Doch diesmal so, daß ihn keiner mehr finden könne! Man brauchte kaum nachzuhelfen. Alsbald kam Schams unerwartet heim, rief nach Kimiya, erfuhr, sie sei ohne seine Erlaubnis mit Sultan Walads Großmutter in den neuen Gärten spazieren gegangen, Schams brauste auf. Kimiya kam zurück mit Nackenschmerzen, wurde passiv wie ein trockenes Stück Holz, das nur noch wimmerte und nach drei Tagen starb, was natürlich alle an die dicke Zunge des unseligen Muezzin erinnerte. Das heizte die schlechte Stimmung weiter auf. Wenig später verschwand der eingeheiratete Wanderderwisch tatsächlich, ohne Abschied. Sein zweiter Abgang war noch abrupter, gruß- und spurloser als sein erster und blieb so geheimnisvoll und ungeklärt wie bei Empedokles, Henoch, Al-Hakim bi Amrillah, Osama bin Laden, Saddam Hussein u. a. Schamsuddin al-Täbriz tauchte nie wieder auf.