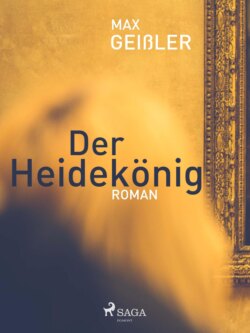Читать книгу Der Heidekönig - Max Geißler - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеGegen Mittag ging er die Westerstrasse lang und geriet wieder vor das Fenster des Althändlers, vor dem er sich verankerte. Zum hundertsten Male las er das Schild neben der Tür, dass hier Gemälde alter und moderner Meister gekauft würden. Er hatte sich gleich am ersten Amsterdamer Tage die Firma in sein Notizbuch eingetragen. Man konnte nie wissen ...
So begann dieser Abschnitt im Leben des Matheis Maris in dem Schaufenster des Herrn Nikolaas van der Layen, in welchem neben reichlich viel Staub eine Unmenge fesselnder Altstücke aufgestapelt waren: Tassen, Gemälde, Götzen der Fidschiinsulaner, Schnitzereien aus dem alten Ägypten, fremde Münzsorten und Bücher in Schweinsleder, deren Schnitt wie verrostetes Eisen aussah und die vielleicht einmal von tiefsinnigen Mönchen geschrieben worden — dachte Maris.
Dass diese Raritäten genau so wie in seinem Fenster auch in dem Herrn Nikolaas van der Layen selbst herumlagen und in einem Schleier von Staub noch altertümlicher erschienen, merkte Matheis, als er den Laden betrat. Wohl eine Stunde hatte er draussen auf den Strassensteinen gestanden, versunken in Anblick und Deutung der Schätze hinter dem Fenster. Aber auch um zu beobachten, ob er wohl mit Herrn Nikolaas van der Layen allein sein werde, wenn er sein Anliegen vorbrächte.
Da in dieser langen Zeit kein Mensch über die ausgetretenen Stufen geschritten war, fasste er sich ein Herz. Die Glocke über der Ladentür, die an einer stählernen Feder hing, bellte wie ein kleiner aufgeregter Hund, der nicht von der Stelle weicht, bis ihn sein Herr zur Ruhe verweist. Was Herr Nikolaas van der Layen denn auch tat. Er ergriff ein Bambusrohr und legte diesen verlängerten Zeigefinger auf die Wächterin seiner Schätze.
Doch dazu kam es erst nach hinlänglicher Zeit; denn der Laden des Nikolaas van der Layen war eine Einrichtung, die aus sehr vielen kleinen derartigen Einrichtungen bestand, welche im Laufe der Jahre zwischen den äusseren vier Wänden eingebaut waren durch Regale voller Bücher, Etagèren mit altem Porzellan, Bildern, Geweben aus aller Herren Länder.
Darum stand Matheis Maris zwei furchtbar lange Minuten unter der belfernden Glocke und bildete sich ein, er habe die Tür wahrscheinlich ungeschickt behandelt, weil sich während obenbesagter Minuten ausser seiner bänglichen Verwunderung und dem Sturmläuten nichts ereignete, das für seine Sinne wahrnehmbar gewesen wäre. In Wirklichkeit jedoch machte sich Herr Nikolaas van der Layen in dem Labyrinthe seines Ladens auf die Socken — was Matheis schliesslich an dem Schatten erkannte, den die mancherlei Lämpchen aus den mäandrischen Gängen gegen die Decke warfen.
Endlich hatte sich ein Mensch durch diese Gänge hindurchgewunden. Der trug den Namen Nikolaas van der Layen. Und nun erst trat der Bambusstock in seine wahrhaft beruhigende Tätigkeit.
Van der Layen sah aus wie sein Laden. Im Gegensatz zu diesem machte er jedoch auch einen ungeheuer zuvorkommenden Eindruck. Er lupfte sogar das zerschlissene Seidenkäpplein ein wenig und fragte: „Was steht dem jungen Herrn zu Diensten?“
Dies aber war nur das Werk eines Augenblicks; denn als der Händler erfuhr, dass Matheis Maris nicht gekommen sei, etwas zu erstehen, sondern womöglich zu verkaufen, welkte sein Gesicht zu einer niederträchtigen Hässlichkeit zusammen, und Nikolaas van der Layen liess sich an, als stünde er dem bösen Feinde in Person gegenüber. Er zog den Kopf zwischen die Schultern und machte mit der Hand den Vers von der Göttlichen Komödie: Lasst alle Hoffnung sinken ihr, die ihr hier eintretet. Matheis Maris hatte von der Göttlichen Komödie zwar keine Ahnung, aber er dachte, eins Hand wie diese müsse sich aus der Pforte des Himmels strecken, wenn ein der Verdammnis Verfallener irrtümlicherweise dort Einlass begehre.
Herr Nikolaas van der Layen schlurfte danach aber nicht zur Tür seines Altwarenhauses, um den bösen Feind hinauszukomplimentieren, sondern er hielt dem betroffenen Wanderer eine Rede über die schlechte Lage des Geschäfts im allgemeinen und über die kümmerliche Nachfrage nach Bildern im besonderen. Er sprach bitter, aber er sprach geläufig. Und dabei wusste er aus Matheis Maris herauszulocken, dass es sich um zwei Dutzend kleine Ölgemälde, und zwar Originale, handele. „Von wem?“ — „Von Matheis Maris.“
Diesen Namen wiederholte Herr van der Layen. Und als er ihn zum zweiten Male durch seinen Mund gezogen hatte, sah er aus wie ein Stück Seidenpapier in einer Wagentraje, wenn’s regnet. „Gott im Himmel, wer ist Matheis Maris?“ lachte Nikolaas van der Layen.
„Er ist mein bester, mein einziger Freund,“ sagte Matheis und begann kleinlaut zu erzählen, wie er eigentlich habe zu Alma Tadema reisen wollen und wie ihm eingefallen sei, dass ihm wohl auch der Herr van der Layen mit seinem Rate beistehen könnte.
So spann sich die Geschichte aus dem Schaufenster in das Altwarenkabinett auf der Westerstrasse zu Amsterdam immer tiefer hinein und verleugnete von Anfang an nicht ihren epischen Charakter mit dramatischem Einschlage. Wobei die behagliche epische Breite das Übergewicht hatte.
Ja, es war, als hätte dieser Herr Nikolaas van der Layen an jenem Tag überhaupt keine andere Aufgabe, als die Angelegenheit seines Besuches in die Länge zu ziehen. Daran änderte sich auch nichts, als eine Seite der mäandrischen Gasse in sanfte Bewegung geriet; denn diese Seite — aus einem Gewebe von unbestimmten Farben gebildet — wurde an einer Stelle plötzlich gerafft, und das scharfgeschnittene Gesicht eines bleichen jungen Mannes ward sichtbar. Ein Paar grosse dunkle Augen richteten sich auf Matheis Maris.
„Haben Sie gehört, ter Meulen?“ fragte van der Layen.
Die fieberigen Sterne des Sehens blieben unbeweglich stehen bei der Wand aus alter Seide. Nur der Mund, der aussah wie der eines alternden Komödianten, verzog sich verächtlich. Jedennoch — Nikolaas van der Layen betastete nervös den Rucksack des Maris und schickte sich an, bei der Herabnahme behilflich zu sein. Dabei sprach er in einem fort von der Unmöglichkeit, das Bild eines Unbekannten zu verkaufen — „und könnte dieser Unbekannte malen wie Rembrandt oder wie der liebe Gott!“
Das Kapitel der Geschichte des Matheis Maris im Altwarenkabinett der Westerstrasse zu Amsterdam hatte um elf Uhr des Vormittags begonnen. Es dauerte bis gegen drei Uhr nachmitags. Es war demnach so lang wie zwei Romane, die ein geübter Leser in vier Stunden bequem zu Ende liest. Darum kann nur andeutungsweise berichtet werden, was in diesen vier Stunden geschah. Kein Käufer störte den Gang der Handlung. Nikolaas van der Layen entfernte von jedem Bilde die papierne Hülle, trat mit jedem in das Licht des Tages, das durch die Scheibe der Tür fiel, rückte zu jeder Betrachtung die Hornbrille mit den Rundgläsern mit genau der gleichen Bewegung und prüfte mit der Lupe. Unbemerkt von Matheis Maris schien er dem jungen Mann hinter dem Vorhang einen Wink gegeben zu haben; denn dieser trat plötzlich hervor, war sehr lang, nahm die Tafeln der Reihe nach aus der Hand van der Layens und betrachtete sie mit seinen tiefen heissen Augen. Manchmal warf van der Layen einen Blick auf ter Meulens Gesicht. Und fiel kein Wort. Es war, als hätte sich der Händler stummgeredet im Übereifer von vorhin. Van der Layen zählte die Tafeln. Es waren vierundzwanzig. Sie waren von Eichenholz und alle kleinen Formats. Er nahm sie unter den Arm, sah Matheis Maris an und sagte: „Kommen Sie.“ Dann schritt er vorauf in die mäandrische Gasse. Ter Meulen bildete den Beschluss.
Matheis Maris hatte in seinen Büchern ein Bild von den Katakomben. Es war ihm, als leite man ihn zu einer unterirdischen Grabstätte. Bald nach rechts, bald nach links wendeten sie, bald in Finsternis und bald in den Schein eines schwimmenden Ampellichts, das kaum die Kraft hatte, einen Schatten zu werfen. Dann kamen sie ins Herz dieses Labyrinths. Das war ein freier Platz — in dessen Mitte ein kleiner Tisch mit einer brennenden Lampe. Davor standen zwei Lehnsessel mit Armrasten, aus Rohr geflochten. Nikolaas van der Layen setzte sich auf einen Bücherstapel und lud Matheis Maris mit einer Handbewegung ein, auf einem der Stühle sich niederzulassen. In den anderen sank ter Meulen.
„Erzählen Sie, wie Sie zu diesen Bildern kommen,“ sagte van der Layen. „Wo lebt Ihr Freund? Hat er mehr? Wie alt ist er? Wer ist sein Lehrer gewesen? ...“ Er hatte seine Sprache wiederbekommen und schüttele einen ganzen Sack voll Fragen über Matheis Maris aus.
Der hob den lange gesenkten Blick und sagte: „Matheis Maris bin ich.“
Nikolaas van der Layen lupfte sein Mützlein. Es geschah nicht zur Ehrenbezeigung; sondern: diesen Ausdruck des Erstaunens liess sich der Kaufmann entwischen trotz seiner Verschlagenheit — er dachte: im vorliegenden Falle hätte es damit keine Gefahr. Dann wischte er sich mit der Hand aus gelbem Pergament über das Gesicht, als hingen Spinnweben darin, und sagte: „Haben Sie gehört, Lukas ter Meulen?“
„Matheis Maris bin ich! Ich bin zugleich mein bester, mein einziger Freund.“ Er wollte nicht die Meinung in van der Layen aufkommen lassen, als habe er sich mit einer Lüge bei ihm eingeführt. Und nun erzählte er die Geschichte seines Lebens von den Tagen des Gärtners bis zur Austreibung aus dem Paradiese.
Da zog van der Layen für einen Augenblick alle Vorhänge zurück von seinem siebenfach verhüllten Gesicht. „Könnten Sie sich so etwas ausdenken, Dichter Lukas ter Meulen?“
Es begann der Handel. Van der Layen sagte, er wolle fünf Gulden für jedes Bild zahlen, und wenn es ihm gelänge, zu verkaufen, versprach er noch fünf vom Hundert des Erlöses. Ein Vertrag wurde unterzeichnet. Auf einem kümmerlichen Stück Papier. — Die Sache ging genau so schwunglos vor sich, wie sie hier aufgeschrieben ist.
Zwar: das Herz des Matheis Maris sprang ungebärdig in dies ungewohnte Zaumzeug. Er aber — beim ersten Versuche gesattelt in der Welt der Menschen, hatte genugsam auf seine Beine zu passen und durfte einem Manne wie van der Layen den Weg wohl nicht weisen, nach dem es ihn gelüstete. Jedennoch, daran dachte er: von dem Paradiese der Moorheide war er siebentausend Meilen weit weg! Wie ein Duft seiner Sommergärten, die von der Seide des Himmels eingefriedigt gewesen, wehte es durch ihn dahin — wie ein verlorener Duft.
Er hatte keine Zeit, diesem wehmütig lieben Grusse der anderen Zeit nachzuwittern. Sein Blut rauschte. Die Gedanken, die einst mit breiten Schwingen in ihm gelegen hatten wie Schmetterlinge in der Sonne — die Gedanken ratterten nun durch seinen Kopf wie Schnellzüge. Seine Schläfen peitschte ungeheueres, nie erträumtes Erleben.
Nikolaas van der Layen zählte ihm einhundertzwanzig holländische Gulden auf den Tisch. — Heiliger Gott, was für eine Welt der Wunder, in der ein alter Mann das in Farben gedichtete Glück eines Moorjungen mit hundertzwanzig holländischen Gulden bezahlt! Wie der Zauberer aus dem Märchen stand van der Layen vor dem Fiebernden; denn er verstand die Kunst, Sold zu machen aus Eichenholz, Sepia, Ultramarin und Terpentinöl! Heiliger Gott!
Auf einmal — da lief Matheis Maris wieder draussen in den Strassen herum. Nein, er fuhr; denn die Füsse, auf denen er an zwanzig Jahre sehr bedachtsam über das federnde Moor gewippt war — die Füsse hatten Rollen bekommen, und darauf ging es zwischen Wind, Lärm, Wagen, schlagenden Glocken und jagenden Menschen hindurch, und die Rollen unter seinen Sohlen taten, als wären sie die vereinigte Einrichtung aus Herz und Kopf des Matheis Maris, auf die es nun allein ankäme.
Abends war er angetrieben in einem grossen Kaffeehause im Herzen der Stadt und trank Schokolade. Die Augen flimmerten ihm von den tausend Lichtern, die in ihm und ausser ihm herumstanden. Es erging ihm, wie den Spätergeborenen vor der weissen Leinwand der Kinematographentheater, als diese Erfindung noch in den Kinderschuhen steckte: ein Prasselwerk von Funken und verrückt gewordenen Lichtstreifen blitzte vorüber. Die ganze Welt hatte das Hasten. Arme stiessen sich in Tabakrauch, Stühle schaukelten auf den Hinterbeinen, Zeitungen in Hölzern wehten als Fahnen im Winde, schöne blanke funkelnde Frauen, oh, unerhört schöne blanke funkelnde Frauen blühten dazwischen ... Aber erwartungsvoll, erwartungsvoll waren die Augen des Matheis Maris auf die Kellner gerichtet, die in feierlich schwarzen Fräcken durch dies Gewühl von Stimmen, Rauch, Fahnen und Funkeln sich wandten mit Gläsern voll dampfendem Kaffee und Gefrorenem auf silbernen Tabletten, ohne die Last dieser blanken Bretter umzustülpen auf einen gefährlich gaukelnden Damenhut ... Ja, solch eine Sache musste sich wohl im nächsten Augenblick ereignen. Und die malte sich Matheis Maris in bewegtem Mitgefühl aus.
So fing er an, die neue Welt von der Stelle aus zu durchdenken, bis zu der seine Urteilskraft einstweilen reichte; denn nur von den Kellnern wusste er, wozu sie da waren.
Einmal schien es ihm, er sei der ruhende Pol in der Flucht der Erscheinungen. Da schnellte ein Zeitungsjunge vorbei und rief die Titel der Abendblätter. Auch der »Telegraaf« war dabei. Das war Pieter Bosbooms Weisheitsquell gewesen. Und weil ihn das so heimatlich anmutete, und weil er sah, dass sehr viele Männer sich ebenfalls eine Zeitung erstanden, fasste er sich einen Mut, fragte den Jungen nach dem Preise und legte das geforderte Zehnzentstück in die kleine Hand.
Da stand gleich unten auf der ersten Seite unterm Strich über einem Aufsatz der Name Matheis Maris. In zentimetergrossen Lettern. Jawohl, ganz deutlich: Matheis Maris.
Der richtige Matheis Maris begann also, sich zu unterrichten, was es mit jenem Menschen für eine Bewandtnis hätte, der den gleichen Namen trug. — Da fand er seine Lebensgeschichte in einer Zeitung, seine eigene! Und diese Zeitung wurde in der gleichen Stunde wohl von zehntausend Menschen gelesen: die Geschichte des Gärtnerjungen, die Geschichte im Paradiese, die Geschichte von dem jungen Menschen mit den Gepflogenheiten des Einsiedlers aus der Moorheide, der in einem Kleide aus dem anderen Lande zu Nikolaas van der Layen gekommen und seinem Genie nachgelaufen sei wie die Könige aus Mohrenland dem Stern ... Habemus pictorem! schloss der Aufsatz über Matheis Maris, mit dem kein anderer gemeint sein konnte als er. Habemus pictorem. Er wusste nicht, was das bedeutete. Aber vielleicht war es die Zauberformel, die in Besitz alles Wissens setzt; denn woher konnte die Zeitung das Geheimnis aus dem Heidemoor erfahren haben, wenn nicht mit Mitteln der schwarzen Kunst?
Die Rollen, die er zuvor unter den Sohlen seiner Schuhe gespürt hatte, schienen nun an die Stuhlbeine gezaubert zu sein. Und Matheis Maris dachte: die Fahrt ins Himmelblaue müsste gleich losgehen, hussa!
Aber es geschah nichts von alledem. Und weil er unter Einsatz aller Kräfte seines Geistes den Weg nicht entdecken konnte, auf dem der »Telegraaf« zu seinem Geheimnisse gekommen war, da ward ihm angst und bange vor sich selber: die hier draussen in dieser neuen Welt wussten alles — er nichts! Und in diese Welt hatte er sich hineingewagt? Auf diesem brausenden Strom wollte er sein armes Schifflein treiben lassen? Es war ihm, er müsse nun aufspringen und seine Hände um den Mund legen zu einem furchtschweren Hilferuf.
Aber natürlich — auch das raste vorüber; denn nicht ein Ruf nach Hilfe ist die notwendige Folge, wenn einer einen beglückten und beglückenden Zeitungsartikel über sich selbst liest. Nein nein, so wild war die innere Zerrüttung des Matheis Maris nicht. Es war nur eine unerhörte Umstellung in ihm. Und es war die Erkenntnis, das sei nun wohl die Welt, die er hinter dem blauen Vorhange seines Heidehimmels vermutet hatte, und er — der Vogelsprachekunde — fände für diese Welt, um die sich nicht nach allen Seiten die fürsorglichen Hände Gottes legten, nicht die richtige Übersetzung. Ja.
Nach einer kleinen Zeit kümmerte ihn auch das nicht mehr. Da schwamm ein Glück in ihm, ein Glück — er gab ihm einen äusseren Ausdruck in der Bestellung einer zweiten Tasse Schokolade. Diesmal mit Schlagsahne. Dann las er den Aufsatz im »Telegraafen« zehnmal. Was eine sehr wohltätige Wirkung hatte. Seine Gedanken lernten nämlich wieder — zwar nicht in der Stete wie früher, aber dennoch in einer Richtung sich zu bewegen, die er wünschte. Er dachte an Flossy Maris, und er dachte an seinen Freund Pieter Bosboom, und wie es wohl wäre, wenn selbiger Pieter Bosboom nach einigen Tagen die Zeitung in die Hände bekäme und der Name Matheis Maris schlüge ihm in die Augen — nun, lieber Pieter Bosboom, du wirst in ein wildes Springen geraten, mit dem wehenden Zeitungsblatte hinüberjagen zu Mutter Flossy und deine Arme um sie werfen, dass die ärmste Frau nicht anders denken kann als: Jetzt — den armen Pieter Bosboom hat der Teufel geholt! Und Nele Greefs! Hurrjeh! Und all die anderen, die ihn angesehen hatten als den bösen Feind!
Diese Betrachtung gab ihm einen ungeheueren Ruck. Er bestellte abermals eine Tasse Schokolade. Wobei es ihm hauptsächlich um die für ihn neue Erfindung der Schlagsahne zu tun war, in die er sich neben seiner jungen Berühmtheit vertiefte in unirdischem Behagen.
Gerade hatte er beschlossen, bei Ruhm, Schokolade und Schlagsahne die Nacht herumzubringen, da schritt ein sehr langer, sehr bleicher Mensch mit sehr heissen Augen daher und sah sich vergeblich nach einem Tisch um, an dem er Platz nehmen konnte. Es war Lukas ter Meulen, der Dichter.
Matheis Maris erhob sich und wagte eine Verbeugung, wie er sie an diesem Abend zu verschiedenen Malen beobachtet hatte. Indes balancierte ter Meulen einen Stuhl über die Köpfe der Menge und setzte sich zu Matheis in den scheuen Winkel. „Na, mein Lieber, was sagen Sie zu meinem Aufsatz im »Telegraafen«? Ich habe ihn heute nachmittag bei van der Layens Lampe geschrieben und mir von dem Alten einen kleinen Vorschuss auf das Honorar ausgeliehen.“ Ter Meulen bestellte Mokka und zwölf Stück Kuchen. Den Kuchen schlang er in heissem Hunger hinab. Er trank noch einige Tassen Mokka und rauchte Virginiazigarren.
Jeder andere hätte bei diesem Gebaren in weit offene Gärten geschaut. Matheis Maris nicht. — Ja, so war das mit dem Dichter Lukas ter Meulen. Der lange bleiche Mensch verursachte in dem biederen Jan van Moor ein gewaltiges Herzbeben und frisierte ihn in dieser Nacht sozusagen zurecht für die Welt, der er fortan gehören sollte. Matheis Maris starrte ihn dabei stumm und bewundernd an. — Er hatte sein Augenmass liegen gelassen in Nikolaas van der Layens Labyrinth.
Lukas ter Meulen. Kaffeehauspoet. Für viele: ein Genie. Ohne Sitzfleisch. Als welches bei einem Genie die Hälfte der Begabung bedeutet. Genie haben, das heisst: fleissig sein wie Gott. Der ruhte am siebenten Tage — ruhete? — an jedem vorhergehenden aber schlug er sich eine Welt aus dem Herzen. Genie haben, das heisst: fleissig sein wie Gott und fast so weise. Ausserdem — ja —: wofür die deutsche Sprache kein Wort hat — das ist Genie. Einer nimmt ein Hälmlein Gras in die Hand — es fliegt ein Schmetterling daraus hervor. Einer knetet eine Krume Erde — es flattert ein Stieglitz auf. Es wischt einer ein Klümplein Farbe auf Eichenholz — und wird ein Gedanke Gottes daraus. Sehet, das ist Genie! Fast so weise wie Gott! Denn Gott nahm nichts in die Hände und warf sieben Millionen goldene Funken ins Weltall. Er nahm nichts in die Hände, und schüttelte das Blühen des Frühlings über die Erde, warf das blaue Band der Meere um sie her, richtete die ewigen Berge auf mit den silbernen Kronen, legte die Wälder dazwischen und dichtete Sommerwiesen hinein! Hosianna! Hosianna! — Nur als er den Menschen schuf, da nahm er etwas ... Oh!
Alles redete der Dichter Lukas ter Meulen dem Matheis Maris in das erstaunte Herz. Seine Ehrfurcht vor Gott. Seine Verzweiflung an den Menschen. Seine Verachtung des Lukas ter Meulen. Seine Erschütterung vor der herrlichen Blüte des Willens, die aufgegangen war in Matheis Maris und seiner gottseligen Einsamkeit. Seine Anbetung vor der Allmacht dieses Willens, der einem ahnungslosen Dorfjungen das Himmelslicht der Gnade schenkte, die die Menschen gemeinhin »Künstlertragödie« nennen. Hatten die stumpfen Moorbauern den Akt im Paradiese nicht schon betrachtet als fertiges Trauerspiel? „Es ist so — ist so, ohne Ausnahme — soweit Menschen die fürchterliche Öde ihres Durchschnittsdaseins tragieren.“
Lukas ter Meulen zermalmte das Mundstück seiner Virginia zwischen den Zähnen zu einem Pinsel ... „Ha, Tragödie! Eine Tragödie nur für die Schar derer, die ohne Willen sind!“
Ter Meulen war bis oben voll von Schätzen, Merkwürdigkeiten und Seltenheiten. Er hatte sie in sich aufgestapelt wie Nikolaas van der Layen seine Raritäten im Labyrinthe der Westerstrasse. Nun warf er alles aus sich heraus und über des Matheis Maris weitäugiges Stummsein dahin. Er tobte in der Lust seiner Menschenverachtung und in der Lust der Verachtung seiner selbst. Aber er schrie nicht. Er sprach mit verhaltener, weichverschleierter Stimme. Dabei neigte er sein Gesicht über den kleinen Marmortisch gegen Matheis. Und kam wieder auf das Gnadengeschenk des Künstlertums zu sprechen und nannte dabei das Wort »Euphorie«.
Da legte Matheis Maris der Einsiedler die Spitzen der Finger seiner rechten Hand an die Nasenwurzel wie eine Zange. Zuerst liess er sich den Sinn der vermeintlichen Zauberformel »Habemus pictorem« deuten. Dann erforschte er, was es mit der »Euphorie« für eine Bewandtnis habe ... Hilfe! Hilfe! schrie sein Bauernjungenverstand.
Da war Lukas ter Meulen schon mittendarin in der Erläuterung des geheimnisvollen Zustands eines erhöhten Lebensgefühls, den er Euphorie genannt hatte. Die Euphorie, sagte er, beginnt bei einem Kranken an einer gewissen Stelle auf dem Weg in sein Sterben. An jener Stelle lauert die Erhabenheit des Himmels. Der Mensch ist von allen Schmerzen befreit. Es löst sich sein Bewusstsein ahnungslos auf ins Unendliche ...
Matheis Maris kniff das Zänglein seiner Finger fester in die Nasenwurzel. Die Nägelmale waren zu sehen. Er senkte in Scham die Augen; denn er hatte ter Meulen nicht verstanden.
Der erkannte das. Er sagte es ihm noch einmal und fand zu seiner Erklärung schlichte, volle Worte — bis der erlöste Atemzug des Maris ihm verkündete: es ist vollbracht.
Ter Meulen erläuterte weiter in überweltlicher Geduld: „Krank — krank insgesamt ist die Menschheit, mein Freund! Aber das euphoristische Wunder des erhöhten Lebensgefühls wartet nur auf ein paar Auserwählte, die der Himmel mit dem Vorschmack der Seligkeit begnaden möchte in ihrem Sterben, als Vergeltung für ausgestandene Schmerzen: Siehe, du Armseligster, so süss ist Leben!“
Lukas ter Meulen legte seine Hände auf die Hände des Maris: „Ihr aber, ihr Künstler, ihr wahrhaften Künstler, ihr schwimmt in diesem geheimnisvollen Strom erhöhten Lebensgefühls! Ihr, die einzigen, die den Goldbecher des Daseins leeren; denn für euch nur gilt das: Er schuf den Menschen ihm zum Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Wir andern — oh, wir sind ihm halbfertig aus seinen Schöpferhänden gefallen!“
Es sassen nur noch wenige Gäste an einzelnen Tischen in dem grossen Raum umher. Die Kellner lehnten übermüdet in den Winkeln oder stahlen sich hinter Säulen ein Auge voll Schlaf. Die Uhr an dem Rundbogen über der Schankstätte zeigte ein Viertel vor drei. Da stellten die Zeiger das feine Sinnbild der mütterlich gebreiteten Arme. „Gehen wir,“ sagte ter Meulen. „Ich habe mein Leben verpasst — diese stumme Mahnung der Spätnacht verpass ich nie. Sehen wir.“