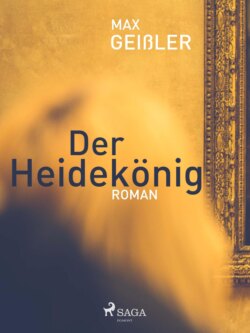Читать книгу Der Heidekönig - Max Geißler - Страница 27
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеSo schleppte er seine fröstelnde Übernächtigkeit und sein verstörtes Herz weiter gegen die Stadt und dachte an dem verblödeten Gedanken herum, sich eine Pistole zu kaufen.
Da kamen zwei Männer des Wegs. Und da dieser Weg ein Steig in der Heide war, der sich braun und schmal zwischen Erikabüscheln hindurchschlängelte, dachte Matheis Maris daran, quer durch das taunasse Ried in gemessener Entfernung an jenen vorüberzuschneiden, wobei es ihm wiederum nicht einfiel, in welch ärmlicher Verfassung sich seine Seele befände, da es ihn wie ein Tier der Wildnis trieb, zwei fremden Menschen auszuweichen in Feindseligkeit und Scheu.
Nun blieben die beiden stehen. Einer legte die Hände um den Mund und rief den Namen Matheis Maris über die Heide herüber, Da stellte es sich heraus, dass der Rufer Lukas ter Meulen war.
Seit vielen Wochen hatten sie einander nicht gesehen. Der Dichter war noch länger und dünner geworden. Seine Augen standen in dem klaren Gesicht als die Spiegel von Erkenntnissen, denen nichts erlassen wurde, sofern sie die Person und das Dasein des Lukas ter Meulen betrafen.
Der andere. Er war eine Burg ohne Tor und Eingang. Ein Mensch von unerhört seltsamer Art. Schon in seiner Kleidung zeigte sich das. Er trug zu dieser sehr frühen Heidewanderung einen Zylinderhut, den er vielleicht bei einem Althändler erstanden hatte. Des weiteren war sein langer steckensteifer Leib, den er gravitätisch daherstelzte, angetan mit einem abgeschabten schwarzen Gehrock und einem nankinggelben sehr engen Beinkleids, das durch Stege daran gehindert wurde, im Schreiten ziehharmonika mässig sich emporzufalten. Ein rabenschwarzer, sehr schmaler Knebelbart — der Schnurrbart fehlte — erhöhte den Eindruck der Strichhaftigkeit und der Verfallenheit seines Gesichts, das so eindimensional aussah, als müssten sich die Innenseiten seiner Wangen berühren. Aus diesem unvergesslich einzigartigen Antlitz sprang die Nase kühn und wachsbleich hervor.
Da sich Matheis Maris ersichtlich an ihm wunderte, sagte ter Meulen: „Dieser Herr ist keineswegs der edle Ritter Don Quichotte, wie Sie anzunehmen scheinen, lieber Freund. Seine Waffen sind nicht Schwert und Tartsche, sondern Meissel und Modellierholz. Es ist der Bildhauer Gerbrand van Aken.“
Matheis Maris benahm sich hölzern wie in jener Nacht im Kaffeehaus, in der er vor ter Meulens Weisheit so kümmerlich und bange geworden war.
Und dennoch war es heute ganz anders mit ihm. Damals zog er aus, eine Welt zu entdecken. Und als er ihre Säume sah vom Rande seines Moorschiffleins aus, rief ter Meulen durch den »Telegraaf« über das Land: „Matheis Maris, Gebenedeieter unter den Menschen, sei gegrüsst!“
Der Bildhauer Gerbrand van Aken und Lukas ter Meulen kamen auch an diesem Morgen aus dem Kaffeehause, wo sie die Nacht in bedeutenden Gesprächen verbracht hatten. Von der Stunde der morgendlichen Reinigung waren sie ausgetrieben worden und gedachten nun in lichtbekränzter Frühlingsebene das Werk fortzusetzen. Bei dem Bildhauer van Aken hiess das nichts anderes als: die Burg ohne Tor und Eingang womöglich noch dichter zu machen.
In jüngeren Jahren hatte dieser Bildhauer Figuren von rühmlichem Kunstwerte geschaffen, ein Romstipendium erhalten, in Athen gelebt. Dort war er das Opfer der Idee geworden, aus den bei der Zerstörung des Parthenon erhalten gebliebenen Figuren und Bruchstücken die ursprüngliche Anordnung der Gruppen wieder zu entdecken und das Verlorene im Geist und Glanze der Schöpferwelt hinzuzubilden.
Solcher Verknüpfung von Kunst und Wissenschaft galt seit vielen Jahren sein Dasein. Er träumte davon, einen Mäcen zu finden, der ihn beauftragen würde, ein grosses Modell des Parthenontempels herzustellen. An diesem Werke wollte er Giebel, Skulpturenschmuck, Zellafries und Metopen — — — halt, halt!
Lukas ter Meulen warf mit schweren Weisheiten nach Matheis Maris, mit so schweren Weisheiten, dass dem Maris zumute wurde, als würde er gesteinigt. Vom Parthenon selber hatte er wohl eine dunkle Ahnung. Aber bei den Worten Zellafries und Metopen vergingen ihm die Sinne. Wie den bösen Feind starrte er ter Meulen an. Nach der Folter dieser Nacht, nach quälerischen Wochen erschien ihm der Dichter als das Werkzeug eines gehässigen Schicksals, das darauf ausging, ihm den Rest an Mut und Selbstvertrauen zu rauben. „Skulpturenschmuck, Zellafries und Metopen!“ prasselte es über ihn dahin. Einen Augenblick dachte er an Flucht. Spornstreichs über die Heide wollte er rennen — wie er gestern dem selbstgewählten Leben entflohen war. Denn davon hörte er längst nichts mehr, dass Lukas ter Meulen schalt: in zähem Fanatismus habe Gerbrand van Aken fast ein Menschenalter an jener Sache gearbeitet und darüber fast alle Fäden zwischen seiner Kunst und dem Leben seiner Zeit zerschnitten.
Der kluge ter Meulen gedachte ja nur, seinen langen Freund van Aken auf den richtigen Weg zu führen und zugleich Matheis Maris vor ähnlichen spintisierenden Irrtümern zu bewahren!
Einmal sah er Maris in die Augen und erkannte, dass dieser unmächtig sei, ihm zuzuhören. Der hatte seinen ungefügen Gehstock vor sich in den Sand gestochen und hatte Mühe, sich daran aufrecht zu halten; denn das leuchtende Bild der Morgenerde verschwamm vor seinen Augen in Finsternis.
Sie setzten sich also auf einen Hügel und Matheis Maris erzählte, wie er die Nacht und die Tage vorher verbracht hatte. Das redete er daher mit jener gelassenen Selbstverständlichkeit, die die Frucht tiefster Erkenntnis ist — oder die Folge krankhafter Teilnahmlosigkeit. Wahnsinn sei es gewesen, behauptete Maris, sich in eine Welt zu wagen, für die er nach all seinen Ausmassen zu klein geraten war. Der armselige Jan van Moor mit seiner Fibelweisheit hatte sich zugetraut, durch diese Welt hindurch den Weg zur Sonne zu finden! Und wenn gar vor ihm zwei vom Parthenon in Athen sprachen, von Zellafries und Metopen als von lächerlich geläufigen Dingen, die man im Nachtkaffee herausholt wie eine billige Zigarre aus der Tasche, da stürzte der Himmel über dem Bauernbuben ein! Er hatte nicht einmal eine Ahnung, dass eine venezianische Bombe zweitausend Jahre nach der Errichtung des Parthenon das Dach dieses vollkommensten Denkmals menschlichen Schöpfergeistes zerwetterte in dem ausgesuchten Augenblick, in dem es die Türken als Pulvermagazin benutzten ... Stückweis hatte Matheis Maris dies bisschen Wissen darüber aus dem Gespräche ter Meulens und des Bildhauers aufgelesen — trotz seiner Erdrücktheit ...
Es war all die Zeit her so mit ihm gewesen. Er dachte, er müsste die gesamte Weisheit der Menschen in sich hineinstapeln, um ein Maler werden zu können! Heisshungrig im Geiste rannte er in seinen Tagen umher. Er verschlang alle Bücher, deren er habhaft werden konnte. So eiferte er in der Nacht und suchte am Tag in den Gassen der grossen Stadt nach dem Leben seiner Zeit. Und merkte gar nicht, dass sein Geist und Gemüt wurden wie kleine Wimpel, die an hohen Masten flattern im Sturm! Er merkte das nicht, bis er unter der Föhrenkussel der nächtlichen Heide erwachte und dachte, er sei gestorben, weil es so erlöst und himmelstill um ihn war.
Und nun kam seine Absage an sich selbst: „Ich kann nichts! Ich bin nichts! Ich will nichts mehr! Ich werde nie ein Kerl sein! Ich bin der verlorenste Dummkopf, der dem lieben Gott je geraten ist!“
„Aha!“ sagte Lukas ter Meulen. Er sah ihn aus den Winkeln der Augen an, dabei so von oben herunter und voller Spott — ein nichtswürdiger Blick. Dann dirigierte er den misshandelten Rest seiner Virginia von Steuerbord nach Backbord und predigte dem sonderbaren Herrn Gerbrand van Aken wieder das Evangelium. — Nicht einmal wert einer Randglosse erachtete er den Matheis Maris.
Dieser hielt das für sehr in der Ordnung. Was konnte einem Menschen wie Lukas ter Meulen an dem entgleisten Gärtnerburschen liegen, der einen Winter lang den Verstand verloren hatte und nun wieder dahin zurücksickern wollte in Scham und Reue, wo die Wildkaninchen und Kiebitze einmal im Jahre vom Wandertritt eines Heidegängers geschreckt wurden?
Indessen redete der Dichter ter Meulen mit seiner klaren klingenden Stimme, wohlig hingestreckt an die lichtatmende Erde, redete ein ganzes Buch aus sich heraus über die Gründlichkeit, mit der van Aken versuchte, den Geist des Altertums zu erfassen in Zeiten, deren Geschmack sich der Renaissance und dem Barock zugewendet hätten. Er redete Geschichte und Kunstgeschichte, als habe er eigens zur Errettung des Herrn Don Quichotte-van Aken dickleibige Werke studiert, um diesem nachzuweisen: in seiner vertrakten Beflissenheit an einem Lebenswerke, das halb Kunst, halb Wissenschaft sei, scharre dieser van Aken seit zehn Jahren unermüdlich an seinem eigenen Grabe.
Gerbrand van Aken sass währenddem auf dem Heidehügel und stellte ein äusserst komisches Bild; denn von dem Drehpunkt, auf dem er sich niedergelassen hatte, bis zum Deckel seines rauchen Zylinderhutes bildete sein langer Leib einen Schwibbogen von gefährlicher Dünne. Den Gehrock trug er fest zugeknöpft. Aken sah aus, als sei er vor Augenblickes Frist durch eine unsichtbare Macht zur Erde geschleudert worden und hätte noch nicht Zeit gehabt, sich auf eine bequemere Stellung zu besinnen. Der Strich des Knebelbartes, der ihm von der Unterlippe das Kinn hinablief, schien mit dem Lineal und mit Kohle gezogen.
Matheis Maris begann darüber nachzudenken: dieser sonderbare Heilige war ihm in der Stadt schon hundertmal über den Weg gelaufen. Wobei es ihm eingefallen war, den wunderlichen schwarzen Ritter als die Verkörperung irgendeiner dunklen Macht für eines seiner mystischen Bilder zu verwenden ...
Ja, daran dachte er nun. Zu anderen Zeiten hätte er die ausgewogenen Weisheiten ter Meulens gierig in seinen dürstenden Geist getrunken. Aber — das waren Dinge, die ihn seit dieser Nacht nichts mehr angingen.
Aken hingegen benahm sich der eindringlichen Rede ter Meulens gegenüber genau so, wie man ihn durch die Strassen von Amsterdam schreiten sah: zugeknöpft bis oben hin und als sei ausser ihm niemand auf der Welt.
Matheis Maris — je nun, der folgte dem Gespräche mehr als ihm lieb war und hatte doch beschlossen gehabt, sich allgemach einen felsenfesten Schlaf anzutun — etwa wie ein Leser, der in einem Romane durch Parthenontempel, Zellafries und Metopen sich hindurcharbeiten soll, weil ein unseliger holländischer Bildhauer einmal den verzweifelten Einfall gehabt hatte, das Glück seines Lebens und sein Talent daran zu vernichten. Oh!
Nun war Lukas ter Meulen nicht nur ein sehr kluger, beredter und vielseitig gebildeter Mann, sondern zugleich ein aufopferungsfähiger Freund, der kein Mittel unversucht liess, die Irrenden unter seinen Freunden seiner klaren Erkenntnis teilhaftig werden zu lassen. Und dennoch: der Dichter ter Meulen war ein wahrhaft Gekreuzigter, an dem das Wort zur Geltung kam wie an keinem vor ihm: »Andern hat er geholfen, sich selber aber kann er nicht helfen«.
Er war einer von denen, die zu allen Zeiten in der Literatur herumlaufen und für die die Menschen — kurzsichtig und freigebig — den Ehrentitel eines Genies immerzu bereithalten. Lukas ter Meulen, der Kaffeehauspoet.
Die Einrichtung seines Wohnraums bestand aus einer Kiste, von der er behauptete, dass er sie zu Umzügen benötige. Auf dieser Kiste pflegte ter Meulen zu sitzen, wenn er nicht lieber nebenan auf dem ewig ungemachten Bette lag. Sass er nicht darauf, so stand ein verrosteter Spirituskocher dort mit einem geringen Blechtopfe. Beides hatte er sich von seiner Mietsfrau ausgeliehen, um sich zuzeiten ein Ei zu sieden. Lukas ter Meulen gestand ohne weiteres, dass ihm darüber hinaus in dieser Wohnung nichts einfiele.
Auf den Fensterstöcken hatte er beschriebene Zettel aufgestapelt, mit flüchtiger, gemeinhin unentzifferbarer Schrift bekritzelt. In der Stadt sagte man, es seien auf diesen Zetteln tüchtige und wohl auch wahrhaft grosse Gedanken in geschliffene Worte gefasst, Gedanken von unerhörter Einmaligkeit, die in der Form, die ihnen Lukas ter Meulen geliehen, Ewigkeitswerts besässen. Vielleicht hatte der Dichter selbst einmal an solche Bedeutsamkeit geglaubt. Oder er hatte vorgehabt, die beschriebenen Zettel als Steinchen und Steine zu einem Bau von geistiger Monumentalität zusammenzufügen. Allein, das war schon lange her. — Inzwischen hatte er sich damit abgefunden, dass er zu jedem Werk von geschlossener Grösse untüchtig sei.
In Amsterdam galt er nicht für ein Genie — will sagen: für irgendeins unter gleichen — sondern für das Genie schlechthin. Deshalb öffneten ihm alle Zeitungen freudig ihre Spalten; denn Lukas ter Meulen hatte stets etwas zu sagen, etwas Neues von überraschendem Glanze der Form und des Wortes und von noch überraschenderem Lichte des Geistes. Er selbst jedoch legte dieser Tätigkeit nur insofern Wert bei, als sie ihn in die Lage setzte, sich mit Anstand durch sein Kaffeehausleben zu schlagen.
Das Gerücht von seinem Genie kannte er natürlich. Vielleicht war er der einzige in der Welt unter den Erscheinungen seiner Art, dem man diesen Ruhmestitel zubilligte ohne die geringste Beimischung von spiessbürgerlichem Mitleid und ohne ein heimlich spöttelndes »na ja«; denn Lukas ter Meulen ward weder in Schuhen mit zerlaufenen Sohlen noch in vertragenen Kleidern gesehen. Auch mit der schäbigen Eleganz des Bildhauers Gerbrand van Aken hatte des Dichters Zigeunertum nichts gemein. Dass er keinen Zent Geld darüber hinaus verdiente, als er für seine Lebensgewohnheiten nötig hatte — eben dies war für die biederen Bürger eins der kapabelsten Zeichen seiner Genialität. Dass sich im Kaffeehaus ein Ring von Schülern um ihn sammelte, von denen mancher älter war als der Meister, überzeugte beinahe genau so stark. Überdies wusste man: für viele dieser Schüler war Lukas ter Meulen Grund und Kompass ihres Lebens geworden.
Er ward bei keinem literarischen Tee gesehen. Seine Post wurde im Kaffeehaus für ihn abgegeben — die Adresse »dem Dichter Lukas ter Meulen in Holland« genügte. Aber die Einladungen der literarischen Zirkel begrub er in den Papierkorb, der bei seinem Stammtisch eigens für ihn aufgestellt war.
Nur an diesem Stammtisch war er nahbar, und nur, wenn er nicht die List erkannte, ihn als Zierstück für einen Salon mit wohlfeilem geistigen Ehrgeiz zu gewinnen. Denn er hasste diese Lebensformen. Er hasste die gesellschaftliche Vereinigung von Menschen als Wechselstuben für abgegriffene Kleinmünze. Und so einer unvorsichtig genug war, ihm seine Genialität ins Gesicht hinein zu versichern, ja, den verachtete er. Dann erhob sich Lukas ter Meulen — und wär’ es auch gewesen, dass der Kellner just eine frische Tasse duftenden Mokka vor ihm auf die kleine Marmortafel geschoben hätte — er erhob sich und schritt ohne Gruss von hinnen. — Von solcher Art war Lukas ter Meulen.
Er war ein Mensch ohne Überheblichkeit. Er war ein Mensch ohne phantastische Vorstellungen über die Kräfte seines Geistes, an denen er sich nie vermass. Im übrigen schätzte er sie genau so hoch ein wie jene, die ihn kannten. Aber dies war der Unterschied: jene sagten, bei Lukas ter Meulen sei kein Ding unmöglich — wenn er nur wolle, dann könne er sich vornehmen, was es auch sei, es müsse ihm gelingen. Lukas ter Meulen dagegen wusste: sein Wille, sich etwas vorzunehmen, durfte die Grenzen nicht überschreiten, die ihm das unentbehrliche Kaffeehausdasein sicherten.
Er hatte versucht, sein Leben anders zu leben, Da war es aus mit ihm, aus. Von Stund an machte er den Eindruck eines Mannes, dem nie etwas eingefallen wäre. Er wurde blöd am Geiste. Er wurde zitterig an seinem Leibe, und er wurde lass in seiner Kleidung. Er wusste, er würde der verwahrloseste unter den Literaturzigeunern Amsterdams werden, wenn ihn ein Verhängnis dazu verurteilte, die alten Lebensgewohnheiten aufzugeben. — So besass er die Gaben eines Genies ... bis auf diesen mangelnden Willen, oder bis auf die Fähigkeit, an jedem Tag ein Stück zielbewusster Arbeit zu verrichten, oder sich zu einem sichtbaren Werke von Wert und Dauer zu sammeln ... oder wie man das sonst nennen will.
Weil er seine Gaben an dem wirtschaftlichen Ertrage mass, den sie ihm lieferten, hielt sich Lukas ter Meulen zuletzt für ein genau so verpfuschtes Exemplar seiner Gattung, wie dies Matheis Maris mit sich selber tat in der Stunde der verlorenen Begegnung am Heidehügel vor Amsterdam. An den Kreuzespfahl seiner Gewohnheiten genagelt oder an den seines brüchigen Willens, verhehlte sich ter Meulen den Jammer nicht, der es zuletzt doch mit ihm war. Aber dieser Jammer wurde masslos, wurde schmerzhaft, ja er wurde tödlich, wenn ter Meulen auf die merkwürdige Idee verfallen wäre, ein anderer zu sein als der unbekümmerte, funkelnde, nachdenkliche, weisheitspendende Kunstphilosoph und Kaffeehauspoet. Darin lag das Geheimnis seines Glücks. Es war ein Jammer um ihn, und dennoch: glücklich zu sein — es mag kein Mensch je gegen das holdselig unbewusste Rätsel des Himmels, es mag kein Mensch je zu den goldenen Blumen der Sterne sinnvoll emporgeträumt haben, der glücklicher gewesen wäre, als Lukas ter Meulen.