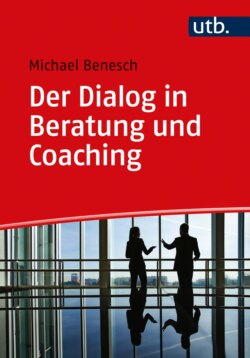Читать книгу Der Dialog in Beratung und Coaching - Michael Benesch - Страница 13
1.5 Konstruktivismus und Dialog
ОглавлениеDer Konstruktivismus mit all seinen unterschiedlichen Schulen und Denkrichtungen (von „dem“ Konstruktivismus kann man nicht sprechen) wird oft als eine Art Modephilosophie bezeichnet, was jedoch seinen Wert nicht schmälert. Ein wunderbares Bild für das, was den Konstruktivismus im Grunde kennzeichnet, liefert der Film „Matrix“ mit Keanu Reeves in der Hauptrolle. Die Menschen werden von Maschinen und Computerprogrammen in ihrem Denken, in ihren Illusionen gefangen gehalten und haben praktisch keine Chance zu erkennen, dass ihr gesamtes Leben auf ihrer eigenen gedanklichen Konstruktion beruht.
Der Mensch schafft (konstruiert) sich seine Welt, hat keine Möglichkeit, die Gültigkeit seiner Erkenntnisse zu überprüfen, und kann über die Passung zwischen seiner, der subjektiven Wirklichkeit und einer möglichen „objektiven“ Realität nichts Sicheres aussagen. Im Film glauben die Menschen an eine „Wirklichkeit“, die ausschließlich in ihren Köpfen vorhanden ist und ihnen von Computerprogrammen vorgespielt wird. Zwischen Wirklichkeit und Realität kann nicht unterschieden werden. Die Frage, die sich uns nun stellt, wenn wir uns mit dem Begriff „Konstruktivismus“ beschäftigen, betrifft genau dieses Verhältnis von Wirklichkeit und Realität: Nehmen wir die Welt so wahr, wie sie „ist“, im Sinne einer Abbildfunktion, oder schafft unser Gehirn eigene Wirklichkeiten?
Derartige Gedanken sind alles andere als neu, man denke an das Höhlengleichnis von Platon, die Schriften des Idealisten George Berkeley oder an jene von Immanuel Kant. Dennoch liefern uns konstruktivistische Zugänge äußerst wertvolle Einsichten, und nicht nur das: Sie versorgen uns mit hilfreichen Begriffen, die wir auch im Dialog sinnvoll nutzen können, zumal unzählige neurobiologische Erkenntnisse auf Basis moderner bildgebender Verfahren sich gut mit konstruktivistischen Erklärungsmodellen verbinden lassen.
Es soll im Folgenden kein Überblick über konstruktivistische Entwicklungen und Denkrichtungen gegeben werden. Vielmehr ist es meine Motivation, zu weiterer Beschäftigung mit diesen Denkzugängen im Kontext des Dialogs anzuregen. Falko von Ameln (von Ameln 2004, S. 3) fasst die erkenntnistheoretische Grundüberzeugung konstruktivistischer Ansätze folgendermaßen zusammen:
„1) Das, was wir als unsere Wirklichkeit erleben, ist nicht ein passives Abbild der Realität, sondern Ergebnis einer aktiven Erkenntnisleistung.
2) Da wir über kein außerhalb unserer Erkenntnismöglichkeiten stehendes Instrument verfügen, um die Gültigkeit unserer Erkenntnis zu überprüfen, können wir über die Übereinstimmung zwischen subjektiver Wirklichkeit und objektiver Realität keine gesicherten Aussagen treffen.“
Tatsache ist, dass unsere Nervenzellen unspezifisch feuern, das heißt: Die Impulse, die von ihnen ausgehen, sind nicht qualitativ, sondern nur quantitativ unterscheidbar. Die Neuronen selbst können natürlich für etwas stehen: Auf die Augen treffendes Licht erzeugt auf der Netzhaut Impulse, Schallwellen erzeugen im Innenohr Impulse usw. Diese Impulse werden dann über sogenannte Synapsen, die sich durch Gebrauch verstärken und durch Nichtgebrauch verkleinern, weitergeleitet. Die Zahl der Neuronen im Gehirn beträgt etwa 1010 und da jedes Neuron mit bis zu 10 000 anderen Neuronen Verbindungen besitzt, ergibt sich eine unglaubliche Menge von ca. 1014 Verknüpfungen.13 Verglichen mit der Zahl der Eingänge und Ausgänge (also jenen Fasern, die Informationen von der Außenwelt ins Gehirn transportieren), ist diese Anzahl an internen Verbindungen im Gehirn unglaublich groß, etwa „10 Millionen mal so groß wie die Zahl der Eingänge und Ausgänge zusammen“ (ebd., S. 52). Mit anderen Worten: Das Gehirn ist primär mit sich selbst beschäftigt.
Die Neuronen selbst kennen nur Aktivierung oder Hemmung durch Impulse. Unser Gehirn konstruiert daraus unsere Wahrnehmung. Anders ausgedrückt heißt das: Die Farbe Grün ist keine Eigenschaft der Welt, sie ist eine Konstruktion unseres Gehirns.
Humberto Maturana und Francisco Varela (Maturana/Varela 1987) geben als Beispiel dafür, wie unser „Geist“ die Welt um uns herum konstruiert und wie sehr unsere Erfahrung mit der neuronalen Struktur verbunden ist, gerne das Experiment mit dem blinden Fleck an: Betrachten Sie Abbildung 3. Halten Sie das Buch in einem Abstand von ca. 40 cm vor ihren Augen, fixieren Sie mit dem rechten Auge das Kreuz und machen Sie Ihr linkes Auge zu. Bewegen Sie dann das Buch leicht vor- und rückwärts – irgendwann verschwindet der Punkt.
Abb. 3: Der blinde Fleck: ein Experiment (eigene Darstellung)
Wenn genau das passiert, wird der Punkt an jene Stelle der Netzhaut projiziert, an welcher der Sehnerv austritt. An dieser Stelle sind wir blind. Eigentlich müssten wir uns dieses visuellen Lochs ständig bewusst sein, nur: Wir nehmen es nicht wahr, weil unser Gehirn Wahrnehmung darüberkonstruiert, und das ununterbrochen. Wir sehen nicht, dass wir an dieser Stelle nichts sehen.
Dieses kleine Experiment ist nur als anschauliches Beispiel dafür gedacht, was sich in unserem Geist praktisch ständig abspielt. Wir ersetzen lückenhafte Informationen durch neue Konstruktionen, ohne uns dessen bewusst zu sein, zumindest aber ohne uns dessen vollständig bewusst zu sein. Abbildung 4 zeigt ein ähnliches Beispiel: Ist hier tatsächlich ein Dreieck abgebildet? Nein, aber unser Gehirn ergänzt das fehlende Material zu dieser bekannten Figur.
Abb. 4: Die Ergänzung nicht vorhandener Informationen: ein Dreieck, wo keines ist
Wir berühren hier einen ganz wesentlichen Bereich des Dialogs, nämlich die sogenannten mentalen Modelle. Damit sind Konstruktionen gemeint, die zu Schlussfolgerungen im Sinn von Vorurteilen führen – ein Vorgang, der blitzschnell geschieht. Unser Denken ist bestrebt, fehlende Informationen zu ersetzen, und wird dabei auf einer im Wesentlichen unbemerkten Ebene von Filterprozessen gesteuert – beispielsweise von biografischen, sozialen oder auch kulturellen Filtern. Wenn wir unser Denken verstehen wollen, dürfen wir den Jetzt-Zustand keinesfalls als eine statische Momentaufnahme betrachten, sondern als gerade aktuelles Ergebnis eines systemisch-chaotischen Prozesses, als gerade gültiges und vorläufiges Resultat unüberblickbarer Einflussfaktoren. Dieses Resultat wird beeinflusst von persönlichen Erfahrungen, kulturellen Normen, momentanen Stimmungen und vielem mehr.
Paul Watzlawick (Watzlawick et al. 2003, S. 28) zitiert ein Beispiel, das von Gregory Bateson stammt und den Erkenntnisgewinn reflektiert, den man aus der momentanen Stellung aller Schachfiguren während einer Partie ziehen kann. Dieser Erkenntnisgewinn ist nicht sehr umfassend. Trotz der vollständigen Information zum gegebenen Zeitpunkt liegen die aufschlussreichen Informationen im Spielverlauf, also auf der Ebene der Beziehungen. „Jedes Kind lernt in der Schule, dass Bewegung etwas Relatives ist und nur in Relation auf einen Bezugspunkt wahrgenommen werden kann. Was man dagegen leicht übersieht, ist, dass dasselbe Prinzip für alle Wahrnehmungen gilt und daher letzthin unser Erleben der äußeren Wirklichkeit bestimmt.“ Und weiter: So überrascht es nicht, „dass auch die Selbsterfahrung des Menschen im wesentlichen auf der Erfahrung von […] Beziehungen [beruht], in die er einbezogen ist“ (ebd., S. 29).
Auch das Ergebnis eines scheinbar einfachen Denkprodukts ist als die Synthese vielfacher, komplexer und sehr persönlicher Beziehungserfahrungen und -konstruktionen aufzufassen, die großteils auf Ebenen unterhalb unserer bewussten Wahrnehmung ablaufen.
Und selbstverständlich dürfen wir dabei den Kontext, im Rahmen dessen wir unbewusst an unseren Konstruktionen arbeiten, nicht außer Acht lassen. Beängstigend sind die Umstände des Falls Uzal Ent, die während des Zweiten Weltkriegs zu einem Flugzeugunfall führten und einen Menschen in den Rollstuhl zwangen. Dem berühmten und geachteten Luftwaffengeneral war im Oktober 1944 ein Ersatzpilot zugeteilt worden. „Während des Starts begann Ent in seinem Kopf eine Melodie zu singen und dazu von Zeit zu Zeit mit dem Kopf zu nicken. Der neue Kopilot deutete diese Geste als Zeichen, die Räder einzuziehen. Obwohl sie zum Abheben noch viel zu langsam waren, zog er das Fahrwerk ein, was dazu führte, dass das Flugzeug unsanft zu Boden ging. Dabei löste sich ein Propeller und verletzte Ent so schwer im Rücken, dass er von da an beidseitig gelähmt war“ (Cialdini 2001, S. 30).
Natürlich war das Verhalten des Kopiloten dumm. Aber es wäre zu einfach, dies als einzige Erklärung anzuführen. Der Kontext, die zugestandene Autorität des Generals, beeinflusste mit Sicherheit das Verhalten und die Wahrnehmung des Ersatzpiloten, und zwar auf einer unbewussten Ebene, denn sonst hätte der Mann nicht so unverständlich reagieren können. Wahrgenommene Autorität erzeugt in vielen Menschen ein mentales Modell der Art: „Die Ansicht einer Autoritätsperson wird hoch bewertet, die Gültigkeit der eigenen Meinung schrumpft.“ Selbstverständlich bieten sich gerade bei diesem Beispiel noch weitere Erklärungsmodelle an, wie beispielsweise das Phänomen der Autoritätshörigkeit an sich.14 Aber das Uzal-Ent-Muster zeigt doch eindrucksvoll, wohin uns unbewusste mentale Modelle sogar auf einer konkreten Handlungsebene führen können. Sie vermögen Denkweisen und Handlungen in uns aufkommen zu lassen, die sich in einem anderen Kontext niemals zeigen würden.
Kontextuale Effekte wie der eben beschriebene sind wohlbekannt und untersucht. Sehen wir uns noch ein dialogtypischeres Beispiel aus dem Bereich der Sozialpsychologie an, welches zeigt, wie mächtig unsere unbewussten Konstruktionen sind, symbolisch gesprochen: jene Auffüllungen der weißen Flächen zwischen den drei schwarzen Kreisen, die uns ein Dreieck vorgaukeln (siehe Abb. 4):
Personen wurden aufgrund der Ergebnisse aus einer Selbstbeurteilungsskala in zwei Gruppen eingeteilt (Gerrig/Zimbardo 2008, S. 654):
a) höchstens schwache Vorurteile gegenüber Afroamerikanern,
b) starke Vorurteile gegenüber Afroamerikanern.
Danach wurden ihnen Fotografien vorgelegt, die Schwarze oder Weiße mit einem entweder glücklichen oder wütenden Gesichtsausdruck zeigten, und die Versuchspersonen mussten angeben, ob sie mit dieser Person gerne zusammenarbeiten würden. Die Fotos wurden angekündigt (zum Beispiel: wütend/weiß, glücklich/schwarz) und zusätzlich wurde während dieser Phase der Ankündigung die Gehirnaktivität gemessen. Die Messungen ergaben, dass sich die Hirnaktivitätsmuster deutlich unterschieden. Versuchspersonen mit schwachen Vorurteilen aktivierten Denkressourcen, um jedes Gesicht individuell zu beurteilen, während die Personen mit starken Vorurteilen weniger Gehirnarbeit leisteten und relativ schnell „Nein, ich würde mit dieser Person nicht zusammenarbeiten wollen“ antworteten.
Warum sollten wir uns mit derartigen Phänomenen beschäftigen? Im Dialog verfolgen wir ja den Anspruch, uns des eigenen Denkens bewusster zu werden, das eigene Denken zu beobachten. Je öfter wir etwas tun, je öfter wir etwas denken, desto stärker wird genau dieses zu einer unreflektierten Gewohnheit. Man könnte sagen: Es entstehen neuronale Signaturen, Muster im Gehirn, die nicht mehr hinterfragt werden.
Wie binden Sie eigentlich Ihre Schnürsenkel? Versuchen Sie einmal, diese Bewegungsabläufe genau zu beschreiben, ohne es zu tun – nur in Gedanken. Vermutlich wird Ihnen das nicht leichtfallen, obwohl Sie es schon tausende Male gemacht haben.
David Bohm meint dazu (Bohm 2007, S. 14):
„I think that whenever we repeat something it gradually becomes a habit, and we get less aware of it. If you brush your teeth every morning, you probably hardly notice how you’re doing it. It just goes by itself. Our thought does the same thing, and so do our feelings. That’s a key point.“
Und weiter:
„When you are thinking something, you have the feeling that the thoughts do nothing except inform you the way things are and then you choose to do something and you do it. That’s what people generally assume. But actually, the way you think determines the way you’re going to do things. Then you don’t notice a result comes back, or you don’t see it as a result of what you’ve done, or even less do you see it as a result of how you were thinking“ (ebd., S. 16).
Wir können also von einem Fehler im Denken sprechen: Das Denken informiert uns nicht über die Probleme „da draußen“, das Denken selbst bestimmt bzw. konstruiert das, was wir Probleme nennen, und das gilt natürlich ebenso für die Gesamtwahrnehmung. Deshalb müssen wir unser Denken selbst beobachten. Wir haben immer unzureichende Informationen, wenn es darum geht, Situationen, Menschen oder uns selbst zu beurteilen. Aber wie füllt unser Denken die weißen Stellen auf? Mit welchen Vorannahmen geschieht es? Welche unserer Filter wirken in welcher Weise dabei mit? Das alles sind äußerst individuelle Prozesse, denn schließlich passiert es ja, dass der eine dort überhaupt keine Probleme wahrnimmt, wo ein anderer viele sieht. Wir sind in einer Art Zirkel gefangen, die Katze beißt sich in ihren eigenen Schwanz: Wir können mithilfe unseres selbst produzierten Denkens innerhalb unseres Denkapparates nur das zu beobachten versuchen, was eben dieser Denkapparat wiederum selbst hervorbringt.
Bereits der antike griechische Philosoph Epiktet reflektierte dieses Problem, als er meinte, dass es nicht die Dinge an sich sind, die uns ängstigen, sondern unsere Einstellung den Dingen gegenüber. Wie sonst könnte es sein, dass jemand hyperventiliert und umkippt, sobald er eine Kreuzspinne sieht, ein anderer aber dicke, fette Vogelspinnen richtiggehend gernhat und sie sich auf die Hand setzt?
Heinz von Förster sprach von einem unglaublichen Wunder, das hier stattfindet (von Förster/Pörksen 2006, S. 16):
„Alles lebt, es spielt Musik, man sieht Farben, erfährt Wärme oder Kälte, riecht Blumen oder Abgase, erlebt eine Vielzahl von Empfindungen. Aber all dies sind konstruierte Relationen, sie kommen nicht von außen, sie entstehen im Innern. Wenn man so will, ist die physikalische Ursache des Hörens von Musik, daß einige Moleküle in der Luft ein bißchen langsamer und andere ein bißchen schneller auf das Trommelfell platzen. Das nennt man dann Musik. Die Farbwahrnehmung entsteht in der Retina; einzelne Zellgruppen errechnen hier, wie ich sagen würde, die Empfindung der Farbe. Was von der Außenwelt ins Innere gelangt, sind elektromagnetische Wellen, die auf der Retina einen Reiz auslösen und im Falle von bestimmten Konfigurationen zur Farbwahrnehmung führen.“
Diese Phänomene des Erkennens sind selbstverständlich nicht nur auf physikalische Wahrnehmungen wie die eben beschriebenen beschränkt. Sie beziehen sich auf alles, was wir tun. „In diesem Sinn werden wir ständig festzustellen haben, dass man das Phänomen des Erkennens nicht so auffassen kann, als gäbe es ,Tatsachen‘ und Objekte da draußen, die man nur aufzugreifen und in den Kopf hineinzutun habe. […] Die Erfahrung von jedem Ding ,da draußen‘ wird auf eine spezifische Weise durch die menschliche Struktur konfiguriert, welche ,das Ding‘, das in der Beschreibung entsteht, erst möglich macht“ (Maturana/Varela 1987, S. 31).
Der eben zitierte Humberto Maturana spricht von autopoietischen Systemen, d. h. von Systemen, die sich dadurch auszeichnen, dass sie sich andauernd selbst erzeugen. Das lebende System steht also in direkter Wechselwirkung nur mit sich selbst, mit seinen inneren Zuständen, und nicht mit den Objekten der Außenwelt: Es handelt sich um ein sogenanntes selbstreferenzielles System. Diese Überlegungen führen natürlich weg von Abbildtheorien. „Unsere Wirklichkeit ist kein objektives Abbild der Realität, sondern ein Produkt unseres Erkenntnisapparates und damit unsere Konstruktion“ (von Ameln 2004, S. 65).
Aber wie kommen wir dann in der Welt zurecht? Wie kommt es, dass wir als Menschen offensichtlich zumindest ähnliche Empfindungen und Wahrnehmungen haben? Selbstverständlich sind die Systeme nicht vollständig geschlossen. Dies anzunehmen wäre eine Fehlinterpretation der radikal-konstruktivistischen Annahmen. „Es gibt gar keine geschlossenen Systeme. Geschlossenheit existiert nicht.“15 Das System muss offen sein für die Interaktion mit seiner Umwelt. Daraus kann aber nicht der Schluss gezogen werden, dass wir die Welt so erkennen können, wie sie „ist“.
Wir finden uns in der Welt zurecht wie ein blinder Waldläufer, der durch Versuch und Irrtum seinen Weg findet – einen möglichen Weg aus einer Reihe von vielen:16
„Ein blinder Wanderer, der den Fluß jenseits eines nicht allzu dichten Waldes erreichen möchte, kann zwischen den Bäumen viele Wege finden, die ihn an sein Ziel bringen. Selbst wenn er tausendmal liefe und alle die gewählten Wege in seinem Gedächtnis aufzeichnete, hätte er nicht ein Bild des Waldes, sondern ein Netz von Wegen, die zum gewünschten Ziel führen, eben weil sie die Bäume des Waldes erfolgreich vermeiden. Aus der Perspektive des Wanderers betrachtet, dessen einzige Erfahrung im Gehen und zeitweise Anstoßen besteht, wäre dieses Netz nicht mehr und nicht weniger als eine Darstellung der verwirklichten Möglichkeiten, an den Fluß zu gelangen [...]. In diesem Sinne ,paßt‘ das Netz in den ,wirklichen‘ Wald, doch die Umwelt, die der blinde Wanderer erlebt, enthält weder Wald noch Bäume, wie ein außenstehender Beobachter sie sehen könnte.“
In diesem Sinn gibt es also keine Realität, die wir erkennen könnten, sondern ein Passungsverhältnis: Mit Viabilität bezeichnet Ernst von Glasersfeld diese Passung von Wirklichkeit und Realität. Das relevante Kriterium ist die Nützlichkeit des Wissens, an dem sich natürlich auch die Positionen, die sich aus dem Radikalen Konstruktivismus ergeben, messen müssen. Die konstruktivistischen Sichtweisen sind nicht wahr, sondern bestenfalls brauchbar. „Daraus folgt, dass die Lösung eines Problems nie als die einzig mögliche betrachtet werden darf; es mag die einzige sein, die wir zur Zeit kennen, aber das rechtfertigt niemals den Glauben, unsere Lösung gewähre uns Einsicht in die Struktur einer von uns unabhängig existierenden Welt“ (ebd., S. 95).
Betrachten Sie die folgende Abbildung 5: In der oberen Reihe sind zehn Kieselsteine angeordnet. Egal, ob wir sie von links nach rechts oder von rechts nach links abzählen, es bleiben zehn.17 Wenn Sie diese zehn Kiesel nehmen und in Kreisform anordnen: Es bleiben zehn.
Abb. 5: Die Kommutativität: Entdeckung oder Erfindung? Oder beides? (Eigene Darstellung)
Der Schweizer Biologe und Entwicklungspsychologe Jean Piaget schildert dieses Beispiel, um zu zeigen, dass Erkenntnis „nicht nur von Objekten, sondern auch von Handlungen, von der Koordination von Handlungen abstrahiert wird“ (Piaget 1996, S. 24). Die Ordnung ist nicht in den Kieselsteinen begründet, sondern wird hergestellt, und zwar durch Handlungen, die mit den Objekten durchgeführt werden. Die Zahl Zehn ist keine Eigenschaft der Natur. Für Piaget bedeutet das Erkennen eines Objekts, auf es einzuwirken – es bedeutet nicht, es abzubilden.
„Die Transformationsstrukturen, aus denen Erkenntnis besteht, sind nicht Abbilder der Transformationen in der Realität, sondern nur mögliche isomorphe Modelle, unter denen zu wählen die Erfahrung befähigen kann. Erkenntnis ist also ein System von Transformationen, die allmählich immer adäquater werden“ (ebd., S. 23).
Wenngleich, wie dieses Zitat zeigt, Piaget keine explizit radikal-konstruktivistischen Positionen vertritt, so gilt doch, dass in seiner Epistemologie wissenschaftliches ebenso wie nichtwissenschaftliches Denken Prozesse kontinuierlicher Konstruktion und Reorganisation darstellt und Erkenntnisprozesse nicht isoliert vom Subjekt betrachtet werden dürfen.
Klarerweise sagt Piaget aus dieser Position heraus: Wenn wir danach fragen, wie Erkenntnis entsteht, welcher Natur Erkenntnis ist, so müssen wir auch psychologische Variablen berücksichtigen.
Deshalb waren psychologische Experimente für Piaget zentral. Anhand eines Beispiels, einer Kritik Piagets an den Positionen des logischen Positivismus, sei dies erläutert. Diesem zufolge seien „Logik und Mathematik […] nichts anderes als spezielle sprachliche Strukturen“ (ebd., S. 15). Wenn dem so sei, dann dürften sich Kinder vor Beginn der Sprachentwicklung nicht logisch verhalten.
Piaget konnte experimentell nachweisen, dass Kinder logisch-mathematische Strukturen zeigen, noch bevor Sprache vorhanden ist. „Sprache erscheint in der Regel um die Mitte des zweiten Lebensjahres, aber schon vorher, gegen Ende des ersten oder Anfang des zweiten Lebensjahres, gibt es eine senso-motorische Intelligenz, eine praktische Intelligenz, die ihre eigene Logik hat – eine Logik der Aktion“ (ebd., S. 50).
Das Wesentliche an Piagets genetischer Erkenntnistheorie im Kontext des Dialogs ist wohl, dass behauptet und durch zahlreiche Experimente belegt wurde:
1. Denken ist ein Prozess kontinuierlicher Konstruktion und Reorganisation und
2. es gibt Parallelismen zwischen rationaler Erkenntnisorganisation und psychischen Formationsprozessen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass konstruktivistische Ansätze im Dialog deshalb wertvoll und als eine Art Modell nützlich sind, weil sie klarmachen, dass Erkenntnis keine Abbildfunktion darstellt und unser Denken auf individuellen Konstruktionsvorgängen beruht. Sich dessen bewusst zu sein, hilft erfahrungsgemäß enorm, unterschiedliche Positionen besser verstehen und auch die eigene „Wahrheit“ in einem relativen Licht sehen zu können.