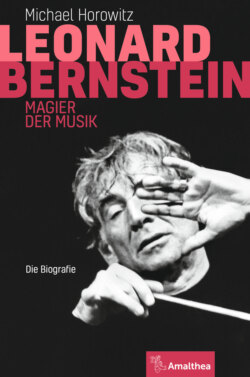Читать книгу Leonard Bernstein - Michael Horowitz - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
KAPITEL 6 Verwirklichung des Amerikanischen Traums
ОглавлениеEntweder irgendein Aussteigen aus der Gesellschaft oder ein irrer Wettlauf um den Nadelstreif mitsamt dem Zwang zum täglichen Kampf um den Erfolg in einer höchst zynisch materialistischen Weise.
Seine frühe Kindheit verbrachte Lenny in größter Armut. Doch bereits zu Beginn der 1930er-Jahre während der großen Wirtschaftskrise ging es Sam Bernstein und seiner Familie finanziell hervorragend. Elegante Mahagonibetten und wuchtige Sofas, Wandteppiche und ein echter Perser wurden als Zeichen des Erfolgs angeschafft. Und als wichtigstes Wohlstandssymbol kaufte Papa Sam das erste Auto: Einen Ford T, auch Tin Lizzie, also Blechliesel, genannt, der bis 1972 das meistverkaufte Automobil der Welt war. Zum Glück waren Sam Aktien immer suspekt gewesen, er war einer der wenigen Geschäftsleute, die nicht unter dem Börsenkrach von 1929 litten: Am Schwarzen Freitag, dem 25. Oktober, platzte eine gewaltige Spekulationsblase – und damit der Traum von Wohlstand und Reichtum für alle. Der Glaube an endlos steigende Aktienkurse war zerstört, der ökonomische Rauschzustand über Nacht vorbei, genauso wie die »Illusion vom finanziellen Fortschritt in heroischen Schritten« (Magazin Forbes). General-Motors-Direktor J. J. Raskob hatte zuvor noch behauptet: »Da sich das Einkommen tatsächlich an der Börse vermehren lässt, glaube ich fest, dass nicht nur jeder reich werden kann – sondern dass jeder dazu verpflichtet ist.« Kurz danach folgte das jähe Ende einer Illusion: Aktien als Altpapier. Aktionäre in Lumpen. Politiker in Panik. Die Weltwirtschaft stürzte ab, riss Millionen Menschen in den Bankrott und trieb Anleger in den Selbstmord. 1932 war ein Viertel aller US-Amerikaner, also rund 15 Millionen Menschen, arbeitslos. Mitte der 1920er-Jahre hatte der Dow-Jones-Aktienindex zum ersten Mal die Marke von 110 Punkten durchbrochen, die zuvor als unüberwindbar gegolten hatte. An der Wall Street gab es kein Halten mehr: Die Aktienkurse stiegen bis zum Oktober 1929 um 300 Prozent. Bis zum Schwarzen Freitag.
Doch Sam Bernstein hatte nie an die Wunder, die man an der Wall Street vollmundig versprach, geglaubt. Und glücklicherweise wollten die amerikanischen Frauen auch während der Great Depression, der schweren Wirtschaftskrise, nicht auf Dauerwellen verzichten, auf die sich Sams Hair Company, die inzwischen fünfzig Angestellte beschäftigte, neben Toupets längst spezialisiert hatte. Überall waren Sams Vertreter unterwegs, um die neue Fredericks-Dauerwellen-Apparatur – ein elektrisch betriebenes Heimgerät für Frauen, die sich keinen Friseurbesuch leisten konnten – zu verkaufen. Zuvor hatte Sam Bernstein seine Konkurrenten überboten und die Vertriebsrechte für ganz Neuengland exklusiv erhalten. Auch der Erfinder der Dauerwelle, der Deutsche Karl Nessler, ging nach dem Börsencrash des Jahres 1929 bankrott. Davor hatte der Friseur aus dem Schwarzwald allein in New York drei Dauerwellensalons betrieben, Filialen gab es in ganz Amerika: in Chicago und Detroit, Philadelphia und Palm Springs. Die ersten Wellen-Versuche wurden an Nesslers Frau Katharina durchgeführt, und zwar mittels einer Hitzezange an metallenen Wicklern, die er strahlenförmig in ihr Haar geflochten hatte. Immer wieder musste die Entwicklung der revolutionären Erfindung im Dienste der Schönheit abrupt abgebrochen werden, weil Nesslers Frau wegen der Hitze und Brandblasen am ganzen Kopf vor Schmerzen schrie. Doch irgendwann war die Dauerwelle geboren – dank ihr wurden Millionen von Frauen schön und glücklich. 1928, am Höhepunkt seines Erfolges, verkaufte Nessler sein Haarimperium und sein Wellenpatent für mehr als 1,5 Millionen Dollar, um sich zum weiteren Haarstudium in sein Labor zurückzuziehen. Den gesamten Betrag legte er in Kupferaktien an. Ein verhängnisvoller Fehler. Am Schwarzen Freitag des Jahres 1929 verlor er alles, über Nacht waren Nesslers Aktien wertlos geworden. Kurz darauf folgte der nächste Schlag: Ende 1929 brannten sein Haus und sein Labor komplett ab. Nessler konnte sein Leben nur mehr im Pyjama aus dem Haus laufend retten.
Hingegen florierte Sams Hair Company zu Beginn der 1930er-Jahre, die Verwirklichung des amerikanischen Traums, der Aufstieg des ostjüdischen Einwanderers aus kleinsten Verhältnissen, war fast filmreif: Die Familie Bernstein besaß zwei Häuser, zwei Autos und beschäftigte eine Riege von Dienstmädchen, eine Zeit lang sogar einen indischen Butler, Zeno, der gleichzeitig als Chauffeur unterwegs war – in einem Plymouth-Cabriolet (mit einem Notsitz für Mrs. Bernstein) und einer Packard-Limousine. Und für Lenny ließ der erfolgreiche Businessman Bernstein im Salon zwischen wertvollem Mobiliar einen Chickering & Sons-Flügel aufstellen.
Bereits 1927, als Lenny neun war und seine Schwester Shirley vier, war man in ein Haus in Roxbury umgezogen, in dem sich die Geschwister nicht mehr ein Zimmer teilen mussten. Wenn die Eltern ihre erbitterten Kämpfe austrugen, trösteten Lenny und Shirley einander. Die Bindung von Bruder und Schwester war enger als alle anderen Familienbande. Die Kinder beschützten einander vor dem Zorn der Eltern, und auch Jahre später, als Burtie, der jüngere Bruder Burton, noch klein war, behandelten sie ihn, als wäre er ihr Sohn.
Zu dieser Zeit erfreute man sich auch in Boston bereits am Komfort elektrischer Errungenschaften: Kühlschrank, Staubsauger, Waschmaschinen und Toaster erleichterten den Alltag. Es waren die Jahre der großen Bostoner Eröffnungen: Der Sumner Tunnel, der die Verkehrssituation entscheidend verbesserte, das mondäne Ritz-Carlton-Hotel und der Art Déco-Büroturm, das United Shoe Machinery Building. Und es waren die Jahre der Polizeikorruption und der politischen Skandale: Vier Tageszeitungen mit eigenen Morgen- und Abendausgaben berichteten (manchmal) darüber. Leonard Bernstein nannte Boston später jedenfalls die »Heimat des Puritanismus«.
1933 übersiedelten die Bernsteins in ein rotes Ziegelhaus im Stil eleganter öffentlicher Gebäude der 1920er-Jahre in der Park Avenue 86 von Newton. Das neue, geräumige Haus und der noble Bostoner Vorort mit Villen, üppigen Grünflächen und von Gaslaternen beleuchteten Straßen ließen den tüchtigen Geschäftsmann Sam Bernstein jetzt auch gesellschaftlich angesehener erscheinen. Zwei Jahrzehnte zuvor hatte Schmuel noch davon geträumt, zumindest aus der Tristesse des Stetls fliehen zu können. Jetzt war er ein erfolgreicher Bürger Amerikas und Mitglied in einem Golfclub. Doch im Pine Brook Sportclub sah man Sam selten. Während der Woche brachte er es nicht übers Herz, die Geschäfte ruhen zu lassen, und am Sabbath kam es für ihn als gläubigen Juden nicht in Frage, Golf zu spielen.
Sam Bernstein hatte es geschafft. Seine Frau Jennie war vom neuen Haus weniger begeistert, schließlich hatte sie während der letzten fünf Jahre sechsmal Umzugskisten packen müssen. Sam wollte es immer noch luxuriöser haben. Jennie nannte das neue Bernstein-Domizil eine »Arche von einem Haus«, als sie sich daranmachte, zehn Zimmer zu möblieren. »Was dem riesigen Haus an Charme fehlte, machte es durch pompöse Weiträumigkeit wett – ehemalige Ghettobewohner wussten dies mehr als alles andere zu schätzen«, stellt Lennys Bruder Burton in seinem Buch Family Matters fest.
In Sharon, an einem See rund dreißig Kilometer südlich von Boston, hatten die Bernsteins schon zuvor ein Landhaus bewohnt, an der Lake Avenue 17, direkt am Massapoag-See mit eigenem Tennis-Court. Hier verbrachte man von Juni bis September den Sommer. Papa Sam fuhr frühmorgens in die Stadt und kam erst spät am Abend zurück, die Familie konnte entspannte Zeiten verleben. Am Wochenende stand der autoritäre Vater im Mittelpunkt. Es wurde über Roosevelts Politik, die Schleuderpreise für Milch und die schulischen Leistungen Lennys diskutiert. Auch die alte Heimat, wehmütige Erinnerungen, ließen Papa Sam nie los: Statt im See zu schwimmen, mussten die Kinder nach dem Frühstück auf der Terrasse minutiöse Schilderungen über den Ursprung der Familie über sich ergehen lassen. Immer wieder erzählte Sam voller Stolz, während er beide Arme hochhob und mit den Handgelenken schlenkerte, als ob er die Manschetten zurechtrücken wollte: »Wir Bernsteins gehörten dem Stamme Benjamin an. Die Benjaminiten waren besonders tapfere Bogenschützen und aus ihren Reihen kam Israels erster König Saul.«
Leonards Bruder Burton meint in seinem Erinnerungsbuch jedenfalls: »Der Ursprung des Namens Bernstein kommt wahrscheinlich von Diasporajuden, die mit Bernstein handelten, oder von fahrenden Leuten, die zufällig durch die nahe bei Wien gelegene Stadt Bernstein kamen. (Als Lenny dann Jahre später nach Österreich kam, wo er die Wiener Philharmoniker dirigierte, wurde er zum Ehrenbürger von Bernstein ernannt. Die gesamte Bevölkerung der Stadt feierte ihn und der Bürgermeister überreichte ihm einige am Ort handgefertigte Arbeiten aus Bernstein sowie eine amtliche Kopie des Stadtwappens).«