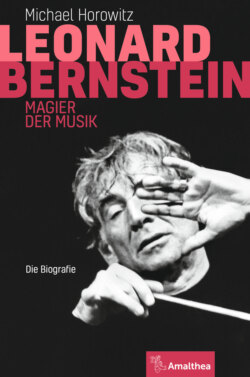Читать книгу Leonard Bernstein - Michael Horowitz - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
KAPITEL 1 Im Armenhaus der Monarchie
ОглавлениеUm sich auf die Suche nach der Wahrheit begeben zu können, muss man trunken von der Fantasie sein.
Beim Pianisten Vladimir Horowitz, mit dem der Autor dieses Buches nicht verwandt ist, liegen Dichtung und Wahrheit nah beieinander. Vladimirs Vater besaß auch viel Fantasie. Um seinem Sohn den Militärdienst zu ersparen und ihm eine Ausreisegenehmigung zu verschaffen, hat ihn der jüdische Elektroingenieur um ein Jahr jünger gemacht. Auch der offizielle Geburtsort Kiew trifft nicht zu. Vladimir wurde in der kleinen, von Pogromen heimgesuchten Stadt Berditschew geboren. Die Familie Gorowitz – auch den Namen änderte der Vater später in Westeuropa – zog erst nach der Geburt Vladimirs in das Zentrum der Ukraine, nach Kiew, um. Wenn Wolodja, das gehätschelte Musikgenie, ruhte, trugen die Eltern Filzpantoffeln. Seine Launen und melancholischen Anwandlungen wurden im Hause Horowitz gerne geduldet – man war selig, ein musikalisches Wunderkind in der Familie zu haben. Als Fünfzehnjähriger musste er erleben, dass Bolschewiken den Flügel aus dem ersten Stock des väterlichen Hauses stürzten. Das Leben wurde immer gefährdeter und gefährlicher.
Auf dem Konservatorium in Kiew erregte Vladimir sehr bald Aufsehen und Bewunderung, trotz Hochmut, Wutanfällen und entrückten Eigenheiten. Komponist Sergei Rachmaninow, selbst ein gefeierter Pianist, war vom kapriziösen Einzelgänger begeistert und meinte 1931: »Bis ich Horowitz hörte, verstand ich nichts von den Möglichkeiten des Klaviers …« Ein Jahr später fand Vladimir die Begegnung seines Lebens: Der in die USA ausgewanderte »liebe Gott unter den Klavierspielern« trifft Arturo Toscanini. Bald ist Vladimir Horowitz sein Lieblingssolist – und Schwiegersohn und entwickelt sich zu einem der schillerndsten Musiker des 20. Jahrhunderts.
Launen, Marotten und das ewige Flirten mit der Einmaligkeit seiner Genialität prägen sein Leben: »Wenn ich spiele, bin ich Engel und Teufel zugleich.« Er schläft bis mittags in komplett verdunkelten Räumen und gibt Konzerte nur um vier Uhr nachmittags. Der bekennende Hypochonder reist mit einer Mini-Wasserdesinfektions- und Entkalkungsanlage um die Welt, mit eigenem Bettzeug und tiefgefrorenen Hühner- und Seezungenfilets. Das Musikgenie aus dem Stetl in Galizien pflegt ein Leben lang das Image vom kapriziösen Klavierakrobaten: »Ich fühle mich wie ein Gladiator, der im Kolosseum vor einem blutgierigen Publikum kämpfen muss.« Als eine Verehrerin von Vladimir Horowitz auf der New Yorker Fifth Avenue fragte, ob sie ihn berühren dürfe, schäkerte der Adorierte: »Das kommt darauf an, wo …«, und ließ sich die Hände küssen. Im Mai 1987 tröstet das 82-jährige »senile Wunderkind« Besucher, die für das Konzert im Großen Musikvereinssaal keine Karten mehr ergattern konnten: »In fünfzig Jahren komm’ ich sowieso wieder …« Zwischen seinem ersten und zweiten Wien-Gastspiel waren sogar 52 Jahre vergangen.
Die Erinnerung an Leid, Demütigung und Unterdrückung im »Armenhaus der Monarchie« blieb für viele jüdische Künstler ein Leben lang präsent. Und so mancher versuchte, traumatische Erinnerungen, die tragische Familiengeschichte im Stetl, ein Leben lang zu kompensieren. Sie blieben »überall als Fremdling kenntlich, das Pathos des Außenseiters im Herzen«, wie es Thomas Mann 1907 formulierte, von Ängsten geplagt, von Ehrgeiz getrieben, von Depressionen gepeinigt. Man versuchte oft, das Leid der Kindheit, der Jugend wettzumachen: durch entrückte Besessenheit, durch manische Lebensgier, durch hemmungslose Exzesse. Oft auch hinter einer Maske der Arroganz in einem prallen, wilden, glanzvollen – und oft traurigen – Leben.
In Polen und Russland mussten während der ersten Pogrome zwischen 1881 und 1914 rund drei Millionen Juden ihre Heimat verlassen. Fast jeder Dritte davon war Musiker. Jüdische Emigranten, die während der ersten drei Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts im westlichen Musikbetrieb für Furore sorgten, waren die Dirigenten Otto Klemperer, Fritz Reiner, George Szell und Bruno Walter und Instrumentalisten wie Jascha Heifetz und Vladimir Horowitz, Nathan Milstein und Artur Rubinstein, Menschen und Musiker voller Witz, Sentimentalität und Schwermut, oft auch gepeinigt von inneren Kämpfen und Zerrissenheit, mitunter auch von Beziehungsschwierigkeiten.
Die »Spezialität der Melancholie« (Joseph Roth) versuchte auch Vladimir Horowitz ein Leben lang zu überwinden. Er stammte aus dem »wilden Osten«, dem äußersten Nordosten der Donaumonarchie, wie auch Moses Joseph Roth, der Poet des sterbenden Habsburgerreichs, der in der galizischen Provinzstadt Brody geboren worden war. Bis zur russischen Grenze waren es kaum zehn Kilometer, aber mehr als 800 in die imperiale Hauptstadt Wien. Von 1772 bis 1918 war Galizien das größte Kronland der Monarchie. Seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert herrschte hier bittere Armut, jährlich starben mehr als 50 000 Menschen den Hungertod.
Seine literarischen Arbeiten verfasste Moses Joseph Roth als Joseph Roth. Wollte er durch das Weglassen des Vornamens Moses, den er seinem Urgroßvater, einem Steinmetz, verdankte, nicht als Jude erkennbar sein? Doch seine Heimat in Galizien an der österreichisch-russischen Grenze ließ den ruhelos durch die Welt ziehenden Joseph Roth nie los. Der auch hier geborene Schriftsteller Karl Emil Franzos nennt Galizien, den letzten Vorposten europäischer Kultur, einen von polnischen Feudalherren beherrschten, fruchtbaren Landstrich, »Halbasien«. Deutsche, Armenier, Ungarn und viele andere Volksgruppen prägten den Alltag. »Der Wind, der über Galizien weht, ist bereits der Wind der Steppen, bereits der Wind von Sibirien«, schrieb Joseph Roth.
Immer wieder kam es zu Spannungen, Kriegen und Grenzverschiebungen, sodass die Region ständig wechselnden Staatsgebilden angehörte. Ohne sich nur einen Zentimeter von der Stelle gerührt zu haben, fanden sich Familien als minder geachtete Bewohner der russischen Ukraine wieder. Die dunkelsten Momente in der Geschichte dieses Zwischenreichs waren die Demütigung und Unterdrückung der Juden – bis hin zu den Pogromen, den Massakern an der jüdischen Bevölkerung. Allein im Umkreis von Ternopil wurden während der Kriegsjahre 200 000 Juden ermordet. Rund sechzig Kilometer westlich von der einstigen Hauptstadt Krakau entfernt, liegt das Vernichtungslager Auschwitz.
Im 1924 erschienenen Essay Reise durch Galizien schildert Joseph Roth noch voller melancholischer Sehnsucht seine Heimat, die untergegangene Welt der osteuropäischen Juden, die sein Denken und Empfinden ein Leben lang prägte: »Auf den Märkten verkauft man primitive, hölzerne Hampelmänner wie in Europa vor 200 Jahren. Hat hier Europa aufgehört? Galizien liegt in weltverlorener Einsamkeit und ist trotzdem nicht isoliert; es ist verbannt, aber nicht abgeschnitten; es hat mehr Kultur, als seine mangelnde Kanalisation vermuten lässt; viel Unordnung und noch mehr Seltsamkeit. Viele kennen es aus der Zeit des Krieges, aber da verbarg es sein Angesicht. Es war kein Land. Es war Etappe oder Front. Aber es hatte eine eigene Lust, eigene Lieder, eigene Menschen und einen eigenen Glanz; den traurigen Glanz der Geschmähten.«
Joseph Roth hatte durchdringende, listige Augen eines Beobachters, Jägers, Reporters, eines Romantikers mit dem scharfen Blick eines Realisten. Er schrieb nicht nur viel, er trank auch viel. Zu viel. Die Getränke konnten nicht scharf genug sein. Der Alkohol, mit dem sich der große Dichter betäubte, beendete sein Leben. »Er hatte Glück bei den Frauen und wenig Glück mit ihnen«, meinte sein Freund, der Essayist Hermann Kesten, »… er beherrschte die Sprache wie Rastelli seine Bälle, wie Paganini seine Geige«.
Personal musste oft Frau, Familie und Freunde ersetzen, wie etwa die junge Wirtin in dem kleinen Café in der Pariser Rue de Tournon, die den kranken Poeten wie einen Freund betreute. In einer Lade unter der Schank verwahrte sie bis zu seinem Ende sorgsam seine Dokumente und Manuskripte. Winselnd vor süchtigem Verlangen, starb Joseph Roth 45-jährig in einem Pariser Armenspital. Ein Heimatloser voller Weltschmerz, ein ewig Rastloser, »… wissend und hoffnungslos. Man ist durch ein Feuer gegangen und bleibt gezeichnet für den Rest seines Lebens.«