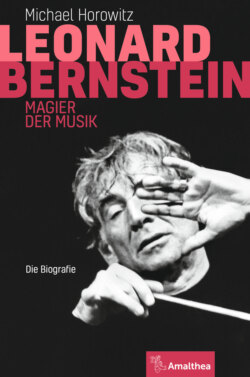Читать книгу Leonard Bernstein - Michael Horowitz - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
KAPITEL 3 Jüdisches Penicillin
ОглавлениеIch glaube, ich hätte ein ganz annehmbarer Rabbiner werden können. Doch davon konnte keine Rede sein, denn Musik war das Einzige, was mich erfüllte.
Im Frühjahr 1912 erhielt Sam in seiner winzigen Unterkunft an der New Yorker unteren Eastside Post von Onkel Harry, der ihn nach Hartford in Connecticut einlud. Gemeinsam wolle man Pessach, das jüdische Osterfest, feiern. Und Harry deutete in dem Brief auch an, dass Sam vielleicht in Hartford bleiben könne, um in seinem Friseurgeschäft zu arbeiten. Der Laden liefe gut, inzwischen verkaufe man auch Zöpfe und Damenperücken. Der vom Schmutz und Gestank am Fulton Street Market frustrierte Sam fuhr bereits am nächsten Tag mit dem Zug nach Hartford. Bald begann er im Frisiersalon des Onkels als Lehrling zu arbeiten. Er befreite den Boden von Haaren, säuberte Kämme und Scheren und wusch Arbeitsmäntel – auch nicht gerade der Traumjob für Sam im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, aber noch immer besser, als zwölf Stunden pro Tag Fische auszunehmen.
Eines Tages bemerkte der Vertreter der New Yorker Firma Frankel & Smith – Lieferanten von Friseur- und Kosmetikartikeln – den Lehrbuben in Onkel Harrys Geschäft und engagierte ihn für die neue Filiale in Boston als Lagerarbeiter. Eine baldige Beförderung hinge nur vom Fleiß des jungen Mannes ab. Haarteile boomten, das Geschäft blühte auch in Boston. Sam sortierte Bündel von Menschenhaar, das aus Asien importiert wurde. Nach der chemischen Reinigung wurde das Haar für modebewusste Amerikanerinnen in Perücken geflochten. Sams Aufstieg begann. Bald war er einer der erfolgreichsten Mitarbeiter bei Frankel & Smith. Und bald gründete er eine eigene Firma – die Samuel Bernstein Hair Company.
1916, er war nun 24 Jahre alt, amerikanischer Staatsbürger und hatte einiges zusammengespart, konnte er langsam an die Gründung einer Familie denken. Der steife weiße Kragen sowie seine dunklen dreiteiligen Anzüge und der geglättete schwarze Lockenschopf ließen ihn wie einen jungen Mann auf dem Weg nach oben aussehen. Sam Bernstein hatte es geschafft. Im Frühjahr 1917 trat Amerika in den Krieg ein, Sam wurde in die Armee eingezogen. Doch wegen seiner Kurzsichtigkeit wurde er ehrenhaft entlassen. Ein paar Monate später, an einem Sonntag im Herbst, heiratet Sam Bernstein die neunzehnjährige Jennie Resnick. Auf ebenso abenteuerliche Weise wie er war Jennie bereits im Alter von sieben Jahren mit ihren Eltern aus einem Stetl ganz in der Nähe der Heimatstadt Sams nach Amerika gekommen. Früh hatte Jennie in einer Fabrik zu arbeiten begonnen und sie besuchte mehrmals pro Woche eine Abendschule, um Englisch zu lernen. Die Resnicks lebten in Lawrence, vierzig Kilometer nördlich von Boston. Jahre nach der Trauung behauptete Jennie, ihre Mutter hätte eine Verlobungsfeier organisiert und den Tag der Hochzeit fixiert, ohne der Tochter irgendetwas zu sagen. Einer bescheidenen Feier in der Synagoge folgte jedenfalls ein aufwendiges Fest im Hause Resnick. Tagelang bereitete die Familie unter den strengen Anweisungen von Mama Pearl Spezialitäten der ostjüdischen Küche zu: Gefillte Fisch (Karpfen mit Fischinnereien gefüllt), Borscht (Rote-Rüben-Suppe), jiddischen Kaviar (Hühnerleber mit Zwiebel und Gänseschmalz), Latkes (Erdäpfelpuffer) und vorbeugend fürs ganze Leben einen Riesentopf Hühnersuppe, jewish penicillin.
Die Flitterwochen nach dem üppigen Gelage bestanden aus einer einzigen schlaflosen Nacht im Essex Hotel im Zentrum von Boston. Der Lärm der Züge des nahen Bahnhofs hielt die beiden wach. Jennie musste jedoch ihrer streng religiösen Mutter versprechen, die Ehe nicht zu vollziehen. In der Hektik der Hochzeitsvorbereitungen hatte die Mutter vergessen, mit ihrer Tochter in die Mikwe, zum rituellen Reinigungsbad, zu gehen. Bereits am nächsten Tag zogen die Brautleute in eine winzige Wohnung im Armenviertel Mattapan ein. Hier konnte man schließlich die Hochzeitsnacht nachholen. Zehn Monate später kam das erste Kind der Bernsteins zur Welt. Als der Erstgeborene erwartet wurde, wollte Jennie bei ihrer Familie sein. Daher kam Leonard Bernstein am Sonntag, dem 25. August 1918 in Lawrence zur Welt. Die 100 000-Einwohner-Stadt galt als Immigrant City, weil viele Menschen aus Kanada, Irland und Italien, Litauen und Polen hierherkamen, um Arbeit zu finden. Trotz seiner damaligen geringen Fläche von nur 15,5 km2 hatte Lawrence mehr Einwanderer pro Einwohner als jeder andere vergleichbar große Ort der Welt.
Ursprünglich wurde das erste Kind der zwanzigjährigen Jennie Bernstein nach ihrem Zayde, dem Großvater, Louis genannt – das blieb sein Name, bis sich der sechzehnjährige Bernstein das Auto der Mutter ausborgte und mit seinem frisch erworbenen Führerschein von Boston nach Lawrence fuhr, um seinen Vornamen offiziell in Leonard ändern zu lassen. Zu Hause wurde er schon längst Len oder Leonard genannt, und vor allem Lenny. Fast wäre Leonard Bernstein auf dem Küchenboden zur Welt gekommen. Als um drei Uhr morgens die Wehen einsetzten, rief die Mutter den Hausarzt an. Doch noch bevor dieser eintraf, platzte die Fruchtblase. Um die Nässe aufzusaugen, schob die Mutter alte Zeitungen unter den angespannten Körper Jennies. Bald erschien der Arzt und brachte die Gebärende unter heftigen Wehen ins Allgemeine Krankenhaus von Lawrence. Gegen ein Uhr mittags – Jennie erinnerte sich an die Wanduhr in der Entbindungsstation – kam der Bub zur Welt, ein schwächliches, von Heuschnupfen und Asthmaanfällen geplagtes Kind, das sehr viel Zeit seiner Kindheit bei Ärzten und in Spitälern verbringen musste. Wenn Lenny nur nieste, wurden die Eltern schon blass vor Angst, wenn er wegen seines Asthmas plötzlich blau anlief, dachten sie jedes Mal, der Bub würde es nicht überleben. Nächtelang blieb die Mutter wach, hielt heiße Tücher und Töpfe mit dampfendem Wasser bereit, um ihm das Atmen zu erleichtern. Immer wieder litt Lenny auch an Koliken, vom Vater hatte er einen empfindlichen Magen geerbt. Die erste Frage Sams, sobald er spätabends aus dem Geschäft kam, war immer: »Wie geht’s Lenny?«