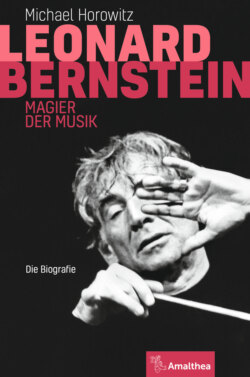Читать книгу Leonard Bernstein - Michael Horowitz - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
KAPITEL 2 Fischmarkt als Universität
ОглавлениеDas Leben ist ein dauerndes Bemühen.
Bei Leonard Bernsteins Familie kann – anders als bei Familie Horowitz und ihrem Potpourri aus Dichtung, Fantasie und Wahrheit – die Abstammung bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts zurückverfolgt werden. Der Name Bernstein stammt vermutlich von früheren Bernsteinhändlern. Vorfahren waren Rabbiner und Schriftgelehrte, Leonards Urgroßvater Bezalel, um 1840 geboren, war Hufschmied. Weithin wurde der fromme, gesellige und wodkaliebende Handwerker geschätzt und respektiert: Er war so stark, dass er ganz allein eine Droshky, eine Kutsche, heben und ein Rad wechseln konnte. Als knapp Dreißigjähriger kam er bei einem Feuer in seiner Werkstatt ums Leben. Die Nachricht vom tragischen Tod des vierfachen Familienvaters verbreitete sich rasant.
Man lebte in der Kleinstadt Beresdiw, in einem der Stetln Osteuropas, innerhalb eines Ansiedlungsrayons der Provinz Wolhynien zwischen Kiew und Rowno am Ufer des Kortschik, einem der Gebiete, das der jüdischen Bevölkerung Wohn- und Arbeitsrecht zugestand. Das Toleranzedikt der liberalen Katharina II. von 1773 hatte noch irgendwie Gültigkeit: »Humanitäre Grundsätze erlauben es nicht, dass einzig die Juden von der Gunst, die allen gewährt wird, ausgeschlossen bleiben, sofern sie sich wie bisher, als getreue Untertanen dem Handel und Handwerk widmen …« Dennoch litt die jüdische Bevölkerung jahrhundertelang unter Schikanen. Antisemitismus war salonfähig, das Ghetto wurde zur Institution.
Wenn man aus dieser bedrohlichen Stetlatmosphäre ausbrechen wollte, waren die Möglichkeiten sehr begrenzt. Es gab den Traum von Amerika, die Illusion Südafrika und Lateinamerika, wo die Einwanderung von Juden erlaubt, manchmal sogar erwünscht war. Der kürzere Weg in ein anderes europäisches Land war zumeist nur mit Ablehnung verbunden. Ein mittelloser Jude aus dem fernen Galizien war nicht willkommen. Die Mutigsten beschlossen, den langen Weg nach Amerika zu wagen. Während der letzten zwei Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts verließ mehr als eine Million Juden Russland, um in den Vereinigten Staaten ihr Glück zu suchen.
Leonard Bernsteins Vater Schmuel Josef wollte wie sein Vater und wie viele seiner früheren Vorfahren Rabbiner werden. Er war ein Mensch voll glühender Frömmigkeit, das Textbuch seines Lebens war der Talmud – die Sammlung der wichtigsten jüdischen Religionsgesetze –, den Schmuel als Wegweiser, als oberste Richtschnur sittlicher und gesellschaftlicher Moral empfand. »Wenn er eine Rede halten soll, beginnt er unweigerlich mit einem Talmud-Zitat. Er übergeht ihn auch nicht im täglichen Gespräch …«, erinnerte sich Leonard Bernstein in einem Aufsatz für das Gymnasium in Boston im Februar 1935, »… der Talmud ist sein unfehlbares Konversationslexikon … Er findet größeres Vergnügen an den vielen Geschichten, die der Illustration biblischer Feinheiten dienen, als an irgendeinem Roman. Er kennt kein einziges englisches Gedicht, weil ihm die Musik der talmudischen Prosa genug Zerstreuung bietet.«
Doch die Verlockung der weiten Welt, die Sehnsucht des jungen Schmuel Bernstein nach dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten, war grenzenlos. 1903 floh sein Onkel Herschel Malamud gerade rechtzeitig vor Ankunft der zaristischen Stellungskommission – als Soldaten des Zaren mussten auch Juden dienen – aus seiner Heimatstadt Korez. Entschlossen begab er sich auf die ungewisse Seereise. Als Onkel Herschel in einem Brief berichtete, dass er in Hartford, einer Stadt in Connecticut, gelandet sei und als Friseurlehrling Woche für Woche einige Dollar verdiene, wusste Schmuel Josef, der seine Bar Mizwa schon hinter sich hatte, dass auch er die waghalsige Flucht unternehmen musste. Unter allen Umständen. Er erkundigte sich bei den Fluchthelfern seines Onkels, wie man sich über die Grenze nach Preußen und Danzig stehlen konnte, wie man Kontakt mit der jüdischen Hilfsorganisation aufnahm, um das Geld für die Überfahrt nach Amerika zu bekommen – und wie man sich über Wasser hielt, wenn man schließlich angekommen war.
Schmuels Familie erfuhr von den Fluchtplänen. Man weigerte sich entschieden, ihn ziehen zu lassen. Als ältester Sohn hatte er zu Hause zu bleiben und für die Familie den Lebensunterhalt zu sichern. Und irgendwann würde er ja sowieso Rabbi werden. »Was konnte Amerika ihm bieten? Nichts außer primitiven Menschen und wilden Tieren. Er würde kaum bis Danzig kommen. Und selbst dann würde ihn der Ozean verschlingen …«, berichtet Burton Bernstein, der jüngere Bruder Leonards, achtzig Jahre später im Buch Family Matters über die Bedenken der Verwandten. Was hätte die Familie damals im Stetl am Ende der Welt bloß gesagt, wenn sie geahnt hätten, dass Burton, Autor des Magazins New Yorker, einer der Kandidaten für eine (abgesagte) Journalistenreise in den Weltraum war.
1908 traf aus Connecticut ein Brief des Onkels Herschel Malamud – der seinen Namen längst amerikanischen Verhältnissen angepasst und auf Harry Levy geändert hatte – an den sechzehnjährigen Schmuel ein. Im Kuvert befand sich auch etwas Geld. Genug, um bis Danzig und vielleicht auch auf ein Schiff zu gelangen. Schmuel war für das Abenteuer seines Lebens bereit: In eine zusammengerollte Decke packte er ein paar Kleidungsstücke. Er verabschiedete sich von seinem Bruder und seinen Schwestern und musste schwören, aus Amerika bald Geld zu schicken, damit sie ihm nachkommen konnten. Der drei Jahre alte Bruder Schlomoh weinte bitterlich. Er wollte unbedingt mitkommen. Voller Angst und Schuldgefühl wagte Schmuel nicht, sich von seinen Eltern zu verabschieden, und schlich sich nachts aus dem kleinen Haus in Beresdiw.
Zu Fuß ging es unter Umgehung sämtlicher Grenzposten quer durch Polen in westliche Richtung – mit Brot und Erdäpfeln von Verwandten als Proviant. Richtung Danzig. Die große Hafenmetropole an der Ostsee, damals die Hauptstadt von Westpreußen, war schon immer Dreh- und Angelpunkt für die großen Auswanderungswellen osteuropäischer Juden gewesen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts kannten sie nur ein Ziel: Amerika! Später auch Kanada und Palästina. Zwischen 1919 und 1925 emigrierten mehr als 60 000 Juden über den Danziger Hafen. Arbeiter, Handwerker und ziehende Händler, die zuvor im Armenhaus der Monarchie mit Socken und Schuhbändern, Knöpfen und Leinenballen hausiert hatten.
In der großen, beeindruckenden Stadt Danzig kaufte sich Schmuel ein Ticket für das Zwischendeck eines Transatlantikdampfers, dessen Endstation Liverpool sein sollte. Dort hoffte er, von einer jüdischen Hilfsorganisation Geld für die Überfahrt nach New York zu bekommen. Geprägt von Angst und Zweifel begann die zwei Wochen dauernde Schiffsreise in die Zukunft des sechzehnjährigen Schmuel Bernstein, der von Anfang an auf der Fahrt durch die raue Ost- und Nordsee seekrank war. Bis zum Schluss blieb es ungewiss, ob das Schiff jemals sein Ziel erreichen würde.
Schließlich legte der überfüllte, von Wanzen befallene Dampfer in Liverpool an. Man bot den erschöpften Emigranten nach Wochen mit verdorbenem Essen Gemüsesuppe an. In einer Lagerhalle am Hafen durften sie übernachten. Die hygienischen Missstände und das Ungeziefer im Bauch des Schiffs blieben Papa Bernstein ein Leben lang in Erinnerung: Regelmäßig musste seine Frau noch Jahrzehnte nach dem Zwischendeckaufenthalt im Jahre 1908 penible Reinlichkeitsfeldzüge durchführen. Sobald er verschüttetes Essen im Kühlschrank oder eine einzelne Ameise entdeckte, erschütterte ein Zornanfall das Haus.
Am nächsten Morgen bestieg Schmuel den Auswanderungsdampfer mit dem heiß ersehnten Ziel Amerika. Nach wilden Wochen auf der Fahrt über den Atlantik erreichte das Schiff die überfüllte, chaotische Einwanderungsstelle Ellis Island. Irgendwie fand Onkel Harry Levy den erschöpften, aber überglücklichen Schmuel. 25 Dollar als Bürgschaft für den neuen Amerikaner hatte er zuvor schon hinterlegt. Bald bekam auch Schmuel einen passenden Namen: Sam. Wie sein Onkel Jahre zuvor begann er im Land der unbegrenzten Möglichkeiten ganz unten auf der Karriereleiter: Er nahm auf dem Fulton Street Market gegenüber von Manhattan Barsche und Dorsche, Heringe und Makrelen aus. Hier war die erste Anlaufstelle vieler Einwanderer: Es wurde nicht lange gefragt, man bekam ein scharfes Messer und einen Fischschupper in die Hand gedrückt. Gruppen von zehn Männern standen um die Metalltische. Alle paar Minuten dröhnte ein donnerndes Geräusch durch die Halle: Die nächste Lawine von Fischen schoss sintflutartig von oben auf den Tisch. Mit durchtränkten Schuhen in glitschiger Brühe watend, auf Haut, Haaren und Arbeitskleidung Fischblut und -eingeweide: Der Aufstieg für den schmächtigen Sechzehnjährigen auf der amerikanischen Erfolgsleiter konnte beginnen.
Er arbeitete von sechs Uhr früh bis sechs Uhr abends an sechs von sieben Tagen inklusive des Samstags, des jüdischen Sabbats, für einen Wochenlohn von fünf Dollar. Zu Mittag gab es eine Portion Salzheringe. Nicht nur in der kurzen Mittagspause träumte Sam von einer Karriere als Briefträger. Doch beim Bewerbungsgespräch versagte er. Später bezeichnete Sam Bernstein den Fulton Fischmarkt immer wieder als »meine Universität«. Beim Ausnehmen und Schuppen der Fische lernte Sam Bernstein, wie man von fünf Dollar pro Woche leben konnte, und seine ersten Brocken Englisch, hörte hitzige Argumente für die Demokraten und lernte auch, wie man Freunde gewinnen und Menschen beeinflussen konnte. Er entdeckte immer mehr, dass in Amerika alles möglich war.