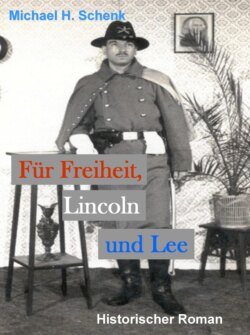Читать книгу Für Freiheit, Lincoln und Lee - Michael Schenk - Страница 4
Kapitel 2 Der lange Marsch
ОглавлениеObwohl Gottfried Wenzel ihnen davon abgeraten hatte, wollten die Brüder sich von ihren Eltern verabschieden. Auch wenn einer von ihnen in der nächsten Zeit ohnehin den Hof hätte verlassen müssen, da dieser nicht genug Ertrag brachte, so fiel es ihnen doch gleichermaßen schwer, Hof und Heimat aufzugeben. Friedrich wäre es leichter gefallen, wenn Friederike ihn begleitet hätte, doch so erschien es den drei Brüdern, als sollten sie nun die letzte Brücke zur Heimat hinter sich abschlagen. Ihren Eltern würde es sicher nicht anders ergehen. Daher mussten sie zu diesen, um zu beweisen, dass es ihnen gut ging, und dass die Brüder halt in die ungewisse Fremde mussten, damit es aller Wahrscheinlichkeit nach auch so blieb.
Die Brüder Baumgart machten sich keine besonderen Sorgen um die eigene Zukunft, denn sie sagten sich, ein paar kräftige Arme werde man halt überall brauchen können. Auf dem Hof der Eltern wollten sie ein paar Sachen packen. Ein wenig Wäsche zum Wechseln, etwas für den Schnappsack, vielleicht hatte ihr Vater sogar ein paar Pfennige für sie. Letzteres glaubten sie kaum, denn vom Ertrag des kargen Bodens fraß die Steuer den größten Teil. Dabei hatte ihr Vater noch Glück gehabt kein Pachtbauer zu sein. Nach dem großen Krieg gegen den Kaiser der Franzosen war er mit einer Auszeichnung und der Besitzurkunde für das Land heimgekehrt.
Doch aus ihrem Vorhaben wurde nichts.
Schon von Weitem sahen sie ungewöhnliches Blitzen auf dem Hof. Als sie vorsichtig näher ritten, erkannten sie eine kleine Patrouille preußischer Kürassiere, die hier ein Biwak aufgeschlagen hatten. Sie konnten die langen Rosshaarschweife der Helme und die metallenen Brustpanzer der Reiter deutlich sehen.
„Wir sollten warten, bis sie abgezogen sind“, schlug Karl vor. „Sie können ja nicht lange bleiben.“
Friedrich erkannte ihren Vater, der mit einem Kürassier sprach. Der Anblick schmerzte ihn. Zu gerne wäre er einfach hinüber gegangen und hätte seinen Vater in die Arme genommen. Der Reiter schien Offizier zu sein.
„Sie werden nicht abziehen“, sagte Hans. Er hatte seine Augen beschattet und blickte angestrengt zu dem ärmlichen Haus, wo ein anderer Soldat an der Tür hantierte.
„Wie kommst du darauf?“ Karl nahm seinen Zweispitz ab und wischte Schweiß von der Stirn.
„Sie machen Quartier“, sagte Hans seufzend. „Der Kürassier an der Tür macht Zeichen mit Kreide.“
Das kannten sie noch von ihrem Dienst in Hauptmann Wenzels Kompagnie. Auch da hatte der Quartiermeister mit Kreide an die Türpfosten geschrieben, wie viele ihrer Männer ein Haus aufzunehmen hatte. Die Leute, die ihnen mehr oder minder freiwillig Quartier boten, waren oft genug mit Wechselscheinen der Republik abgegolten worden. Solchen, die nun keinen Wert mehr hatten.
„Dann erwarten sie eine größere Abteilung. Der Teufel soll sie holen. Warum machen sie das ausgerechnet bei uns?“ Karl fluchte ausgiebig, bis Friedrich ihn mahnend anstieß.
„Du sollst dich nicht versündigen gegen den Herrn.“ Friedrich wies zum Hof hinüber. „Vielleicht wollen die Reiter von hier aus patrouillieren. Sind bestimmt auf der Hatz nach den unserigen.“
„Und nach uns.“
So wandten sie dem elterlichen Hof und der alten Heimat den Rücken.
Sie ritten abseits der Straßen zwischen den Weinbergen hindurch nach Frauenstein. Es lag nur rund sieben Kilometer südwestlich von Wiesbaden. Oben, auf dem Hohenstein, der sich über den Ort erhob, machten sie Rast. Von hier hatten sie einen guten Ausblick über den Ort und die Straße, die sich durch Frauenstein hindurch in den Rheingau erstreckte. Sie sahen die Ruine der Burg unter sich. Auf der anderen Seite lag der Rhein und am gegenüberliegenden Ufer konnten sie gerade noch Mainz erkennen.
Sie sattelten ab und die Pferde fanden genug Grün, um es auszuzupfen und genüsslich zu kauen. Hans sah ihnen neidisch zu und der knurrende Magen ließ ihn selbst ein paar Halme probieren, bevor er sie mit einem missmutigen Laut ausspuckte.
„Wie sollen wir es halten?“, fragte Karl ächzend. Er hockte sich auf einen Stein und zog einen der Schuhe aus. Mit erleichtertem Gesichtsausdruck fischte er einen kleinen Stein hervor und warf ihn achtlos hinter sich. „Wir müssen rüber. Sollen wir es hier versuchen oder nach Koblenz hinüber? Wir könnten uns bei Bingen übersetzen lassen.“
Friedrich kratzte sich am Vollbart. „Von was sollen wir die Fährleute bezahlen? Und in Koblenz sind die Truppen des Großherzogs. Die werden sich jedes Gesicht genau ansehen.“ Er blickte Karl ironisch an. „Und jeden Hut.“
„Es gibt viele wie uns. Gerade jetzt“, sagte Karl verdrießlich. „Leute von uns und solche auf der Walz. Oder solche, die anderswo ihr Auskommen suchen. Da wird man nicht auf unsere Gesichter achten. Und den Hut behalte ich.“
„Mag sein.“ Friedrich nickte langsam. „Aber wir sollten es hier versuchen. Wenn wir bei Mainz über die Brücke sind, dann wenden wir uns nach Kaiserslautern rüber, durch die Pfalz.“ Er deutete auf die verblichene Kokarde an der Kopfbedeckung des Bruders. „Und den Hut solltest du zumindest abnehmen. Steck ihn dir sonst wo hin. Aber behältst du ihn auf dem Kopf, dann fehlt dieser dir beizeiten.“
„In Mainz stecken auch die Preußen“, warf Karl ein.
Friedrich zuckte die Achseln. „Wo stecken die nicht? Gott, es sind doch überall die Soldaten. Von welchem König oder Fürsten auch immer. Ich sage, wir ziehen durch die Pfalz. Die Mosel runter nach Westen. Hinab ins Saarland und ins Land der Franzosen.“
„Und wenn wir rauf gehen, nach Hamburg? Und dort ein Schiff nehmen? Von dort fahren sie doch nach Amerika.“ Hans zupfte erneut einen Grashalm aus und begann darauf zu kauen. „Oder ins bayerische hinunter. Die Bayern sind keine Freunde der Preußen. Die haben sich ordentlich mit denen geschlagen.“
„Auch die haben einen König“, knurrte Karl. „Von da müssten wir nach Toulouse oder nach Triest. Mann, wisst ihr überhaupt, wie gewaltig da die Berge sind?“
„Lassen wir das. So oder so wird es hart.“ Friedrich erhob sich. „Wenn wir uns ranhalten, dann erreichen wir die Brücke nach Mainz in der Abenddämmerung. Da achtet man nicht so auf Gesichter. Und wenn wir erst im pfälzischen sind, dann schlagen wir uns ins Hinterland. Über Kreuznach nach Idar-Oberstein und Birkenfeld. Wisst ihr noch? Der Mayer? Der war Schleifer in Idar-Oberstein, bevor er nach Frankfurt kam.“
Der Mayer? Ja, denn hatten die Soldaten auf der Barrikade vor der Paulskirche erschlagen. Aber die Brüder konnten sich noch gut an die dicke Hornhaut an seinen Daumen und Zeigefingern erinnern. Er war Edelsteinschleifer gewesen und, wie er sagte, ein guter.
Friedrich war der Älteste und seine Brüder wussten es ohnehin nicht besser. So sattelten sie die Pferde wieder und ritten vom Hügel hinunter an den Rhein. Am Ufer verlief der Treidelpfad, wo man früher Boote den Fluss entlang zog. Man band starke Taue an die Boote und auf dem Pfad waren jene Menschen oder Ochsen gegangen, welche die Boote und Nachen dann den Fluss entlang zogen. Jetzt wurde der Pfad nur selten zum Treideln genutzt. Viele Boote verfügten bereits über den Dampfantrieb oder wurden von solchen mit diesem Antrieb gezogen.
Die drei Brüder ritten, unterhalb von Wiesbaden an Biebrich vorbei, zur Brücke. Es war schon dunkel, als sie hinüber ins pfälzische ritten und sie waren froh darüber. Es waren Soldaten des Großherzogs auf der Brücke, doch die kümmerte es wenig, wer sie passierte. Friedrich war darüber erleichtert. Vielleicht auch die Soldaten. Vielleicht gefiel es denen auch nicht besonders, andere Leute totzuschießen.
Die Brüder merkten rasch, dass sie auffielen. Drei abgerissene Bauernburschen auf Pferden, auch wenn dies Ackergäule waren, wirkten zu ungewöhnlich. Keiner von ihnen hatte Lust, die Aufmerksamkeit einer Patrouille von Soldaten oder Gendarmen zu erregen. Hinter Mainz fanden sie einen größeren Hof. Es schien eines der älteren Wehrgehöfte zu sein, denn eine stabile Mauer umgab die Anlage, in der sich Schießscharten befanden. Die mit Steinen gepflasterte Zufahrt war mit Stroh gestreut, um den Lärm eiserner Hufeisen oder Wagenräder zu dämpfen. Als sie durch den steinernen Torbogen ritten, sahen sie ein eingearbeitetes Wappen.
Karl wollte instinktiv umkehren, doch Friedrich hielt ihn zurück. „Lass gut sein, Karl. Der Adel hat wenigstens genug Geld, um uns die Zossen abzukaufen.“
Karl schnaubte durch die Nase. „Der Adel hat auch die Macht, uns die Pferde einfach abzunehmen.“
Sein älterer Bruder zuckte die Achseln. „Gib du nur Acht, dass man deinen Hut nicht sieht.“
Vor dem Gutshaus stand ein vierschrötiger Mann in derber, aber sauberer Kleidung. Er sah die drei Brüder kritisch an. „Verschwindet hier!“, rief er herüber. „Gesindel hat hier nichts verloren.“
Es war wohl die verdächtige Kombination von Bauernburschen und Pferden, die den Mann misstrauisch machte.
Friedrich hob beschwichtigend die Hände. „Wir wollen nichts Böses. Ein wenig zu Essen täte uns wohl, wir sind auf der Reise.“
„Oder auf der Flucht“, knurrte der Vierschrötige. „Mein Herr wird nicht erfreut sein, euch hier zu sehen. Also, reitet vom Hof.“
„Habt ihr Verwendung für die Pferde?“ Friedrich beugte sich auf dem Pferderücken vor und klopfte seinem Gaul gegen den Hals. „Es sind gute Arbeitstiere, wirklich.“
„Gestohlen?“ Der Mann trat näher und Karl bemerkte drei andere, die aus einem angrenzenden Stall heraus traten. Sie hielten Mistgabeln in den Händen und machten durchaus den Eindruck, sie auch gebrauchen zu wollen.
„Nicht gestohlen.“ Friedrich zuckte die Achseln. „Unseren Hof hat es erwischt. Lag bei Klarenthal, im hessischen.“
Der Mann kniff die Augen zusammen und trat näher. „Ihr seid auf der Flucht. Gehört zu den deutschen Revolutionären, wie? Frankfurt?“
„Auch“, sagte Karl automatisch, obwohl Friedrich ihn mahnend ansah.
Der Mann lachte. „Dachte es mir. Kommen viele herum, in diesen Zeiten. Suchen Unterschlupf, bis sich alles beruhigt hat und wieder beim Alten ist.“ Er kratzte sich am Kopf. „Papiere für die Gäule habt ihr nicht, wie? Hätte mich auch gewundert. Aber es sind Arbeitspferde und gut beieinander. Aber wohl kaum von eurem Hof, wie? Dann wären eure Sachen besser, wie?“
Friedrich taufte den Mann im Geiste auf den Namen „Wie“ und nickte. „Wir brauchen nicht viel. Ein wenig Geld für die Gäule und etwas für den Schnappsack.“
„Steigt erst mal ab und geht in die Küche. Der Hagen wird sie euch zeigen.“
Sie folgten einem der Knechte in die Küche des Gesindehauses. Sie konnten nur hoffen, dass „Wie“ es ehrlich mit ihnen meinte. Wahrscheinlich würden die Königlichen ein Kopfgeld auf jeden flüchtigen Demokraten ausgesetzt haben. Bei einem Batzen Gold hörte die Loyalität rasch auf, das musste man einfach akzeptieren.
Der Vierschrötige kam nach einer Weile herein und setzte sich zu ihnen, sah zu, wie sie den heißen Eintopf in sich hinein schaufelten und kräftig vom Brot abbissen. „Ich kann euch zwei Taler geben. Tut mir leid, mehr ist nicht drin. Nicht ohne Papiere. Aber ich gebe euch was für den Schnappsack mit und ein paar Klamotten könnt ihr auch noch bekommen.“
Als sie den Gutshof in Richtung Kreuznach verließen, befanden sich etwas Wurst und Brot in ihren Schnappsäcken. Friedrich hatte sogar eine neue Hose erstanden. Neu bedeutete, dass sie weit weniger Löcher aufwies, als seine alte. Aber sie waren recht zufrieden.
„Wie“ hatte sie kurz ins Arbeitszimmer des abwesenden Gutsbesitzers geführt und ihnen eine Landkarte gezeigt. Friedrich fertigte eine einfache Skizze davon und „Wie“ nickte dazu anerkennend. „Solltest wohl Pfaffe werden, wie? Oder wie hast du sonst lesen und schreiben gelernt? Wart ihr auf der Schule?“
Dafür hatte die Zeit nie gereicht, denn es gab immer etwas zu tun. Karl und Hans konnten sich zumindest die Schriftzüge der Städte und Ortschaften einprägen, die ihren Weg nach Frankreich markierten. Friedrich hingegen hatte den Vorzug genossen, dass seine Friederike gelegentlich ein Buch mit ihm gemeinsam las. Dabei war ihr aufgefallen, dass Friedrich sich Zeichnungen und Karten ungewöhnlich gut einprägen konnte und er zudem über ein außergewöhnliches räumliches Vorstellungsvermögen verfügte. An den Globus, im Arbeitszimmer ihres Vaters, waren sie ja nie herangekommen. Friederike hatte ihren Geliebten mit ins Wiesbadener Museum genommen und mit ihm begeistert die Karten in den Büchern mit dem dortigen Globus verglichen.
So ganz hatte der Friedrich dem runden Erdball nicht getraut. „Warum fallen wir dann nicht auf der unteren Seite herunter?“, hatte er gefragt und damit endlich eine Frage erwischt, bei der auch Friederike nicht weiterwusste.
Als die drei Brüder vom Hof gingen, hatte der Vierschrötige ihnen ermunternd auf die Schultern geklopft. „Lasst euch nicht erwischen, wie? Ich denke, in ein paar Wochen ist eh wieder Ruhe und die Truppen sind wieder in den Garnisonen. Ihr solltet einfach abwarten.“
Sie folgten dem Flüsschen über Kreuznach in Richtung auf Idar-Oberstein. Immer die Nahe entlang, wo der Weg es zuließ. Sie hatten kaum einen Blick für die landschaftlichen Schönheiten des Hunsrücks, denn sie mussten sich zunehmend Sorgen um ihr Überleben machen. Die zwei Taler und der Inhalt ihrer Schnappsäcke würden nicht lange reichen.
In Idar-Oberstein suchten sie jene Schleiferei, in der ihr Kamerad Mayer gearbeitet hatte. Sie fanden sie, doch es gab keine Arbeit. Der Meister hatte nur laut gelacht, als sie ihm ihre Arbeitskraft anboten. „Schleifen wollt ihr? Zeigt eure Hände. Bah, viel zu grob für feine Arbeit. Kommt einmal mit, ich zeige euch was.“
Er führte sie in eine der Werkstätten. Sie war über einem Bachlauf errichtet worden und ein ausgeklügeltes System sorgte für fortwährenden Wasserzufluss zu den Schleifsteinen. Viele der Steine wurden von Wasserkraft angetrieben. Lederne Transmissionsriemen führten von einer Welle zu den einzelnen rotierenden Steinen hin.
„Die sind nur für die groben Arbeiten oder die billigen Sachen“, erklärte der Meister grinsend. „Wenn es auf Präzision ankommt, dann ist Handwerkskunst gefragt. Und Fußarbeit.“
Da hatten sie erkannt, dass die Feinarbeiten auf Schleifsteinen ausgeführt werden mussten, die von den Füßen der Schleifer angetrieben wurden.
Vor allem Friedrich fand die Schleiferei faszinierend. Der Meister bemerkte sein Interesse und gab ihm lächelnd ein Stück Quarz. „Versuch es halt“, sagte der Mann und sah vergnügt zu, wie Friedrich es dann tatsächlich versuchte. Mehrmals, denn es war überhaupt nicht einfach, das Quarzstück gleichmäßig auf den Schleifstein zu halten. Erst meinte Friedrich, der Stein liefe nicht rund und habe Unwucht, doch dann zeigte der Meister ihm, dass es mit dem Druck zu tun hatte, mit dem Friedrich das Quarzstück gegen den Schleifstein hielt. Und der richtigen Position. Etwas zu weit oben oder unten und der Schleifstein riss Friedrich das Stück aus der Hand. Ein wenig zu sanft aufgesetzt und der Schleifstein zeigte kaum Wirkung, etwas zu fest und Friedrich konnte das Maß nicht halten oder bremste den Schleifstein ab.
Friedrich gab sich Mühe und war zäh. Nach einer Stunde gab er dennoch auf. Seine Daumen und Zeigefinger waren wund und aufgeschürft. Der Meister gab ihm das benutzte Quarzstück. „Behalte es zur Erinnerung. Vielleicht, wenn du lange Jahre übst, würdest du tatsächlich einen guten Schleifer abgeben. Aber ihr wollt wohl nicht so lange bleiben, oder?“
Nein, das wollten sie nicht.
Die drei Brüder erreichten bald darauf Birkenfeld. Sie konnten sich auf einem Hof zum Holzschlagen verdingen und besserten einen Weidezaun aus, kamen so zu einer warmen Mahlzeit und einem Schlafplatz im Heuschober.
Dann marschierten sie weiter, dem Saarland entgegen.
Die Landschaft hatte dichte Wälder, die ihnen notfalls Unterschlupf und etwas Schutz vor dem Wetter boten. Zudem gab es Beeren, essbare Wurzeln und Pilze. Verhungern mussten sie nicht. Aber sie mussten sich in Acht nehmen. Vor Gendarmen, Jägern und vor dem Wild. Eine Nacht verbrachten sie gemeinschaftlich auf einem Baum, bis sich unter ihnen ein wilder Eber nach einer anderen Mahlzeit umsah. Von da an mieden sie den dichten Wald.
Der Weg nach Frankreich erwies sich als schwieriger, als sie sich dies vorgestellt hatten. Die meisten Menschen in den Orten und Gehöften, an denen die drei Brüder vorbei kamen, hatten selbst nicht viel oder fassten keinerlei Vertrauen zu den Fremden.
Irgendwie schafften sie es, sich zumindest eine Mahlzeit durch Taglohnarbeit zu sichern. Indem sie immer wieder Holz spalteten, Zäune oder Dächer reparierten und jede Arbeit annahmen, die ihnen geboten wurden. Manchmal gab man ihnen nur die Erlaubnis, Wasser aus dem Ziehbrunnen zu trinken und mitunter nicht einmal das.
Eines Tages war es so weit, dass ihre Mägen knurrten und sich keine Möglichkeit fand, in Tagelohn zu kommen.
„Es bleibt uns nichts übrig“, seufzte Friedrich. Er fühlte sich für seine Brüder verantwortlich und ein Vorschlag fiel ihm schwer. „Wir müssen zumindest das stehlen, was wir zum überleben brauchen.“
Eigentlich ließen ihr Stolz und ihre Erziehung es nicht zu, aber was sollten sie tun?
„Du versündigst dich“, murmelte Karl erblassend. „Stehlen ist Sünde. Und außerdem haben die Leute doch selbst nicht viel.“
„Mag sein“, gab Friedrich zu. „Aber wir haben noch weniger. Brüder, ich sage doch nur, dass wir das Notwendigste nehmen. Wenn ich vor der Wahl stehe, zu verhungern oder etwas zu stehlen, dann entscheide ich mich für letzteres.“
„Ich mich auch“, stimmte Hans zu und der knurrende Magen unterstrich den Standpunkt des Jüngsten.
Da sie sich gegen den Herrn versündigen würden, stimmten die Brüder Baumgart demokratisch darüber ab und so wurde Karls Widerwillen überstimmt. Auch derjenige, der ihre Schnappsäcke notfalls mit langen Fingern füllen sollte, war rasch gefunden. Der 15-jährige Hans war der kleinste, schnellste und hatte die schärfsten Augen von ihnen. In der Gegend von Schmelz fanden sie genügend kleinere Gehöfte und ihr Hunger war groß genug, um den Versuch zu wagen. Ihre Wahl fiel auf einen kleinen Hof, der, wie ihr elterlicher, in einem kleinen Seitental lag. Dieser hier war auf drei Seiten von dichtem Wald umgeben. Neben Bauernhaus, Stall und einem Heuschober fiel ihr Augenmerk auf mehrere Gehege, in denen laut gackernde Hühner herumliefen. In einer kleinen Suhle neben einem Trog wälzten sich mehrere Schweine und Ferkel. Auch auf dem Hof selbst liefen einige Hühner frei herum. Einen Hund sahen sie nicht und auch keine Menschenseele.
„Frei laufende Hühner“, sinnierte Friedrich. „Da braucht man nicht einmal in ein Gehege. Da müsste man schon ein oder zwei abgreifen können.“
So setzten sich Friedrich und Karl auf den Boden eines Hanges, in der Deckung von Büschen und Bäumen, und konnten so aus guter Deckung den Hof beobachten, während Hans sich daran machte, ein oder zwei der Hühner in ihr Eigentum zu überführen. Eigentlich sollte der Jüngste, im Sichtbereich der Brüder, ebenso rasch zugreifen wie auch wieder verschwinden. Aber Hühner sind flink und laut, wenn sie das Gespür haben, dass es um ihren Hals geht. Die beiden älteren Baumgarts mussten unwillkürlich lachen, als sie die Versuche des Jüngsten sahen, eines der Tiere habhaft zu werden. Immer wieder entwischte das Objekt der Begierde und hinterließ in der Luft schwebende Federn.
„Da kommt wer.“ Karl richtete sich halb auf und deutete auf das Haus hinunter. Dort war jemand aus der Tür getreten und wollte feststellen, was der Tumult zu bedeuten hatte. „Entweder packt Hans es jetzt oder er muss den Rückzug antreten.“
Sie sahen, dass Hans wie unter einem unsichtbaren Schlag zusammenzuckte, aber sie hatten keinen Schuss gehört. Ihr Jüngster blieb stehen und rieb sich den Arm. Der Mann vor dem Haus trat auf ihn zu. Nein, kein Mann.
„Herr im Himmel“, seufzte Friedrich. „Das ist ja noch ein Knirps.“
Der Junge mochte acht Jahre alt sein. Aber er schien keinerlei Furcht vor dem größeren Hans zu haben. Sie sahen, wie die beiden miteinander sprachen, konnten jedoch nichts verstehen. Karl nahm missmutig einen kleinen Zweig und zerbrach ihn. „Er bräuchte dem Kleinen nur einen ordentlichen Schubs zu geben und wir hätten das Huhn.“
„Sich mit dem Burschen prügeln?“ Friedrich sah seinen Bruder vorwurfsvoll an. „Was ist mit dir los, Karl? Soll Hans sich an einem Wehrlosen vergreifen?“
„Er oder wir“, sagte Karl bestimmt. „Wir brauchen was zu essen.“
„Gott im Himmel, bist du wahnsinnig?“ Friedrich wollte es kaum fassen. Sicher, Karl und Hans waren immer ein wenig heißblütig, doch der Gedanke, sich an einem Kind oder einer Frau zu vergreifen, war ihm unvorstellbar. Er wies mit einer ausholenden Geste um sich. „Wir haben Pilze, Beeren, essbare Blätter und Wurzeln. Wir müssten nicht verhungern.“
Das Wild erwähnte Friedrich nicht. Wild gehörte immer zu irgendeinem Herrschaftlichen, der das Jagdrecht hatte. Und bei Wilderern machte man noch immer kurzen Prozess. Da waren die Herren unnachgiebig.
„Die gehen ins Haus“, stellte Karl fest.
„Was?“ Friedrich blickte wieder hinunter zum Hof und sah gerade noch, wie Hans und der Junge im Haus verschwanden. „Herr im Himmel, was ist denn nun los?“
Karl erhob sich. „Wir müssen runter und ihm helfen.“
„Warte noch.“ Friedrich beobachtete einen Mann, der aus dem Heuschober trat und nun kopfschüttelnd zum Haus hinüber ging. Der Mann sah kräftig aus und trug eine Forke, die selbst auf diese Entfernung beunruhigend aussah. Doch der Mann stellte sie neben den Eingang des Hauses, bevor er eintrat.
Eine ganze Weile später trat Hans aus dem Haus, blickte zum Hang hoch, wo seine Brüder warteten und winkte unbefangen. Dann kam er zu ihnen herauf. Seine Brüder bestürmten ihn mit Fragen. Hans grinste sie an und öffnete seinen Schnappsack. Er hatte einen frischen Laib Brot darin und auch eine halbe Wurst und etwas Käse.
„Der Junge hat dir wohl den Schneid abgekauft“, sagte Karl und biss herzhaft in ein Stück Wurst. „Was war da los?“
„Der Bursche hat eine Schleuder und weiß damit umzugehen“, sagte Hans lachend. „Aber wir haben Glück. Sie haben einen Sohn, der war bei Struves Freischärlern.“
„Ist nicht wahr.“ Karl sah auf den Hof hinunter. „Gott, ich hätte selbst hinunter sollen.“
„Ja, mit deinem Zweispitz“, bestätigte Friedrich. „Beim nächsten Hof sollten wir das vielleicht machen.“
„Beim nächsten Hof sind es vielleicht Königstreue“, warf Hans ein. „Dann würde es kein Brot geben, sondern Keile.“
Friedrich leckte sich die Finger ab. „So, Brüder. Jetzt gehen wir hinunter zu ihnen und bedanken uns. Vielleicht können wir ihnen ein wenig zur Hand gehen.“
Hans und Karl sahen ihn verwundert an. Doch dann nickten sie.
So schlugen sie sich durch. In stillem Einvernehmen war der Vorsatz, notfalls zu stehlen, aufgegeben worden. Irgendwie schafften sie es immer, für Tagelohn zu arbeiten und eine Mahlzeit zu bekommen. Notfalls ernährten sie sich von den Früchten des Waldes und manchmal hungerten sie auch. Aber sie erreichten die Grenze zur Republik Frankreich und überschritten sie im Winter.
Nach Süden hin hätten sie wohl über die steilen Gebirge und die wenigen Pässe gemusst. Doch hier war die Grenze von niedrigen Bergen, sanften Hügeln und Wald bestimmt. Es war leicht, die Grenzpatrouillen zu umgehen und französischen Boden zu betreten.
„Die Wiege der Demokratie“, sagte Karl andächtig. Sie standen auf einem kleinen Berg, den sie gerade erklommen hatten und blickten auf das Land, das sich vor ihnen ausbreitete. „Hier hat sich das Volk zum ersten Mal gegen den König erhoben.“
Friedrich schnaubte durch die Nase. „Amerika war´s. Ich hab es selbst gelesen. Da haben sich die englischen Kolonien gegen den König erhoben und ihre Freiheit erstritten. Gegen König Georg.“
„Meinethalben.“ Karl betrachtete seinen rechten Schuh. Die Sohle hatte sich gelöst und Karl hatte sie mit zwei Streifen aus seinem Hemd an den Schuh gebunden. Doch der lange Weg, der sie bis hierher führte, hatte den Stoff förmlich zerrieben. Karls Schuhe waren kaputt und seine Füße wund, doch das erging seinen Brüdern nicht anders. „Wir brauchen Schuhe.“
„Und was zu essen“, pflichtete Hans bei.
„Und Kleidung“, ergänzte Friedrich. „Gott, wir sehen aus wie eine Räuberbande. Wie Schinderhannes persönlich.“
„Dem seine Leute haben sich die Schuhe besorgt, wenn sie welche brauchten.“ Karl zog die fadenscheinige Jacke und sein Hemd aus und riss zwei neue Tuchstreifen ab. Sorgfältig befestigte er die Sohle aufs Neue.
„Dafür haben seine Leute und er auch alle einen langen Hals bekommen“, knurrte Friedrich. „Hier wird es schwer für uns.“
„Hier?“ Hans sah ihn fragend an. „Wieso hier? Hier jagt uns keiner mehr.“
Friedrich blickte über das Land. „Kann einer von uns das französische? Seht ihr? Wie sollen wir unsere Arbeit anbieten, wenn die Leute uns nicht einmal verstehen?“
„Ein paar werden das schon tun“, hoffte Karl.
Der Älteste wies in das Tal hinab. „Dort hinten stehen ein paar Hütten. Zuerst müssen wir etwas zu essen bekommen. Lasst es uns dort versuchen.“
Sie stiegen den Hügel hinab. Aus dem Klettern zwischen den Felsen wurde ein holperiges Gehen, als zwischen dem Geröll zunehmend Grün wuchs. Sie sahen eine kleine Schafherde nebst Schäfer, doch der Mann musterte sie derart feindselig, dass sie sich ihm nicht näherten. Bei dem Mann befanden sich zwei große Hütehunde, die einem zusätzlichen Bissen Fleisch nicht abgeneigt schienen.
Die Gebäude vor ihnen waren klein, aber sauber bearbeitet. Es gab ein paar kleinere Felder, die bestellt wurden, und doch wirkte das Ganze nicht wie ein Gutshof. Als sie sich den aus Stein und Holz gefügten Hütten näherten, hörten sie den dünnen Klang einer Glocke und entdeckten ein paar Gestalten in langen Kutten, die sich zwischen den Gebäuden bewegten. Eine von ihnen winkte den Brüdern freundlich zu.
„Wir haben Glück“, sagte Friedrich erleichtert. „Das sind Klosterbrüder. Ich weiß zwar nicht, was sie hier verloren haben, aber die werden uns im Namen Christi sicherlich helfen.“
Als sie die Mönche erreicht hatten, wurden sie freundlich, wenn auch in unverständlicher Sprache begrüßt. Ein paar Brocken Französisch hatten die Brüder gelegentlich schon gehört, aber nie die Gelegenheit erhalten, die Sprache zu erlernen. Die Mönche trugen graue Kutten und Karl, den es schon immer am meisten zur Kirche gezogen hatte, hielt sie für Franziskaner.
Die abgerissene und klägliche Erscheinung der Brüder machte ihre Lage deutlich. Das vernehmliche, wölfisch wirkende Knurren ihrer Mägen, mochte ein Übriges beitragen. Die Mönche schoben sie in das Gebäude mit der kleinen Glocke. Es war die Kapelle des kleinen Bergklosters. Sie verstanden Teile der lateinisch gelesenen Messe und konnten immerhin bei Gebet und Lied ein wenig mithalten. Danach folgten sie den Mönchen in eine andere Hütte und es gab einen Gemüseeintopf mit Brot und wundervoll klarem kaltem Bergwasser. Sie glaubten, nie zuvor etwas Besseres gegessen zu haben und langten ordentlich zu. Hans schaufelte begeistert einen dritten Holzteller voll, bis er bemerkte, dass die Mönche offensichtlich weniger zu sich nahmen, um ihre ausgehungerten Gäste satt zu bekommen. Errötend schob Hans den Teller von sich und murmelte eine Entschuldigung. Doch einer der Mönche lächelte nur und hob den Teller wieder vor den jüngsten der Brüder.
Mit Händen und Füßen versuchte man Konversation zu betreiben. So schwer schien dies gar nicht zu sein. Einer der Mönche hatte die schwarz-rot-goldene Kokarde an Karls Zweispitz entdeckt und erklärte seinen Mitbrüdern wohl, was es damit auf sich hatte.
Der Mönch legte plötzlich zwei Hände in der Geste des Schlafens an seine Wange. „France?“
Friedrich ahnte, was der Mann meinte und schüttelte den Kopf. „Amerika.“
Der Mönch lachte leise auf. „Ah. Amerique.“
Die Nacht teilten sie eine der Hütten mit zweien der frommen Brüder und am nächsten Morgen spottete Karl gutmütig, das laute Schnarchen der Gemeinschaft würde mit Sicherheit jedes Raubtier vertrieben haben. Während sie sich am Brunnen wuschen, erschien einer der Mönche mit einem anderen, den sie zuvor noch nicht gesehen hatten.
„Ich bin Bruder Markus“, stellte der Mann sich in fehlerfreiem Deutsch vor. „Das hier ist Bruder Philipe, der Abt unserer Gemeinschaft. Ich habe gehört, ihr seid auf dem Weg nach Amerika?“
„Ihr seid Deutscher?“, fragte Friedrich erstaunt.
Der Mönch lachte auf. „Nicht mehr. Jetzt bin ich ein Bote des Herrn. Aber es gab eine Zeit, da ich das Schwert geführt habe. Ich war bei der Kings German Legion. Im großen Krieg.“
Der Mann mochte um die Sechzig sein. Vielleicht hatte er wirklich noch in den napoleonischen Kriegen gekämpft. Die Legion und ihr exzellenter Ruf waren bekannt. Als Napoleon das Haus Hannover überrannte, da waren viele deutsche Soldaten nach England geflohen. Sie hatten in der englischen Armee den Kampf gegen den französischen Kaiser fortgesetzt. Jene Deutschen gehörten damals zu den besten Truppen des englischen Königs und als der Kaiser geschlagen war, kehrten die meisten von ihnen in die Heimat zurück.
„Ihr wart in England?“, fragte Hans neugierig. Er benutzte automatisch die höfliche Anrede in der dritten Person, denn Bruder Markus war noch immer eine respektheischende Person.
Bruder Markus schüttelte den Kopf. „Nein. Kein ausländischer Soldat darf englischen Boden betreten. Mit einer Ausnahme. Der Isle of Man. Dort waren wir stationiert. Na, bis wir nach Spanien und später nach Frankreich gingen. Wir haben den Franzosen gut zugesetzt. Besser als der Tripper.“ Markus lachte breit und bemerkte, dass Hans ihn unverständig ansah. „Schon gut, mein Junge. Damals waren andere Zeiten, verstehst du? Da wurden die Regimenter auch im Felde von Ehefrauen und Huren begleitet. Bei rund 1.200 Seelen im Regiment und nur 80 Frauensleuten, da konnte sich schon mal etwas verbreiten, du verstehst?“
Hans verstand noch immer nicht ganz, aber keiner hatte Lust, den 15-jährigen jetzt über Geschlechtskrankheiten aufzuklären.
Bruder Philipe beauftragte Bruder Markus damit, ihren Gästen behilflich zu sein. Als die anderen Mönche ihren diversen Verpflichtungen nachgingen, blieb Markus bei den Brüdern sitzen und breitete eine Karte vor ihnen aus. Friedrich entdeckte, dass sie englisch beschriftet war und fragte sich unwillkürlich, wie sie in den Besitz der frommen Männer gekommen sein mochte. Er sah Bruder Markus an. „Warum seid Ihr nicht zurückgegangen?“
Der Mönch zuckte die Achseln. „Es gab nichts, wohin ich hätte zurückkehren können. Und nach all dem Blut und Schlachten hatte ich genug vom Handwerk des Soldaten. Nein“, Markus hielt seine Hände hoch und betrachtete sie nachdenklich, „Hände sollten helfen und nicht töten. Wir alle sind Geschöpfe unseres Herrn. Doch wenn ihr nach Amerika wollt, so lasst uns einmal schauen, wie ihr dorthin kommt.“
Im Grunde hätten sie sich zu den Häfen im Westen oder Süden wenden können. „Ich rate euch den Süden“, sagte Markus nachdenklich. „Marseille biete gute Möglichkeiten ein Schiff zu bekommen. Ich gehe davon aus, dass ihr wohl kaum Geld habt, um eine Überfahrt zu bezahlen, nicht wahr? Dachte es mir. Im Süden kommen viele Schiffe herein. Handel mit Afrika und auch mit Amerika. Wenn ihr Glück habt, dann findet ihr sogar ein amerikanisches Schiff, welches heimwärts fährt. In jedem Fall gibt es dort unten genug Schiffe, die mit den Amerikanern Handel treiben. Marseille ist Umschlagplatz für viele Waren, die aus dem fernen Osten und Afrika kommen und die in die neue Welt verschifft werden. Da findet sich bestimmt die Möglichkeit, auf einem Schiff anzuheuern.“ Er sah ihre fragenden Blicke. „Arbeit auf einem Schiff zu finden. Hände werden wohl immer gebraucht.“
Markus Finger fuhr stets dieselben Punkte auf der Langkarte entlang und seine Worte prägten sich den Brüdern intensiv ein. Markus nahm Papier und einen Bleistift und fertigte ihnen eine Skizze an. „Folgt der Mosel nach Metz und von dort nach Nancy. Dann die Saône entlang nach Lyon. Immer die Rhone hinunter, auf Avignon zu und dann nach Marseille.“
Friedrich fuhr die Karte entlang und überschlug die Entfernung. „Herr im Himmel, das sind rund vierzehnhundert Kilometer. Vielleicht sollten wir doch nach Westen.“
„Oder hier bleiben“, sinnierte Karl.
„Also, ich will nach Amerika“, sagte Hans bestimmt. „Gott, wir sind schon so weit gekommen, das werden wir auch noch schaffen.“
„Mit der Hilfe unseren Herrn“, bestätigte Bruder Markus und sah nach unten. „Und besseren Schuhen.“
Rund vierzehnhundert Kilometer. Nur bis Marseille. Die Überfahrt nach Amerika war da nicht gerechnet. Wenn sie Geld gehabt hätten, so würden Postkutschen oder Postschiffe die Zeit erheblich verkürzt haben. Friedrich fuhr erneut die Karte entlang. „Bei guten Bedingungen werden wir vielleicht dreißig Kilometer am Tag schaffen.“
„Eher Zwanzig“, wandte Bruder Markus ein. „Ihr habt gute und schlechte Tage und müsst euch zwischendurch bestimmt verdingen, um euer Brot zu erwerben. Und jetzt ist die Zeit schlecht. Es ist Winter. Ihr solltet im Frühjahr los, dann seid ihr im Sommer 1850 in Marseille.“
Friedrich nickte. „Wir können nicht den Winter über bei euch bleiben. Ihr habt nicht genug, um drei zusätzliche Mäuler zu stopfen.“
Bruder Markus lehnte sich in seinem Stuhl zurück. „Mal sehen. Ein paar zusätzliche Hände könnten hilfreich sein.“ Er strich sich über die Tonsur. „Wir haben hier eine Quelle, wie ihr wisst, und einen Brunnen. Unterhalb unserer Niederlassung liegt der kleine Ort Saint Marie. Wir haben vor, den kleinen Quellfluss zur Bewässerung der Ackerflächen von Saint Marie zu nutzen. Dazu müssen wir ihn ein wenig umleiten.“
„Jetzt? Im Winter? Wenn der Boden hart ist?“ Friedrich wiegte den Kopf. „Warum nicht bis zum Frühjahr warten?“
„Weil im Frühjahr die Aussaat erfolgt und die Ernte wird dringend gebraucht.“ Markus sah sie nachdenklich an. „Wärt ihr prinzipiell bereit, bis zum Frühjahr zu bleiben?“
Die drei Brüder sahen sich fragend an und begannen zu diskutieren, bevor sie zögernd zustimmten. Markus erhob sich. „Ich spreche mit Bruder Philipe.“
Am Abend hatten sie eine Vereinbarung mit den Mönchen. Sie würden hier und in dem kleinen Ort bis zum Frühjahr arbeiten. Gegen ihre Arbeitskraft erhielten sie Unterkunft und Essen, und die Mönche würden sie mit Bruder Markus Hilfe unterweisen. Vor allem Bruder Markus, in der englischen Sprache, die sie in Amerika brauchen würden. Es erwies sich als ein Segen, dass der ehemalige Soldat in der englischen Armee gedient hatte. Die wenigsten Soldaten der deutschen Legion des Königs hatten die englische Sprache beherrscht, aber es erwies sich, dass Markus wohl Offizier gewesen war.
So mühten sie sich während des Winters gemeinsam mit den Mönchen ab, um den kleinen Bach umzuleiten. Im Grunde ging es lediglich darum, ein zusätzliches Bachbett in Richtung auf das kleine Dorf Saint Marie zu graben und einen Teil des Wassers darin umzuleiten. Dennoch war es Knochenarbeit in dem harten Boden. Während sie hackten und schaufelten, vermittelte Bruder Markus ihnen Kenntnisse der englischen Sprache. Friedrich hatte das Gefühl, dass ihre Arbeit eher eine Beschäftigung war, mit welcher die freundlichen Franziskaner ihnen das Gefühl vermittelten, etwas für Unterkunft und Essen zu leisten. Vor allem Bruder Markus widmete ihnen alle verfügbare Zeit.
Der Winter war hart. Der Boden gefror tief. Hier im Grenzgebiet, mit seinen eher kargen Hügeln, pfiff der Wind unbarmherzig. Immer wieder gingen sie nach Saint Marie hinunter, wo es die ersten dichteren Wälder gab, und sammelten dort Holz für die Kamine und Kochstellen. Wenigstens gefror der kleine Bach nicht zu, so dass sie ständig frisches Wasser hatten. Die Brüder stellten rasch fest, dass zwei der Mönche recht ausgeprägte medizinische Kenntnisse besaßen. Immer wieder gingen diese Mönche in den Ort hinab, um Kranken oder Verletzten beizustehen. Manchmal waren sie sogar tagelang zu anderen Dörfern unterwegs.
Einen der Mönche verloren sie bei solch einem Besuch. Sie warteten ein paar Tage auf ihn, denn es ließ sich nie genau bestimmen, wann die Dienste eines Medikus nicht mehr benötigt wurden. Aber irgendwann nahm die Sorge einfach überhand und die Brüder Baumgart schlossen sich ein paar Mönchen an, die sich auf die Suche nach dem Vermissten machten. Sie fanden ihn, von Wölfen zerrissen, und so las man die Messe und begrub den Toten in dem gefrorenen Boden bei der kleinen Abtei.
Die Baumgarts konnten es kaum erwarten, bis es endlich Frühjahr war. Die Tage, an denen das erste Grün wieder zu sprießen begann, blieben ihnen unvergessen. Vor allem Bruder Markus spürte ihre Unruhe und konnte sie wohl am besten nachvollziehen. An Stelle der einfachen Schnappsäcke hatten die drei Baumgarts nun weiche Felltornister, die mehr Platz boten und die sie auf den Rücken tragen konnten. Auch ihr Schuhwerk war geflickt. Die Mönche hatten sich als sehr geschickt im Umgang mit dem Leder von Kuhfellen erwiesen und daraus brauchbare Schuhe gefertigt. Nicht elegant, aber zweckmäßig, und es würde reichen, bis die Brüder an ordentliches Schuhwerk kamen.
„Gottes Segen mit euch“, verabschiedete Bruder Markus die drei und die anderen Mönche sprachen eine lateinische Segensformel, als Friedrich, Karl und Hans sich nun endlich wieder auf den Weg nach Amerika machten.
Die erste Strecke nach Metz und von dort nach Nancy war hart. Karl erkrankte an einem Fieber und sie waren gezwungen, mehrere Wochen in einem kleinen Ort zu bleiben. Sie hatten das Glück, beim Pfarrer Hilfe und Pflege für den Bruder zu erhalten. Hans wandte seine erworbenen Kenntnisse in der Landwirtschaft an und half auf einem Hof, und Friedrich arbeitete in der Gemeinde. Die Leute waren freundlich, auch wenn die Verständigung problematisch war. Die Mönche hatten den Brüdern Baumgart ein paar Brocken Französisch beigebracht, doch im Grunde hatten sie sich auf das Englische konzentriert. Sie lernten rasch, dass diese Sprache nicht beliebt war. Zu unerfreulich waren hier noch die Erinnerungen an die englischen Ritter des hundertjährigen Krieges und später die alliierten Truppen in dieser Region. Als Karl wieder zu Kräften gekommen war, da machten sie sich auf den Weg nach Lyon. Sie mieden die Städte. Nicht aus Furcht, sondern weil sie sich dachten, Arbeit eher in den kleineren Orten und Gehöften zu finden. Doch in der Nähe von Lyon hatten sie unerwartetes Glück.
Am Ufer der Rhone lagen mehrere Schleppkähne. Ein Teil davon war bereits mit Balken und Stämmen beladen. Am Ufer herrschte geschäftiges Treiben. Fuhrwerke brachten Stämme aus den Wäldern herbei und eine ganze Anzahl von Männern war damit beschäftigt, die Rinde von den Stämmen zu schälen und das Holz zu sägen. Es sah nach einer Menge Arbeit aus und man würde vielleicht ein paar zusätzliche Hände gebrauchen können.
Sie wandten sich an einen wohlgekleideten Herrn, der einen feinen Wollanzug und einen der modischen hohen Zylinder aus Wollstoff trug, die eine typische konische Form aufwiesen. Der Mann hielt ein Buch und einen Stift in den Händen und schritt murmelnd zwischen den anderen Arbeitern einher. Zunächst bemerkte er die Brüder gar nicht oder beachtete sie zumindest nicht, doch als Friedrich sich ihm in den Weg stellte, blickte er unwirsch auf.
Friedrich lächelte den Mann entwaffnend an. „Verzeiht, mein Herr, wenn wir Euch stören. Aber wir sind drei Burschen auf Wanderschaft und suchen Arbeit.“
Sie konnten sich verständlich machen und der Mann nahm ihre Arbeitskraft gerne an. Unter seinen Arbeitern trafen sie unerwartet einen Landsmann.
„Bernd Kahlmann“, stellte dieser sich mit breitem schwäbischen Akzent vor. „Ich bin Zimmermannsgeselle und war auf der Walz.“
Als Walz wurden jene Jahre eines Gesellen bezeichnet, in denen er frei im Land herumzog und bei verschiedenen Meistern seines Berufes lernte, um sein Handwerk zu perfektionieren und somit selber zum Meister zu werden. Schon seit vielen Jahren wurden auf diese Weise die Techniken der Holzverarbeitung und Holzbearbeitung zu gegenseitigem Nutzen verbreitet. Bernd Kahlmann war Anfang der Zwanzig. Neben seinem breiten schwäbeln war sein ebenso breites Grinsen offensichtlich sein Markenzeichen.
„Wie hat es dich ausgerechnet nach hier verschlagen?“, wunderte Friedrich sich.
Kahlmann zog die Brüder ein Stück zur Seite, so dass der Mann im grauen Anzug sie nicht sehen konnte und setzte sich mit ihnen auf einen Stapel Hölzer. „Ist ganz einfach“, gestand er treuherzig. „Ich hatte Ärger mit dem Herzog.“
„Warst du bei der Revolution dabei?“
Bernd Kahlmann lachte auf. „Gott, nein. Ich habe im herzoglichen Schloss gearbeitet. War eine gute Arbeit. Gutes Essen und gutes Geld.“
„Warum bist du dann fort“, fragte Karl wissbegierig. „Hast du etwas mitgehen lassen?“
Kahlmann lachte erneut. „Eher im Gegenteil. Ich hab was dagelassen.“ Er sah ihr Unverständnis. „Die zweite Tochter vom Herzog. Sie hat einen dicken Bauch bekommen und das hat dem Herrn Papa nicht gefallen. Da bin ich lieber über die Grenze.“
Karl grinste breit. Auch wenn er ein gottesfürchtiger Bursche war, so hatte auch er sein Auge für die Schönheiten des Lebens. Vor allem jenen, deren Formen so angenehm und weich waren. Friedrich nahm einen langen Schluck aus der angebotenen Weinflasche. „Und wo machst du hin, wenn das hier fertig ist? Wir wollen nach Amerika.“
Bernd Kahlmann hatte eigentlich keinen besonderen Plan. Er sprach fließend Französisch und fühlte sich hier durchaus wohl. Es gab Arbeit, gutes Essen und schöne Mädchen. Es trieb ihn nicht weiter in die Ferne.
Es dauerte mehrere Tage, bis die Kähne alle beladen waren. Bernd Kahlmann wies auf den Mann im Anzug. „Das ganze Holz geht runter nach Marseille. Dort bauen sie wie verrückt. Häuser und Schiffe. Fragt ihn doch nach einer Passage. In Marseille muss ja auch entladen werden. Vielleicht nimmt er euch mit.“
Der Mann willigte ein. Er brachte sie zu einem stämmigen Franzosen, der sie zu einem der Kähne schob. Die Holzkähne hatten ganz vorne einen kleinen Mast mit einem Segel, doch hauptsächlich wurden die Schiffe durch lange Staken und die Strömung bewegt. Der Mann im Anzug verschwand. Er fuhr über Land mit einer Kutsche, während die Brüder, in Begleitung von Kahlmann, auf den Kähnen fuhren.
„Was soll´s?“, sagte Kahlmann, als er auf den Kahn sprang. „Schöne Mädchen gibt es auch in Marseille.“
Sie fuhren die Rhone herunter und es war eine der schönsten Landschaften, die sie je gesehen hatten. Kahlmann behauptete allerdings, das Tal der Loire mit seinen Burgen und Schlössern sei noch weit schöner. Trotz der Arbeit genossen sie die Fahrt. Ihre Aufgabe war nicht kompliziert. Die Stake ins Wasser, am Rumpf seitlich entlang laufen und dabei kräftig drücken, und am Bootende die Stake aus dem Wasser, wieder zum anderen Ende zurücklaufen und das Ganze von vorne beginnen. Es blieb genug Gelegenheit, dabei die Landschaft zu betrachten und eventuell den Kopf einzuziehen, wenn der kleine Mastbaum mit dem Segel herumschwang. Spätestens nach der ersten Beule hatte man den Dreh rasch heraus. Ein einziges Mal reagierte Friedrich zu spät und landete im Wasser, doch sie fischten ihn rasch genug heraus.
Im Sommer 1850 erreichten sie dann tatsächlich Marseille. Jene Stadt, die der Nationalhymne der französischen Republik ihren Namen gegeben haben sollte. Die Stadt barst förmlich vor Leben und geschäftigem Treiben. Wo im Stadtkern noch die üblichen verwinkelten und engen Gassen vorherrschten, da wurde in den Außenbezirken eifrig gebaut. Marseille entwickelte sich von der Hafenstadt zu einer Industriestadt. Nur bei Frankfurt hatten die Brüder zuvor eine solche Anzahl rauchender Schlote gesehen. Doch sie trieb es zum Hafen, der für sie das Sprungbrett nach Amerika werden sollte. Je näher sie kamen, desto deutlicher wurde der intensive und ihnen ungewohnte Fischgeruch. Deutlich war das Wachstum des Hafens zu verfolgen. Von steinernen Molen und Kais führten neue hölzerne Anlegestege in das Hafenbecken.
Eine scheinbar unüberschaubare Anzahl unterschiedlichster Boote und Schiffe bevölkerten den Hafen. Und selbst außerhalb des Hafenbeckens waren ankernde Schiffe zu erkennen. Zahlreiche kleine Boote pendelten zwischen den Wasserfahrzeugen, brachten Waren und Menschen, sogar Tiere an Land oder zu den Schiffen hinüber. Es gab eine große Zahl kleiner Fischerboote, doch diese interessierten die Brüder und Bernd Kahlmann wenig. Sie suchten nach jenen Schiffen, die über den Atlantik fahren würden.
Ein Abschnitt des Hafens schien den Kriegsschiffen vorbehalten. Sie sahen eines der älteren Linienschiffe, mit seinen zwei längs verlaufenden Batteriedecks. Es war schwarz gestrichen und seine Stückpforten, hinter denen die Geschütze standen, waren ebenfalls schwarz lackiert, und hoben sich von den weiß gemalten Streifen der Batteriedecks ab, die sich am Rumpf entlang zogen. Seine drei Masten ragten unglaublich weit empor und ein paar Seeleute, die oben an den Rahen irgendwelche Segelarbeiten ausführten, erschienen winzig. Zwischen dem mittleren und dem hinteren Mast ragte ein dünner schwarzer Schornstein auf, der verriet, dass man das Linienschiff, es schien eines der klassischen 72-Kanonen-Schiffe zu sein, modernisiert hatte. Dennoch war seine Zeit vorbei. Der Bug des hölzernen Schiffes hatte noch die alte rundliche Form, mit dem weit nach vorne ragenden Bugspriet. Das Schiff schien teilweise entwaffnet worden zu sein, denn der Rumpf ragte über die Wasserlinie hinaus und man konnte den mit Algen und Muscheln bewachsenen Kupferbeschlag des Unterschiffes erkennen. Direkt daneben lag ein modernes Kriegsschiff. Eine der neuen Dampffregatten. Der Rumpf war schnittig geformt und dieses Schiff hatte keine Batteriedecks mehr. An seinen Seiten erkannte man die mächtigen Radkästen des Schaufelradantriebes, flankiert von vereinzelten Kanonenluken. Die Hauptbewaffnung bestand jedoch aus zwei größeren Geschützen, die offen auf dem Oberdeck standen. Auch dieses Schiff hatte noch Masten, doch die Schaufelräder und der Schornstein verrieten, dass die Segel höchstens noch in Notfällen gesetzt würden, wenn die Dampfmaschine ausfiel.
Die beiden Schiffe führten die französische Trikolore. Doch dies war nicht die dominierende Flagge bei den großen Schiffen. Sie sahen die englische, holländische, portugiesische, spanische und preußische Fahne an den Hecks der Schiffe auswehen und etliche, deren Bedeutung sie nicht kannten. Eine fand Hans besonders hübsch.
„Was ist das für eine?“, fragte er neugierig und zupfte Bernd Kahlmann am Ärmel.
Der zuckte die Achseln und fragte einen Hafenarbeiter, der gerade eine Seekiste in ein Boot hob. Kahlmann lachte auf und schlug dem Mann kameradschaftlich auf die Schulter, half ihm, die schwere Kiste in das Beiboot zu wuchten. Dann grinste er die Brüder an.
„Ist die amerikanische“, verkündete er auflachend. „Da müssen wir uns wohl dran gewöhnen.“
Sie betrachteten die auswehende Fahne mit wachsender Ehrfurcht. Das war also die Flagge jenes Landes, welches ihre neue Heimat werden sollte. Ein blaues Feld, mit etlichen in Reihen angeordneten Sternen, und rote und weiße Streifen. Sieben rote und sechs weiße Streifen.
„Hübsch“, kommentierte Hans. „Kommt, lasst uns hingehen. Vielleicht können wir mitfahren.“
Karl hielt ihn am Arm fest. „Bist du verrückt? Das da ist ein Kriegsschiff. Die nehmen keine Passagiere mit. Willst du etwa wieder Soldat werden?“
Hans schüttelte den Kopf. Nein, dazu hatte er keine Lust.
Friedrich betrachtete ein größeres Postschiff, dass vor dem Hafen auf Reede lag. Eine Reise mit solch einem Schiff würden sie sich nicht leisten können. Selbst wenn sie im Unterdeck fuhren, würden sie sehr lange arbeiten müssen, um das notwendige Geld zusammenzubekommen. Er kratzte sich nachdenklich am Vollbart. „Wir sollten schauen, ob wir ein Schiff finden, das nach Amerika fährt und auf dem wir uns verdingen können.“
Bernd Kahlmann blickte über den geschäftigen Hafen. „Gehen wir zu den Kneipen. Da hängen bestimmt genug Matrosen herum, die uns Auskunft geben können.“
Sie schoben sich durch das Gedränge und achteten darauf, zusammen zu bleiben. Friedrich hielt eine Hand fest verschlossen in seiner Jackentasche. Dort befand sich das wenige Geld, über das sie noch verfügten. Etwas davon würden sie nun wohl ausgeben müssen. Der Hafen war weitläufig. Zwischen den Handelshäusern, Lagerschuppen und sonstigen Gebäuden fanden sich auch Gasthäuser und Kneipen. Eine von letzteren betraten sie schließlich zögernd.
Neben dem üblichen französischen Wein gab es hier auch Bier. Sie wussten nicht, ob es wirklich deutsches Bier war, wie der Wirt versicherte. Jedenfalls schien ihm der Transport nicht gut bekommen zu sein. Es schmeckte schal und hatte einen merkwürdigen Nachgeschmack. So froh sie waren, endlich wieder ein Bier trinken zu können, so reizte sie die Aussicht auf ein weiteres dieser Getränke doch nicht besonders.
Hans war fasziniert von einem hübschen Mädchen, welches ihn aufreizend anlächelte, bis der Wirt es verscheuchte. Kahlmann lachte leise und schlug ihm auf die Schulter. „Vergiss es. Das ist nicht seine Tochter, sondern eine seiner Huren. Na ja, vielleicht trotzdem seine Tochter. Ist auch egal. Er hat gleich gesehen, dass bei uns nichts zu holen ist und sie zurückgepfiffen.“
Kahlmann sprach als einziger fließend Französisch. Er sprach den einen oder anderen Mann an, den sie für einen Matrosen hielten. Im Grunde waren sie nicht schwer zu erkennen. Zwar waren die meisten Männer hier braungebrannt, kräftig und vom Wetter gegerbt, doch die Seeleute hatten einen typischen und merkwürdig wirkenden Gang. Sie schienen ein wenig zu Schaukeln, so, als trauten sie der Festigkeit des Bodens nicht. Viele der Männer waren Barfuss und hatten hornige Füße.
Nach einer Weile kam Bernd Kahlmann mit einem hageren Mann zurück. Dieser trug gestreifte Hosen und geschnürte Stiefel, dazu eine blaue Jacke. Unter der Jacke erkannte man das bei Seeleuten wohl übliche Messer. Doch hinter der roten Schärpe des Mannes steckte zusätzlich eine doppelläufige Pistole.
„Das ist Pierre Lerousse“, stellte Bernd vor. „Er ist erster Maat auf der Marbelle und sagt, er könne uns helfen.“
Der Mann hatte ein schmal geschnittenes Gesicht. Ein wenig schaudernd erkannte Hans eine weißliche Narbe, die sich von der rechten Augenbraue bis zum Kinn erstreckte und dazu führte, dass Lerousse ständig schief zu grinsen schien. Lerousse zog einen Schemel heran und setzte sich. „Allors, meine Freunde“, sagte er freundlich, „euer Kompagnon sagt mir, ihr sucht eine Passage nach Amerikas, oui?“
Die drei nickten und das Grinsen des Maats verstärkte sich noch. „Ihr habt nicht viel Geld, n´est ce pas?“
„Nein“, bekannte Friedrich als Wortführer. „Aber wir sind kräftig und können arbeiten. Wir würden uns die Überfahrt schon verdienen.“
Pierre Lerousse lachte herzlich auf. „Natürlich, meine Freunde, natürlich.“ Er wandte sich dem Wirt zu und winkte ihn heran. „Bring eine Runde von deinem besten, mein Freund.“ Während der Wirt verschwand, sah Lerousse sie der Reihe nach an. „Die Marbelle geht nach Amerika, meine Freunde. Genau dorthin, wohin ihr wollt. Wir werden noch einen kleinen Abstecher machen, um Ladung aufzunehmen, aber das macht euch sicher nichts aus, oui?“
„Äh, nein“, sagte Friedrich unsicher. „Hauptsache, wir komme nach Amerika.“
„Aber sicher, das werdet ihr, meine Freunde, das werdet ihr.“ Die Krüge kamen und Pierre Lerousse verteilte sie.
Während sie sich zuprosteten musterte Friedrich den Mann und was er sah, gefiel ihm immer weniger. Er begann sich zu fragen, ob es richtig sein würde, an Bord der Marbelle zu gehen. Doch immerhin waren sie zu Viert, da sollten sie sich schon ihrer Haut wehren können. So wie Lerousse das Schiff beschrieb, schien es relativ klein und sehr schnell zu sein. Kaum dreißig Mann Besatzung. Friedrich hatte gehört, dass die großen Linienschiffe, wie jenes im Hafen, bis zu tausend Mann Besatzung besaßen.
Sie tranken noch eine zweite Runde und Friedrich bemerkte, dass Lerousse eine sehr geschwätzige Art hatte. Er war ständig am plaudern. Stets freundlich. Aber Friedrich schien der einzige zu sein, der bemerkte, dass all das Gerede nicht viel Substanz hatte. Der Mann schwärmte von dem Schiff, aber welchen Geschäften man nachging, darüber schwieg er sich eigentlich aus. Der Älteste der Baumgarts bekam das Gefühl, das die Marbelle ein Schmugglerschiff war. Doch bevor er mit seinen Brüdern und Kahlmann beraten konnte, zahlte Lerousse und blickte sie auffordernd an.
„Nun denn, meine Freunde, ich zeige euch das Schiff und stelle euch dem Kapitän vor.“
Mechanisch erhob Friedrich Baumgart sich und folgte den anderen. Er bemerkte einen französischen Gendarmen, der Lerousse beobachtete und dieser Blick gefiel ihm nicht. Aber der Polizist machte keinerlei Anstalten, sich zu erheben und ihnen zu folgen.
Die Marbelle lag an keiner der Anlegestellen, sondern ankerte auf der Reede des Hafens. Lerousse winkte ein Boot heran, ließ die vier einsteigen und wies die Kutterbesatzung an, sie zum Schiff zu rudern. Die Ruderblätter hoben und senkten sich im Gleichmaß und Hans wunderte sich, wie wenig Geräusch sie machten, wenn sie ins Wasser eintauchten. Lerousse schnappte seine Bemerkung auf und lachte. „Bist nur auf einem Lustboot mit deiner Liebsten gepaddelt, oui? Es kommt auf die Technik an, mein Freund. Maximale Wirkung bei geringstem Kraftaufwand. Doch das lernst du noch, mein Freund.“
Allmählich begann sich der Tag zu neigen und als sie sich dem Schiff näherten, hob es sich seltsam schimmernd gegen den beginnenden Sonnenuntergang ab.
Die Marbelle mochte um die dreißig Meter lang sein und lag hoch im Wasser, was darauf hinwies, dass sie kaum Ladung hatte. Der Rumpf war graugrün gestrichen, mit einem rot gestrichenen Unterwasserschiff. Sie besaß zwei Masten. Der vordere, größere Mast, war Rahgetakelt. Das bedeutete, dass vom Mast hölzerne Ausleger quer zur Fahrtrichtung verliefen, von denen die Segel herabgelassen wurden. Der hintere Mast hatte Lateinerbesegelung. Der dortige Segelbaum lief parallel zur Fahrtrichtung. Zwischen den Masten ragte der Schornstein einer kleinen Dampfmaschine auf.
Der Kutter ruderte, unter dem weiß gestrichenen Bugspriet der Marbelle hindurch, auf die andere Seite des Schiffes. Die Brüder erkannten über sich eine Galionsfigur. Sie stellte den Kopf eines Einhorns dar, dessen Horn in Fahrrichtung gerichtet war.
„Boot ahoi“, rief es von oben herunter.
„Schiff ahoi. Marbelle“, erwiderte Lerousse und die Männer an Deck des Schiffes erkannten ihn und seine Stimme.
In der umlaufenden Reling des Schiffes stand eine Einstiegspforte offen. Friedrich betrachtete misstrauisch die hölzernen Stufen, die in die Bordwand eingearbeitet waren. Sie schienen ihm schmal und wenig vertrauenerweckend. Doch Lerousse warf der Kutterbesatzung eine Münze zu, schwang sich ohne zu Zögern auf die Stufen und erklomm sie zum Oberdeck. Friedrich zuckte die Achseln, ergriff die merkwürdige Leiter und stellte fest, wie sehr das Schiff schaukelte. Zumindest erschien es ihm, denn wenn er den Fuß auf den unteren Tritt setzen wollte, schien sich ihm die Bordwand entziehen zu wollen. Es schien ihm fast, als wolle die Marbelle ihm ausweichen.
Lerousse sah von oben auf ihn herab. „Nur Mut, mein Freund. Ein kurzer Sprung, nicht mehr.“
Die anderen Männer, die sich über die Reling beugten, lachten auf, als Friedrich es endlich geschafft hatte und nach oben kletterte. Einer der Männer schlug ihm gutmütig auf die Schulter und sagte etwas in einer unverständlichen Sprache. Der Mann hatte eine ungewöhnlich dunkle Haut und eine ausgeprägte Hakennase, doch Friedrich achtete nicht weiter darauf, sondern beobachtete die Bemühungen seiner Gefährten, endlich an Bord zu folgen. Inzwischen war die Dunkelheit hereingebrochen und zwei Männer beugten sich mit Laternen über den Einstieg hinab. Schließlich war es geschafft und als die Vier sich wieder gesammelt hatten, fiel ihnen ein netter älterer Herr auf, der sie gutmütig ansah und unbefangen lachte.
„Capitaine“, sagte Lerousse mit einer angedeuteten Verbeugung, „das sind die Neuen. Die Brüder Baumgarde und ihr Freund Kahlmann.“ Er wandte sich den Vieren zu. „Dies ist Capitaine de Croisseux.“
„Baumgart“, korrigierte Friedrich und übernahm das Wort. „Wir sind Brüder. Also, mit Ausnahme von Bernd Kahlmann. Der ist unser Freund. Wir wollen nach Amerika und...“
De Croisseux hob eine seiner Hände und nickte freundlich. „Nach Amerika. Ja, da wollen wir auch hin. Und da ihr auch dorthin wollt, werdet ihr eure Überfahrt wohl abarbeiten wollen, nicht wahr? Nun, ihr könnt sofort damit anfangen, denn wir gehen Ankerauf.“
Lerousse schob sie nach vorne, auf den Bug zu. „Helft am Gangspill.“
Sie hatten keine Ahnung, was das sein sollte. Hinter ihnen rief der Kapitän einen französischen Befehl und das Schiff schien plötzlich vor Leben zu wimmeln. Männer hasteten an den Brüdern und Kahlmann vorbei und zogen sie automatisch mit sich. Andere ergriffen die gitterartig verwobenen Leinen, Rahen genannt, die von den Flanken des Schiffes nach oben unter die Masten und ihre Rahen führten. Friedrich blickte ungläubig zu, wie behände die Seeleute dort aufenterten, dann zog ihn einer der seltsam dunkelhäutigen Männer zu einer Tonne, die vorne am Bug des Schiffes stand. In die Tonne waren Löcher eingearbeitet. Friedrich sah sie interessiert an, doch der Dunkelhäutige knuffte ihn unangenehm in die Seite und wies auf ein paar lange weiße Rundhölzer, die an der vorderen Reling des Schiffes festgebunden waren. Die Brüder und ihr Freund sahen zu, wie andere Männer diese Rundhölzer aus den Halterungen nahmen und in die Löcher der Tonne steckten. Allmählich sah diese aus wie die querliegende Nabe eines Speichenrades, allerdings ohne Reifen. So nahmen sie ebenfalls zwei der Hölzer und steckten sie in die dafür vorgesehenen Öffnungen. Insgesamt standen zehn Mann an den fünf Speichen und alle waren in eine Richtung ausgerichtet. Einer von ihnen stieß einen leisen Ruf aus und die Männer drückten gegen die Speichen. Also taten es die Brüder und Kahlmann ebenfalls. Erst tat sich nichts, doch nach ein paar Versuchen bewegte sich die Nabe, das Gangspill, langsam. Ein leises Klicken ertönte. Begleitet von leisen Anfeuerungsrufen des Dunkelhäutigen drückten sie gegen die Speichen, hörten das leise Klicken, während sie kreisförmig um die Nabe herum gingen. Dann begriff Friedrich endlich, dass sie auf diese Weise die Ankerkette mit dem Anker nach oben holten.
Der Dunkelhäutige rief etwas nach hinten, zum Heck des Schiffes. Dort stand Kapitän de Croisseux am Ruder der Marbelle. Er stieß ein gedämpftes Kommando aus und über ihnen ertönte ein Flappen. Friedrich sah, wie sich das große Segel an den Rahen nach unten entfaltete. Irritiert erkannte er, dass dieses Segel eine dunkle Färbung hatte. Gegen den Nachthimmel war es nur dadurch zu erkennen, dass es ein wenig dunkler war und die Sterne verdeckte. Die Segel, die er bislang gesehen hatte, waren alle hell gewesen und diese Erkenntnis gefiel Friedrich absolut nicht. Die Marbelle musste tatsächlich ein Schmugglerschiff sein. Wunderbar, zu Hause wurden sie von den Königlichen gejagt, und wer wusste schon, wer auf den Meeren wohl Jagd auf de Croisseux und seine Marbelle machte.
Am Heck ertönte ein rhythmisches Schleifen, als das Lateinersegel an seinen Führungsringen den Mast hochgezogen wurde. Friedrich taumelte, als ein Windstoß die Segel traf und schlagartig füllte. Die Marbelle legte sich sanft auf die Seite. Nicht viel, doch für Friedrich und die anderen erschien es im ersten Moment, als kentere das Schiff. Die anderen Männer lachten auf, bis der Dunkelhäutige sie zur Ruhe ermahnte. Die Holme wurden wieder aus dem Gangspill geholt und angebunden. Zwei Männer hatten den hochgezogenen Anker inzwischen mit einer Kette gesichert.
Die drei Brüder standen mit ihrem Freund an der landseitigen Reling und starrten mit offenem Mund auf Marseille, das langsam nach hinten auswanderte und sich plötzlich hinter dem Schiff befand. Allmählich wurde das Land kleiner. Friedrich blickte auf den Schornstein der Dampfmaschine. Kein Maschinengeräusch war zu hören. Nur das Knarren von Holz und das Singen der gespannten Takelage. Dazu das Flappen der Segel. Mit leisem klatschen schlugen die Wellen gegen den Rumpf. Das Deck war ein wenig geneigt, doch langsam richtete es sich auf.
Pierre Lerousse stand plötzlich neben ihnen und grinste sie breit an. „Kommt, meine Freunde, ich zeige euch, wo ihr eure Hängematten aufspannen könnt. Habt ihr Hunger?“
Hatten sie. In den folgenden Tagen lernten sie eine ganze Menge über das Schiff und seine Besatzung. Sie lernten die Masten und Segel, Fallen, Blöcke, Leinen und Taue zu unterscheiden. Sie lernten auch, dass ein Tampen ein kurzes Tauende war, und wie ausgezeichnet Lerousse es zu benutzen verstand, um sie und die Mannschaft zu größerem Eifer anzuspornen. Draußen auf dem Mittelmeer startete auch die Maschine. Lerousse führte sie ins Unterdeck, wo es erbärmlich stank. Nach einer merkwürdigen Mischung aus Exkrementen, Schweiß und Ruß. In einem großen Raum stand die Dampfmaschine. Sie waren einer solchen Maschine noch nie so nahe gewesen.
Lerousse grinste sie an. „Für die Segelarbeit seid ihr wohl kaum geeignet. Aber das hier ist nicht schwer. Sehr ihr, diese Klappe ist die Feuerung. Dort hinein kommen Holz oder Kohle. Das befeuert den Kessel, in dem sich Wasser befindet. Das wird erhitzt und erzeugt Dampf. Der bewegt die Kolben. Ja, genau, diese langen Zylinder. Seht ihr, wie sie die Welle bewegen? Sie liegt quer zum Schiff und an ihren Enden befinden sich die Schaufelräder. Du“, er deutete auf Hans, „was passiert, wenn ein Topf überkocht?“
„Na, der Deckel geht hoch“, sagte der 15-jährige prompt.
Lerousse lachte auf. „So ist es. Der Deckel geht hoch.“ Er wies mit ausholender Geste um sich. „Das hier, das Schiff, das ist der Deckel. Wenn der Druck im Kessel zu hoch ist... bumm.“
Seine Zuhörer erblassten und der Maat grinste sie breit an. „Damit das nicht passiert, gibt es das hier.“ Er wies auf eine federnd gelagerte Stange. „Das ist das Sicherheitsventil. Haben wir zu viel Druck, dann geht es nach oben und Druck wird abgelassen. Und es passiert das hier.“
Lerousse zog seine doppelläufige Pistole aus der Schärpe und drückte von unten gegen das Ventil. Ein schrilles Pfeifen ließ alle erschrecken. Vom Niedergang, der Treppe, die nach oben führte, erklang ein Poltern und einer der Besatzung sah verschreckt herein. Lerousse und ein Mann, der den Kessel mit Brennmaterial beschickte, lachten laut auf. „Gut, hier, dieses Rad, regelt den Dampfdruck. So fahren wir schneller oder langsamer, oui?“
Er gab ihnen einen Schnellkurs im Maschinenraum und der Umgang mit der Dampfmaschine war nicht besonders kompliziert. Es gab eine Kupplung für den Vor- und Rückwärtsgang der Welle. Doch die ganze Maschinerie wurde von nur einem der dunkelhäutigen Männer bedient, die den größten Teil der Besatzung ausmachten.
Die Besatzung. Friedrich und die anderen hätten keinem von ihnen freiwillig ihr bisschen Geld anvertraut. Die meisten waren dunkelhäutig und sprachen einen Dialekt, den keiner der Freunde verstand. Lerousse, de Croisseux und drei andere schienen die einzigen Franzosen an Bord zu sein. Sie waren auch die einzigen, die ständig bewaffnet waren. Die Disziplin an Bord der Marbelle war allerdings beeindruckend. Jede Anordnung von Kapitän oder Maat wurde rasch ausgeführt. Nur selten wurde der Tampen benutzt.
Karl hatte einmal aufbegehrt, als Lerousse ihn mit dem Tampen ermahnte, nicht zu trödeln. Der Maat hatte freundlich gegrinst. „Was ist, mein Freund? Du willst doch nach Amerika, nicht wahr? Willst du zum Kapitän gehen und dich beschweren, oui?“
Die Marbelle war früher wohl einmal ein Kriegsschiff gewesen. Im Schanzkleid befanden sich insgesamt acht Stückpforten. Vier auf jeder Seite. Doch nur hinter zweien von ihnen befanden sich noch Kanonen. Sie waren klein. Karl, der ein wenig davon verstand, behauptete, es handele sich um 4-Pfünder-Vorderlader, die ein Geschoss von vier Pfund verschießen konnten. Friedrich war das egal. Ihm waren Kanonen zuwider. Vor allem Kanonen wie diese, die sehr gepflegt aussahen. So, als würde man damit rechnen, sie benutzen zu müssen.
Die Verpflegung war nicht schlecht. Zumindest hatten sie schon übleres gegessen. Es gab Brot, Wurst, Käse und Fisch. Einmal am Tag kochte einer der Männer. Meist eine undefinierbare Masse, die an Haferschleim erinnerte und die undefinierbare Brocken enthielt. Aber es war essbar. Vor allem, wenn man hungrig genug war. Regelmäßig ließ der Kapitän Sauerkraut ausgeben. Die Brüder und Kahlmann erinnerte das wehmütig an die Heimat. Die anderen schienen es mit Widerwillen zu sich zu nehmen.
„Gegen den Skorbut“, erklärte Lerousse. „Bei der Überfahrt nach Amerika werden wir auch Zitronen an Bord haben.“
Skorbut war ihnen bekannt. Davon hatte auch Hauptmann Wenzel gesprochen, als er ihrer Kompagnie erklärte, auf genügend Kraut zu achten, da sonst die Zähne ausfallen könnten. Gott, sie hatten einige in der Freischar gehabt, die schon aus Altersgründen keine mehr besessen hatten.
An die Schaukelbewegungen des Schiffes gewöhnten sie sich allmählich. Die ersten Tage konnte nur Hans sein Essen bei sich behalten und als er sich einmal gegen den Wind erbrach, lernte er auf die harte Weise, wie man es richtig machte. Aber das mit den Segeln, das war nichts für sie, da hatte Pierre Lerousse Recht. Lieber im Maschinenraum, mit seiner drückenden Enge und Hitze, Holz und Kohle schaufeln. Bei den Segeln, da ging es über dreißig Meter hinauf, bevor man die Rahen erreichte. Unter diesen zogen sich Leinen entlang, die sogenannten Fußpferde, auf welche die Matrosen ihre Füße stellten, wenn sie mit den Segeln arbeiteten. Oh, sie alle hatten schon auf Bergen gestanden, die weit höher als dreißig Meter waren. Aber die hatten sich nicht bewegt. Karl probierte es ein einziges Mal aus und versuchte nach oben aufzuentern. Schon auf halber Strecke krallte er sich in die Wanten und stierte mit aufgerissenen Augen auf Deck und Bordwand unter sich. Und das Wasser. Mal war das Deck unter ihm, mal hing er scheinbar frei über dem schäumenden Meer. Es brauchte zwei Männer, um ihn wieder nach unten an Deck zu bringen und während die Seeleute lachten, konnten die Brüder und Bernd seine Gefühle nachempfinden.
Die Marbelle befuhr das Mittelmeer. Bernd Kahlmann kannte sich ein wenig mit den Sternen aus und wusste, dass sie nach Süden fuhren.
„Das ist nicht der Weg nach Amerika“, sagte Friedrich nachdenklich. Soviel war ihnen allen klar. Sie hatten die Karten von Bruder Markus noch in Erinnerung.
„Afrika“, sagte Bernd lakonisch. „Es geht nach Afrika.“
Friedrich dachte daran, dass der Maat davon gesprochen hatte, sie würden auf der Weiterfahrt nach Afrika Zitronen an Bord haben. Wahrscheinlich lud die Marbelle in Afrika die dortigen Früchte. Er hatte keine Ahnung, ob sich damit Geld machen ließe. Zumal es in der Marbelle weiß Gott nicht nach Früchten roch.
Obwohl sie das Mittelmeer befuhren und sie wussten, dass es eigentlich recht klein war, gemessen an den Ozeanen der Welt, begegneten sie kaum einem anderen Schiff. Dabei sollte das Mittelmeer dicht befahren sein. Doch nur zwei oder drei Mal sahen sie am Horizont Segel oder eine dünne Rauchfahne, die auf ein Dampfschiff hinwies.
Abends kehrte eine friedvolle Stille auf dem Schiff ein. Manchmal war eine Fidel zu hören oder eine Flöte und auch Gesang. Dann standen die Brüder oft an Deck, lehnten an der Reling und sahen hinaus über das Meer und genossen den Sonnenuntergang oder die Pracht des Sternenhimmels. Das waren die Momente, in denen die Baumgarts und Bernd Kahlmann von Zuversicht erfüllt wurden.
Sie waren auf dem Weg nach Amerika und in die endgültige Freiheit von jeglicher Knechtschaft und Abhängigkeit.