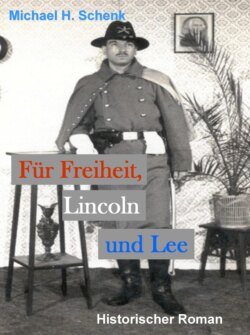Читать книгу Für Freiheit, Lincoln und Lee - Michael Schenk - Страница 6
Kapitel 4 Erkenntnisse
ОглавлениеDie Sonne brannte unbarmherzig auf das Deck der Marbelle. Es war derart heiß, dass der Teer zwischen den einzelnen Planken weich wurde und an den Sohlen der Schuhe zu kleben begann. Friedrich Baumgart fragte sich unwillkürlich, wie die barfüßigen Besatzungsmitglieder dies aushielten. Immer wieder wurden Eimer mit Wasser aus dem Meer gezogen und über die Holzplanken geschüttet. Zwischen den Masten war das Beiboot der Marbelle auf hölzernen Auflagen festgezurrt. Auch das Boot wurde immer wieder mit Wasser gefüllt. Lerousse erklärte ihnen, dass sich das Holz sonst derart verziehen könne, dass das Boot undicht wurde. Die einstigen Kanonenpforten des Schiffes waren geöffnet, damit etwas Luft in das überhitzte Zwischendeck gelangte. Den dunkelhäutigen Besatzungsmitgliedern machten die Temperaturen kaum etwas aus.
„Berber“, knurrte der Maat der Marbelle. „Zähe Kerle. Aber wendet ihnen nie den Rücken zu, wenn ihr etwas Wertvolles in den Taschen habt.“
Inzwischen schlenderte auch Kapitän Jean de Croisseux öfter auf dem Deck seines Schiffes entlang. Oft wirkte er in Gedanken versunken und es war bewundernswert, mit welcher traumwandlerischen Sicherheit er Leinen, Krampen und Ösen an Deck auswich. Er schien jeden Zentimeter seines Schiffes in- und auswendig zu kennen. De Croisseux hob sich deutlich vom Rest der Mannschaft ab. Er trug nun eine Uniform, wie die Brüder sich dies bei einem Seeoffizier immer vorgestellt hatten. Über der weißen Hose einen langen, zweireihig geknöpften dunkelblauen Rock und dazu eine weiche und ebenfalls dunkelblaue Schirmmütze. Den Rock hatte er offen und man erkannte darunter einen braunen Ledergürtel, in dem sich die obligate doppelläufige Pistole befand.
Einmal hatte Karl behauptet, eine fremde Stimme gehört zu haben, aus der Kajüte des Kapitäns. Aber keiner der anderen hatte sie vernommen und Karl war sich zu unsicher, um de Croisseux danach zu fragen.
„Was versprecht ihr euch von Amerika?“, fragte der Kapitän eines mittags unvermittelt, als die Brüder Baumgart und Bernd Kahlmann gerade dabei waren, im Schatten des Großsegels auszuruhen.
„Capitaine?“ Friedrich sah den großen Mann irritiert an.
De Croisseux lachte leise. Sein Alter war schwer einzuschätzen. Er mochte um die Fünfzig oder auch älter sein. Die langen Jahre auf See hatten ihre Spuren in seinem Gesicht hinterlassen. Sein rundliches Gesicht war von einem graumelierten Vollbart eingerahmt, über dem zwei blaue Augen blitzten. Er strahlte eine Freundlichkeit aus, die in krassem Gegensatz zu der Ausstrahlung stand, die von seinem Schiff und dessen übriger Mannschaft ausging.
„Ihr hättet euch doch auch in der Republik niederlassen können.“ Er sprach das Wort Republik mit einem merkwürdig verachtenden Ton aus. „Warum zieht es euch nach Amerika?“
Friedrich zuckte verwirrt die Achseln. „Also, eigentlich weil unser Hauptmann es erwähnt hat.“
„Hauptmann?“
„Wir waren seit 48 dabei“, erklärte Friedrich.
„Auch in der Paulskirche“, sagte Karl eifrig. „Bei den Versammlungen.“
„Bei den Versammlungen“, wiederholte de Croisseux mit monotoner Stimme. Er lachte leise. „Glaubt ihr wirklich an die Gleichheit der Menschen? An unveräußerliche Rechte?“
„Äh, ja“, meinte Friedrich zögernd. „So ist es doch auch in Amerika, nicht wahr? Ich meine, die haben doch damals gegen den englischen König revoltiert und ihre Freiheit erstritten. Eben wegen der Gleichheit der Menschen. Da drüben, in Amerika, sind alle Menschen gleich und sie sind frei.“
Der Kapitän lachte nun lauthals. Die Brüder sahen ihn verwirrt an, während dem älteren Mann die Tränen über die Wangen liefen. De Croisseux nahm seine Mütze ab, wischte sich das Wasser aus den Augen und setzte die Kopfbedeckung wieder auf. Dann sah er die vier Deutschen belustigt an. „Es ging nicht um die Freiheit. Es ging um die Steuern. Um Geld. Es geht immer nur um Geld. Habt ihr von der Bostoner Teeparty gehört?“ Er lachte erneut. „Die Yankees haben sich wegen der hohen Teesteuern empört und schließlich, aus Protest, im Hafen von Boston den englischen Tee ins Wasser geworfen. Das war der Auslöser.“
„Mag sein“, sagte Bernd Kahlmann, „aber sie haben eine Unabhängigkeitserklärung, die gleiche Rechte garantiert.“
Der Kapitän sah sie forschend an. „Ihr seid ja Deutsche, nicht wahr? Drüben gibt es viele Deutsche. Wisst ihr eigentlich, dass es nur an einer Stimme in der amerikanischen Nationalversammlung gelegen hat, und in Amerika würde man nun Deutsch sprechen? Die erste Fassung der sogenannten Unabhängigkeitserklärung wurde, glaube ich, sogar in deutscher Sprache verfasst.“
„Ist das wahr?“ Hans sah de Croisseux mit offenem Mund an. „Das sind Deutsche?“
„Nein, du Blödmann“, korrigierte Friedrich. „Aber es gibt dort halt viele von uns.“
„Ja, viele“, stimmte der Kapitän zu. „Damals haben viele deutsche Einheiten auf Seiten des englischen Königs gekämpft. Meist gepresste Regimenter und viele von denen sind nach dem Krieg dageblieben. In der Freiheit.“
Wieder fiel es Friedrich auf, wie der Kapitän das Wort Freiheit betonte. „Ihr haltet wohl nicht viel von der Freiheit und der Demokratie.“
Der Kapitän wies über das Wasser. „Das hier, das ist Freiheit. Die See. An Land gibt es immer einen Herrscher. Egal ob er sich Kaiser, König oder Präsident nennt.“ De Croisseux spuckte aus. „Und immer bestimmt das Geld den Lauf der Dinge.“
„Ihr klingt so, als wäret Ihr kein großer Freund von Amerika“, wandte Bernd Kahlmann ein.
„Aber nein.“ Der Kapitän sah sie betroffen an und seine Geste wirkte aufgesetzt. „Ich bin ein großer Freund Amerikas. Ohne Amerika hätte ich wohl kaum mein Vermögen. Es ist fast schon eher meine Heimat, als Frankreich.“
„Warum seid Ihr fort aus Frankreich?“, fragte Friedrich geradeheraus.
Der Kapitän richtete sich ruckartig auf. „Das geht euch nichts an. Und nun genug gefaulenzt. Das Beiboot muss wieder bewässert werden.“
Der Kapitän räusperte sich und ging zum Heck der Marbelle zurück.
Pierre Lerousse hatte einen Teil des Gespräches gehört und während die Brüder Eimer aufnahmen, lehnte er sich an die Reling und sah sie aufmerksam an. „Ich empfehle euch, ihn nicht mehr darauf anzusprechen. Gerade euch.“
Friedrich verstand die versteckte Drohung hinter den Worten. „Wir haben ihm nichts getan. Er ist doch sehr freundlich.“
„Nein, ihr habt ihm nichts getan.“ Lerousse grinste. „Aber euresgleichen. Er war mal ein Mann von Bedeutung im Süden Frankreichs. Bis das Pöbel sich erhob. Heute ist er dort nur geduldet und oft nicht einmal das.“ Er musterte die Deutschen eindringlich. „Er hat Revolutionäre nicht unbedingt in sein Herz geschlossen, oui?“
„Warum sagte er vorhin Yankees zu den Amerikanern?“
Der Maat kratzte sich hinter dem Ohr. „Na, so ganz genau weiß ich es nicht. Aber so um 1630 wurde in dem Gebiet um New York eine holländische Siedlung gegründet. Neu Amsterdam. Damals gab es auch englische und schwedische Kolonisten. Die sagten zu den Holländern Jan Cheese. Jetzt sitzen dort die Amerikaner und alle die aus der Gegend kommen, nennt man nun Yankees. Ich persönlich glaube eher, es kommt von den Schreien, die ihre Maultiere ausstoßen.“ Lerousse lachte. „Jedenfalls sind die Yankees ganz schön stur, das werdet ihr noch feststellen.“
„Sind wirklich so viele von uns drüben?“ Hans mochte es noch immer nicht ganz begreifen.
„Ihr werdet euch wundern.“ Der Maat blickte kurz zum Heck. „Deutsche, Holländer, Iren und weiß Gott, wer noch alles. Aber genug geschwatzt. Macht euch an die Arbeit.“
Sie nahmen die Eimer auf.
An einem heißen Morgen tauchte im Sonnenglast, direkt vor dem Bug der Marbelle, ein schmaler Strich am Horizont auf. Der Ausguck oben im Mastkorb sah es als erster und rief es an Deck hinunter. Kapitän de Croisseux kam aus seiner Heckkajüte nach oben und trat neben das Ruder. Mit einem Fernglas blickte er voraus und nickte dann zufrieden.
Plötzlich schien wieder eine zunehmende Anspannung über dem Schiff zu liegen. Die Marbelle steuerte die Küste an und folgte ihrem Verlauf.
„Das also ist Afrika“, sagte Friedrich nachdenklich. Besonders beeindruckt war er nicht. Eher enttäuscht. Vor ihnen breitete sich eine steinige Küste aus. Teilweise hohe und schroffe Klippen, die allmählich in flachere Strände übergingen. Es war kaum Grün zu sehen.
„Marokko“, sagte Pierre Lerousse. „Wir sind jetzt ungefähr in Höhe von Beni-Saf und fahren östlich auf Oran zu. Wir werden bald an Land gehen.“
„An Land gehen?“ Karls musterte die Küste. „Gott im Himmel, hier ist doch nichts zu holen. Hier gibt es nichts. Kein bisschen Grün, keine Ansiedlung und keine Menschen.“
„Mehr als ihr denkt“, lachte Lerousse. „Mehr als ihr denkt. In diesem Moment werden wir sicher von mehr Augen beobachtet, als wir an Bord haben.“
Unter dem leisen Stampfen ihrer Maschine und begleitet vom Rauschen der Schaufelräder glitt das Schiff in langsamer Fahrt an der Küste entlang. Eine etwas dunklere Stelle tauchte in der Küstenlinie auf und de Croisseux rief ein paar Kommandos. Der Bug der Marbelle schwang ein wenig herum und schob sich näher an die Küste heran. Aus der dunklen Stelle wurde ein Einschnitt, der ins Land hineinzuführen schien. An den Deutschen vorbei hastete ein Besatzungsmitglied, das eine lange Leine mit dem Lotblei mit sich führte. Sie sahen, wie der Mann frisches Wachs in das unten offene Senkblei füllte und dann zum Bugspriet ging. Er trat auf die darunter befindlichen Rüsten, schwang die Leine und ließ das Blei ins Wasser klatschen. Die Leine glitt durch die Hände des Mannes und man konnte deutlich die Knoten erkennen, die sich in regelmäßigen Abständen in ihr befanden. Der Mann rief etwas nach hinten und de Croisseux nickte sichtlich zufrieden.
Die Fahrt wurde noch langsamer. Der Kapitän trat an den Rudergänger heran und übernahm selbst das Steuerrad. Lerousse ging gemessenen Schrittes nach vorne zu dem lotenden Matrosen. Als das Blei aus dem Wasser auftauchte, betrachtete der Maat das Wachs an seiner Unterseite und betastete den daran klebenden Sand. Dann klatschte das Lot wieder ins Wasser. Langsam schob sich die Marbelle in den Einschnitt und vor ihnen öffnete sich eine kleine, abgeschiedene Bucht mit weißen Stränden. Ein paar Palmen wurden sichtbar und am Ende der Bucht ein hölzerner Steg und ein paar Hütten. De Croisseux ließ die Maschinen im Leerlauf fahren und das Schiff glitt, nur durch seine Eigenbewegung, durch das klare Wasser. Man konnte den Schatten des Schiffes auf dem Grund der Bucht erkennen. Ein paar Fische eilten geschäftig umher und wichen hastig aus, wenn der Schatten auf sie fiel.
Lerousse schaute angespannt auf den Schatten unter ihnen, der sich verkürzte. Er blickte kurz zum Heck und bemerkte dabei die interessierten Blicke der Brüder und Kahlmanns. „Sandet schnell zu, die Bucht. Müssen Acht geben, dass wir nicht auflaufen. Das könnte sehr peinlich werden, oui?“
Man musste neidlos anerkennen, dass die Crew das Schiff beherrschte. De Croisseux brauchte nicht in der kleinen Bucht zu ankern und mit dem Beiboot zum Ufer zu fahren. Gekonnt legte die Marbelle an dem Steg an. Sofort sprangen Besatzungsmitglieder auf die hölzernen Bohlen und legten Leinen über die aufragenden Balken. Als das Schiff zur Ruhe kam, ächzte der Steg protestierend, doch er hielt.
Sie blickten auf den Steg und die Hütten, die im Hintergrund sichtbar waren. Alles wirkte verlassen und heruntergekommen. Die Hütten lagen im Schatten eines kleinen Palmenhains und ihre Lehmwände und Strohdächer hoben sich deutlich vom Hintergrund ab. Doch keine Bewegung war zu erkennen.
„Willkommen in Ashouff“, sagte Lerousse grinsend. „Sieht aus wie der Arsch der Welt, nicht wahr?“ Der Maat lachte auf. „Aber ich sage euch, es ist ein goldener Arsch. Kommt mit, wir müssen uns ausrüsten.“
Der Maat ging mit ihnen nach hinten und der Kapitän begleitete sie in seine Heckkajüte. Sie sahen das Allerheiligste des Kapitäns zum ersten Mal. Die Kajüte war niedrig und sie mussten die Köpfe einziehen, um nicht an die Decksbalken zu stoßen. Ansonsten war die Kajüte erstaunlich geräumig. Sie ging über die gesamte Breite des Schiffes, und das gesamte Heck und ein Teil der Seiten waren verglast. Der Schliff des Glases war nicht einwandfrei und seine Schlieren verzerrten den Hintergrund. Durch ein Oberlicht fiel Licht von oben, direkt auf einen wertvoll gedrechselten Schreibtisch. Ein dicker Teppich bedeckte den Boden und sie sahen zwei mit samt bezogene Stühle sowie die Koje des Kapitäns.
In der Koje lag eine schwarzhäutige Frau. Die vier Deutschen stierten sie gleichermaßen geschockt und ungläubig an. Keiner von ihnen hatte geahnt, dass sich ein weibliches Wesen an Bord befand. Die Frau war für sie ein unglaublicher Anblick. Nicht nur, weil sie scheinbar vollkommen nackt war und sich offensichtlich nichts daraus machte, sondern weil ihre Haut tiefschwarz war. Nie zuvor hatten sie einen Menschen mit einer solchen Hautfarbe gesehen.
Noch bevor sie etwas sagen oder fragen konnten, zerrte Lerousse sie zu einem Schrank an der Seite der Kajüte, den der Kapitän aufschloss. Gezielt nahm de Croisseux eine Reihe von Waffen heraus und gab sie den Brüdern und Bernd Kahlmann.
Verwirrt betrachtete Friedrich die Pistole und das ungewohnte Entermesser, dass der Kapitän ihm gab. „Waffen? Ich... wieso sollen wir Waffen...?“
„Dies ist ein gefährliches Land und unsere Geschäftspartner sind auch nicht ohne“, sagte der Kapitän trocken. „Es ist besser, vorbereitet zu sein. Dann kommen sie gar nicht erst auf dumme Gedanken.“ Er bemerkte die Blicke, die sie der nackten Frau zuwarfen. „Das Privileg des Kapitäns. Für euch werden sich andere Gelegenheiten ergeben. Doch nun an Deck.“
Bernd Kahlmann warf erneut einen Blick auf die Frau. Was hatte sie hier zu suchen? „Wer ist das? Sie sieht... ungewöhnlich aus. Ihre Nase und ihre Lippen...“
„Afrikanerin“, sagte Lerousse, als erkläre dies alles. „Schöne volle Lippen, nicht wahr?“ Er lachte auf. „Manchmal sind sie besonders voll.“
Lerousse griff sich in einer eindeutigen Geste in den Schritt und die Männer begriffen errötend, was er damit meinte. Lerousse sah ihre Verlegenheit, lachte erneut auf und schob sie aus der Kajüte. Nervös standen sie dann an Deck und befingerten die Waffen. Auch die anderen Besatzungsmitglieder waren nun bewaffnet. Die meisten trugen die langen und breiten Entermesser mit dem Handschutz, einige hatten merkwürdig lange Gewehre.
Der Maat wies auf die ungewöhnlichen Flinten. „Davor nehmt euch in Acht. Die schießen unglaublich weit und sehr genau. Sind besser als unsere Musketen.“
Sie gingen in zwei Gruppen über den hölzernen Steg. Als sie zur Marbelle zurückblickten, sahen sie, dass die beiden Vierpfünder auf der dem Land zugewandten Seite aus den Pforten ragten. Erneut fragten sie sich, in was sie hier geraten sein mochten. Der Kapitän führte sie auf die vereinsamten Hütten zu. Friedrich warf einen Blick hinein, würgte kurz und übergab sich dann.
Der Maat klopfte ihm gutmütig auf den Rücken. „Keine Angst, mein Freund, die tun dir nichts.“
Nein, sicher nicht. Friedrich drehte sich der Magen und seinen Gefährten erging es nicht viel besser, als sie in die Hütte hinein sahen. Viel gab es nicht zu sehen, doch das wenige war bereits zu viel. Die Hütte war leer. Fast. An den Wänden waren eiserne Ringe angebracht und Handeisen lagen auf dem Hüttenboden verstreut An eine der Wände war ein Mensch gekettet worden. Vor langer Zeit, denn er war vollständig skelettiert und nur ein paar Stofffetzen lagen lose um die Knochen seiner Hüften.
„Herr im Himmel“, stammelte Karl kreidebleich. „Was ist hier geschehen?“
„Er war aufsässig“, sagte Lerousse lakonisch. „Ein gutes Exempel für andere.“
„Andere?“ Friedrich sah ihn kopfschüttelnd an. Er wischte über den Mund und würgte erneut, aber sein Magen hatte sich geleert und er spürte nur ein unangenehmes Brennen in der Kehle. „Oh Gott, ihr... ihr seid Sklavenhändler.“
„Das schwarze Gold“, sagte der Maat bestätigend. „Seht mich nicht so an. Diese Leute sind nicht mehr als Tiere, das werdet ihr rasch genug erkennen. Im Grunde tun wir ihnen einen Gefallen, denn wir verschaffen ihnen gute Arbeit und ein gesichertes Heim.“
Friedrich kämpfte mit sich. Er war versucht, die Pistole zu ziehen und diesen grinsenden Franzosen einfach über den Haufen zu schießen. Sklaverei. Das widersprach allem, was er für seine Ideale hielt. Schon die Lakaien der Adligen waren für ihn kaum mehr als Sklaven. Und nun das hier.
Der Maat spürte seine Unsicherheit. Die Augen des Mannes verengten sich. „Begehe keinen Fehler, mein Freund.“ Dann lachte er plötzlich. „Wir müssen gut aufeinander acht geben. Ah, da kommen unsere Freunde, oui?“
Oben auf der flachen Hügelkette, welche die Bucht umgab, war ein Reiter aufgetaucht. Er trug ein lange wallendes Gewand und hatte ein Tuch um den Kopf geschlungen, dessen lange Enden im schwachen Wind flatterten. Der Mann saß auf einem Kamel und die Brüder starrten das Tier erstaunt an. Keiner von ihnen hatte je ein solches Tier zu Gesicht bekommen. Der Reiter trug eine der langen arabischen Flinten und hob sie über seinen Kopf. Dann belebte sich der Hügel mit einem mal. Unbewusst drängten sich die Deutschen zusammen, als nun eine Horde Bewaffneter den Hang herunter ritt. Zwischen ihnen bewegten sich Reihen von schwarzen Menschen, durch Ketten oder Stricke miteinander verbunden. Gelegentlich stolperte eine der langsam trottenden Gestalten. Wenn diese nicht von alleine auf die Füße kam, wurde sie einfach mitgezogen. Friedrich wurde von Grauen geschüttelt. Es war eine Karawane des Elends und er sah ausschließlich junge Frauen und Männer. Hin und wieder schlug einer der Reiter mit einer Peitsche nach den elenden Gestalten.
Die Bewaffneten führten die Gruppe der Gefangenen auf den Platz zwischen den leeren Hütten und bildeten einen Ring. Einer der Reiter ritt auf de Croisseux zu und riss sein Pferd vor ihm hoch. Der Araber lächelte kaum merklich, als der Kapitän keine Miene verzog. Dann sprang er behände aus dem Sattel. Zwischen beiden Männern entspann sich ein intensives Gespräch.
Pierre Lerousse begutachtete die aneinander gebundenen Männer und Frauen. „Keine schlechte Ausbeute. Unser Freund scheint ein ganzes Dorf erwischt zu haben.“ Er sah die Brüder und Kahlmann an, die blass hinter ihm standen und ihre Waffen nervös umklammerten. „Wisst ihr, diese schwarzen Tiere haben oft genug ihre kleinen Streitigkeiten. Nicht selten verrät da einer dieser Niggerhäuptlinge das Nachbardorf an unseren Freund Massoud. Wenn das Dorf zu klein ist, schnappt Massoud sich mitunter auch den Kral des Verräters.“ Lerousse lachte auf. „Natürlich sind wir nicht die einzigen Abnehmer.“
„Ein ganzes Dorf.“ Karl musterte die Gefangenen. „Aber wo sind die Alten? Die Kinder?“
„Für uns nicht verwertbar“, sagte der Maat trocken. „Zu schwach für die Überfahrt. Nein, wir achten darauf, nur die gesunden und kräftigen zu bekommen.“
De Croisseux und dieser Massoud schienen sich geeinigt zu haben. Sie sahen, wie ein Beutel den Besitzer wechselte und der Berber gab seinen Männern einen barschen Befehl. Sie trieben die schwarzen Männer und Frauen in die Hütten hinein und die Deutschen hörten gelegentliche Schreie und das Klirren von Ketten.
„Gut, meine Freunde“, sagte Lerousse. „Für die Nacht sind sie versorgt. Morgen bringen wir sie aufs Schiff.“
„Warum erst morgen?“, fragte Friedrich wutentbrannt. „Gott, was seid ihr nur für Menschen?“
Pierre Lerousse sah ihn nachdenklich an. „Halte deinen Zorn im Zaum, mein Freund. Wenn uns jemand angreift, so wird es keinen Unterschied machen, ob ihr dafür oder dagegen seid. Man würde euch ebenso niedermachen, wie den Kapitän und uns andere. Mitgegangen, mitgehangen, nicht wahr, meine Freunde? So oder so ist dies unsere Fracht und es ist diese Fracht, die euch nach Amerika bringen wird, oui?“
Sollte dieses Elend der Preis für ihre Freiheit sein? Weiß Gott, so hatten sie sich dies nicht vorgestellt. Wie stolz waren sie gewesen, als die schwarz-rot-goldene Fahne der Freiheit erhoben wurde. Und jetzt machten sie sich zu Handlangern der schlimmsten Art von Menschen, die sie sich vorstellen konnten.
Bernd Kahlmann stieß ein heiseres Knurren aus. „Er hat Recht. Es hat keinen Zweck uns gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. Hauptsache, wir kommen nach Amerika.“
Friedrich sah zu den Hütten hinüber. „Ja“, murmelte er angewidert. „Hauptsache, wir kommen nach Amerika.“
Friedrich Baumgart glaubte nicht, dass in dieser Nacht einer von ihnen schlief. Die Nächte waren sehr kalt und er wunderte sich, dass ein Temperaturwechsel zwischen Tag und Nacht derart stark ausfallen konnte. Trotzdem brannte in der Nacht kein wärmendes Feuer. Im klaren Licht des Sternenhimmels konnte er Posten von Massouds Gruppe und solche der Marbelle erkennen, die sich gegenseitig beäugten und zugleich nach einem gemeinsamen Feind Ausschau hielten. Der 21-jährige nahm nicht an, dass die elenden Gestalten in den Hütten einer Wache bedurften. Selbst ohne Fesseln schienen sie kaum in der Lage, sich gegen ihre Peiniger zu erheben. Er fragte sich, was ihn hierher geführt hatte. In dieses öde Land zu diesen öden Gestalten. Angeblich sollte Afrika doch ein grünes und reiches Land sein, doch davon hatte er nichts gesehen. Nur weiße Augen, die ihn unnatürlich groß aus schwarzen Gesichtern anstarrten. Er dachte an die Männer um sich herum. Die Deutschen würden wohl mit diesen Wölfen heulen müssen. Er traute jedem aus der Mannschaft zu, ihn, seine Brüder und Bernd Kahlmann ohne Skrupel zu töten, wenn man befürchtete, diese würden den Sklavenhandel melden. Melden. Wo denn? Hier würde es wohl kaum eine Gendarmerie geben, die das Gesetz vertrat und wenn es sie gab, welche Gesetze mochten in einem Land herrschen, in dem so etwas geschehen konnte? Er und die seinen mussten einfach versuchen, mit heiler Haut aus dem Geschehen zu entkommen.
Am frühen Morgen stieß einer der Berber einen leisen Ruf aus und Friedrich staunte, wie rasch sich alle erhoben. Hatten all diese Männer tatsächlich geschlafen oder die Nacht mit der Waffe in der Hand wach gelegen und auf jedes verdächtige Geräusch gelauscht? Ihm war es jedenfalls so ergangen und er fühlte sich zerschlagen. Er sah Massoud und de Croisseux miteinander sprechen, dann lachte der Berber auf und gab seinen Männern einen Wink. Zwei kleine Säcke wurden zum Schiff gebracht und die Deutschen erfuhren später, dass sie mit Früchten gefüllt waren. De Croisseux ließ zwei Kisten an den Berber aushändigen und instinktiv ahnten die Deutschen, dass sich darin Pulver und Blei für die Flinten der Sklavenjäger befanden. Offensichtlich war ihr Anführer zufrieden. Er verabschiedete sich mit Umarmungen und umfangreichen Worten von dem französischen Kapitän und gab seiner Horde ein Zeichen. So rasch wie die Gruppe aufgetaucht war, verschwand sie auch und ließ die Crew der Marbelle mit ihrer elenden Fracht zurück.
Kapitän und Maat teilten die Besatzung in kleine Gruppen. Aus der Quelle der kleinen Oase wurden die Wasserfässer aufgefüllt. Der Kapitän und zwei andere Männer gingen nacheinander in die Hütten. Gelegentlich war leises Wehgeschrei zu hören und das Klirren der Ketten. Ein seltsames Raunen erhob sich und wurde zu einem seltsamen Singsang.
Lerousse sah die Deutschen an. „Ein gutes Zeichen. Sie sind noch kräftig genug, um zu singen. Aber der Kapitän wird rasch für Ruhe sorgen.“
Sie hörten einen vereinzelten Schuss und nach einer Weile kam der Kapitän wieder heraus. Einer seiner Begleiter lud dessen Pistole nach. De Croisseux trat zu seinem Maat. Rasch wechselten sie mehrere Sätze.
Nur Bernd Kahlmann konnte das schnelle Französisch verstehen. Er übersetzte es für seine Freunde. „Sie haben ein paar der Schwarzen die Kehlen durchgeschnitten. Denen, die wohl doch zu schwach für die Überfahrt sind. Der Kapitän meinte, Kugeln solle man da nicht verschwenden. Aber einer der schwarzen Affen habe nach ihm getreten und so habe er ihm den Schädel zersprengt. Jetzt sollen wir die Leute rasch aufs Schiff bringen. Massoud hat ihm zum Abschied gesagt, ein englisches Kriegsschiff patrouilliere in den Gewässern vor Beni-Saf.“
Rasche Befehle des Maats trieben sie auseinander und wenig später schob sich eine lange Reihe gefesselter Männer und Frauen auf den Steg und von diesem in das Unterdeck der Marbelle. Nun wurde den Deutschen auch klar, warum es dort so entsetzlich stank. Es war unfasslich, dass all diese Menschen dort unten hinein passen sollten. Die Matrosen der Marbelle schlugen und fluchten und trieben ihre Opfer in das Dunkel des Unterwasserschiffes hinein. Schließlich schlugen die Luken zum Unterdeck zu und Friedrich fröstelte es, als ihm klar wurde, dass er unmittelbar über den elenden Gestalten schlafen würde.
Ein paar der Frauen wurden aus der Reihe gezerrt und die Brüder und ihr Freund konnten sich denken, welchem Zweck sie dienen sollten. Während die Besatzung das Schiff zum Ablegen vorbereitete, wurden den Hilflosen immer wieder gierige Blicke und Obszönitäten zugerufen.
„Sie sind so... so... nackt“, stammelte Hans verwirrt. Der 15-jährige war wohl der einzige von ihnen, der noch nie ein entkleidetes Weib gesehen hatte. So viel entblößter Weiblichkeit ausgesetzt zu sein, verwirrte ihn. „Sind sie... äh, anders?“
„Anders?“ Friedrich sah die ängstlichen Frauen an. Die Haut war anders. Die Gesichter mit den vollen Lippen und den breiten Nasen unterschieden sich von denen europäischer Frauen, und es gab auch Unterschiede zwischen den Individuen. Das Haar war merkwürdig kraus. Ein um die Hüften geschlungenes Tuch bildete die einzige Bekleidung, obwohl man einigen der Frauen die Tücher bereits genommen hatte. Die Frauen wirkten auf Friedrich wie ihre Männer. Schlank und doch muskulös. Auf seltsame Weise erinnerten sie an Raubtiere. An die natürliche Anmut von Wölfen.
„Sie sehen aus wie Tiere“, knurrte Karl. „Ihre Gesichter sind hässlich.“
Bernd lächelte ironisch. „Es gibt genug Dinge an ihnen, die sind ganz ansehnlich.“ Er sah Hans an. „Offen gesagt, ich glaube es gibt eine ganze Menge Ähnlichkeiten zu weißen Frauen.“
„Gott“, Karl sah ihn betroffen an. „Das kannst du doch nicht miteinander vergleichen.“
Bernd Kahlmann wies auf die übrigen Mannschaftsmitglieder. „Die da sind wohl zufrieden mit der Ähnlichkeit.“
Etliche Männer standen um die kleine Gruppe Frauen herum, als die Stimme von Kapitän de Croisseux dazwischen fuhr. Ohne die Frauen weiter zu beachten, eilte die Crew auf die Manöverstationen. Ein zum Mastkorb aufgeenterter Matrose rief etwas nach unten und de Croisseux stieß einen Fluch aus.
Pierre Lerousse trat an die Reling und feuerte die Männer an, die Leinen klar zu machen. „Verdammt, eine Rauchfahne über der Kimm. Vielleicht nur ein Postdampfer. Aber wir müssen verschwinden.“ Er musterte die Brüder. „Na los, packt an.“
Sie sahen Männer zu den Rahen aufentern. Die Segel entfalteten sich.
Karl sah die anderen fragend an. „Warum wirft er nicht die Maschine an?“
Lerousse warf ihm einen grimmigen Blick zu. „Weil sie nicht unter Dampf geblieben ist. Das Sicherheitsventil ist alt und wenn der Maschinist eingeschlafen wäre... ihr versteht schon, bumm, oui? Der Kessel wird jetzt zwar hochgefahren, aber es wird eine Weile dauern, bis wir genug Druck haben.“
Erneut bewies de Croisseux seine seemännischen Fertigkeiten, denn er kreuzte die Marbelle scheinbar mühelos, wenn auch von Flüchen begleitet, aus der Bucht. Inzwischen war die dünne Rauchfahne am Horizont deutlicher geworden und die Männer glaubten unter dem Rauch etwas schimmern zu sehen. Der Kapitän stand am Heck und hatte sein Fernglas auf die Rauchsäule gerichtet. Mit einem Fluch schob er es zusammen.
„Zu schnell für ein Postschiff. Ich wette, es ist ein Kriegsschiff“, rief er Lerousse zu. „Wahrscheinlich ein verdammter Engländer.“
Die Marbelle legte sich unter Segeldruck leicht über, als sie auf neuen Kurs ging. Lerousse schrie ins Zwischendeck hinunter, man solle sich gefälligst beeilen, genug Dampf zu machen. Sie sahen nach hinten zum Heck, hinter dem die Rauchsäule stand und langsam größer wurde. Doch dies geschah unglaublich langsam. Erst fünf Stunden später konnte man mit bloßem Auge einen schwarzen Rumpf mit weißen Decksaufbauten erkennen. Die Nationalität konnte nur der Kapitän mit seinem Fernglas feststellen und er blickte immer wieder nervös hindurch, bevor er bestätigend nickte. „Ja, ein Johnny English, ein verfluchter Engländer.“
Diese Gewissheit schien den Kapitän jedoch zu beruhigen, denn er wandte dem Heck den Rücken und blickte in Fahrtrichtung voraus. Unter ihnen begann es zu rumoren und zu stampfen und de Croisseux rief triumphierend einen Befehl zur Maschine. Die großen, fast sechs Meter durchmessenden Schaufelräder begannen sich nun unter dem Dampfdruck zu drehen. Zuvor waren sie ausgekuppelt gewesen und nur der Wasserdruck der Fahrgeschwindigkeit hatte sie bewegt. Nun aber peitschten sie zunehmend in das Wasser, spritzten es auf und die Geschwindigkeit der Marbelle steigerte sich.
Dennoch kam der Engländer langsam näher und die Deutschen begannen sich zu fragen, wie ihr weiteres Schicksal aussehen mochte, wenn die Royal Navy das Sklavenschiff enterte. Die Teerjacken der königlichen Marine würden wohl keinen Unterschied zwischen der eigentlichen Besatzung der Marbelle und den Deutschen machen. Hinter ihnen ertönte ein dumpfer Knall und als sie erneut zu dem englischen Kriegsschiff zurückblickten, stieg dort am Vorderdeck eine braunschwarze Wolke in die Luft. Weit hinter der Marbelle stiegen Gischt und eine Wassersäule auf.
„Zu kurz“, erläuterte Lerousse grinsend. „Dauert noch zwei oder drei Stunden, bevor sie wirklich ernsthaft auf uns schießen können. Die machen nur ihrem Ärger Luft und wollen uns zeigen, dass sie kommen.“
„Gott im Himmel“, brach es aus Friedrich hervor, „habt Ihr denn keine Furcht, die Engländer bringen die Marbelle auf und hängen uns alle an die Rahen?“
„Ihr werdet schon sehen, dass sie das nicht wagen“, sagte Lerousse selbstsicher. „Wir haben noch eine Trumpfkarte, denn sie müssen uns beweisen, dass wir Sklaven an Bord haben. Wisst ihr, diese Briten haben... oh, holla, das war es dann wohl.“
Der Maat grinste den Kapitän an und dieser rief der begeistert aufschreienden Mannschaft etwas zu. Er sah die fragenden Mienen der Deutschen. „Sie fallen ab. Ziemlich plötzlich. Seht ihr? Sie liegen schon quer zum Wind. Denen ist wohl die Welle gebrochen.“
Tatsächlich verlor der Engländer schlagartig an Fahrt und ein trotziger Pfiff aus seiner Dampfpfeife ertönte, als das schnittige Schiff zur Seite trieb. Nun wurde auch die Fahrt der Marbelle ein wenig gedrosselt, um die Maschine zu schonen, und nach einigen Stunden war das Kriegsschiff hinter dem Horizont verschwunden.
Wenig später passierten sie Beni-Saf und fuhren auf die Meerenge von Gibraltar zu. Der Felsen von Gibraltar war in britischem Besitz. Eine Festung, welche die Meerenge beherrschte. Sie war nie erobert worden und ihre Geschütze boten Schutz für eine Reihe von Fregatten und Linienschiffen, die unter ihr ankerten. Dazu gehörte ein Tross kleinerer Schiffe und Versorgungsboote.
De Croisseux schien von der Festung keineswegs beunruhigt. Es war bewundernswert, wie er die Nacht abpasste und dann, dank der dunklen Segel und des wolkenverhangenen Nachthimmels, unbemerkt unter den Batterien Gibraltars hindurchfuhr. Zwar wurde ein Vorpostenboot auf sie aufmerksam, doch de Croisseux ließ geistesgegenwärtig die französische Flagge, am Heck der Marbelle, grüßend dippen. Im internationalen Gruß wurde sie kurz gesenkt und wieder aufgezogen und bevor der Brite sich entschloss, ob er das passierende Schiff kontrollieren sollte, war der Vorsprung des Sklavenschiffes bereits zu groß.
Nachdem Gibraltar hinter ihnen lag, verließ die Anspannung das Schiff und das Entsetzen begann. De Croisseux verließ die Brücke und ging in seine Kajüte, wohl um sich seinem Privatvergnügen hinzugeben, denn nun gab sich auch der Rest der Crew der Lust hin. Zwischen die Anfeuerungsschreie der Männer mischten sich die Entsetzensschreie und das Stöhnen der Frauen, die nun missbraucht wurden.
Die Baumgarts und Kahlmann waren froh, an Deck Wache zu schieben. Zum ersten Mal durfte Friedrich dabei das Steuerrad der Marbelle führen. Doch er verspürte keine Freude daran, das Schiff in seiner Hand zu wissen, wenn er an das Grauen unter Deck dachte, und seinen Gefährten ging es ebenso. Aber sie waren hilflos, denn der Kapitän und sein Maat hatten alle Waffen wieder unter Verschluss genommen.
Es mochte gegen Mitternacht sein, als es eine der Frauen irgendwie schaffte, an Deck zu gelangen. Friedrich stand hinter dem Rad und sah sie als erster. Auf ihn wirkte sie wie ein Gespenst aus einer anderen Welt. Der dunkle Körper, der sich gegen den Hintergrund schwach abhob, dazu das Weiß der Augen und der Zähne. Im schwachen Licht der Kompasslaterne konnte er ihre Nacktheit sehen und die Spuren, welche die Vergewaltigungen hinterlassen hatten.
Sie sahen sich für einen Moment schweigend an, während auf dem Niedergang Tumult einsetzte. Mehrere Männer drängten nach oben, um das entflohene Opfer wieder einzufangen. Als einer von ihnen mit einem triumphierenden Aufschrei nach der Schwarzen griff, erwachte Friedrich aus seiner Erstarrung. Er schob sich zwischen Mann und Frau, stieß diesen nach hinten. Im ersten Moment war der Matrose erstaunt, doch dann überzog ein gehässiges Grinsen sein Gesicht. Ein drohendes Murren stieg von den anderen auf und Friedrich sah seine Brüder, die sich von der Seite zu ihm heran drängten. Von Bernd Kahlmann war nichts zu sehen.
„Was ist hier los?“, klang die herrische Stimme des Maats auf. Lerousse tauchte aus dem Niedergang auf und sah sich um.
Einer der Männer sprach hastig auf ihn ein, wies auf Friedrich und die schwarze Frau, die sich instinktiv hinter den Deutschen zurückzog. Dann fielen andere Stimmen ein, bis der Maat wütend die anderen niederschrie. Er blickte Friedrich und dessen Brüder kalt an und trat näher.
„Nichts als Ärger, meine Freunde, oui?“ Er streckte die Hand aus und bevor Friedrich reagieren konnte, riss er die Schwarze an sich heran. „Wir können keinen Ärger auf der Marbelle brauchen, oui?“
Der Franzose hielt den Kopf der Schwarzen in den Nacken gebogen und plötzlich blitzte eine Klinge. Blut spritzte hervor, traf den geschockten Friedrich, sprühte über Steuerrad, Kompassgehäuse und seine Brüder. Die drei Baumgarts standen wie erstarrt. Lerousse hielt die Tote aufrecht, schob das Messer wieder in seinen Gürtel und griff ungeniert an Brüste und zwischen die Schenkel der ermordeten Frau, bevor er sie achtlos fallen ließ. Das seltsame Klatschen, mit dem die Leiche auf die Deckplanken schlug, holte die Deutschen aus ihrer Lähmung.
„Gott im Himmel“, sagte Friedrich tonlos. „Ihr seid Tiere. Ihr habt... habt diese Frau einfach... ermordet.“
„Kein Streit an Bord“, sagte Lerousse langsam. „Vor allem nicht wegen einer Niggermöse. Wir haben genug davon an Bord.“ Er sah auf die verkrümmt liegende Leiche. „Fast schade. Sie fühlte sich recht gut an. Die hätte guten Gewinn gebracht.“
Friedrich stürzte vor, spürte einen heftigen Hieb und dann versank die Nacht um ihn in tiefer Finsternis.
Er konnte nur ein paar Minuten bewusstlos gewesen sein. Als er zu sich kam, lag er neben der Heckreling und seine Brüder knieten bei ihm. Die anderen Männer waren verschwunden.
Pierre Lerousse stand am Rad. Er blickte Friedrich abschätzend an. „Ah, wieder wach, mein Freund?“
Der Maat wandte Friedrich sorglos den Rücken, während dieser sich mit Hilfe der Brüder ächzend erhob. „Ihr habt nun zwei Möglichkeiten, meine Freunde. Ihr fügt euch und geht in Amerika eures Weges, ohne dumme Dinge über die Marbelle zu sagen, oder ihr werdet sang- und klanglos über Bord gehen.“
Friedrich sagte nichts. Die Selbstverständlichkeit der Drohung hätte ihn eigentlich nicht schockieren dürfen. Im Grunde war er sogar eher überrascht, dass er und seine Brüder überhaupt noch lebten.
Vor ihnen auf dem Niedergang ertönten erneut Schritte und schon sah Bernd Kahlmann sie grinsend an. Dieser schien überhaupt nicht mitbekommen zu haben, was sich an Deck ereignet hatte. Der Zimmermannsgeselle lachte Lerousse an und die Brüder sahen, wie ihr Freund seine Hose zuknöpfte. Dann lachte er auf und zuckte die Achseln. „Auch nicht anders, als die Tochter eines Herzogs.“
Friedrich erbrach sich über die Reling und seine Brüder stützten ihn.
So ging die lange Reise weiter und die Brüder waren sich an keinem der Tage sicher, ob sie lebend an ihrem Ziel ankommen würden. Die Marbelle befuhr nun den atlantischen Ozean. Manche Tage waren ruhig und die Baumgarts hätten die Fahrt genießen können, wäre ihnen nicht immer wieder bewusst geworden, auf was für einem Schiff sie sich befanden. Es wurde ihnen immer wieder vor Augen geführt. Etliche der afrikanischen Frauen wurden von der Mannschaft der Marbelle vergewaltigt, und nur die Gewissheit, damit Selbstmord zu begehen, hielt die Brüder davon ab, dagegen einzuschreiten. Sie sonderten sich von den anderen ab, so gut es ging, und versuchten, die Augen vor dem Elend und der Not zu verschließen. Gelegentlich wurde ein lebloser Körper über Bord geworfen, doch das geschah selten. Das schwarze Gold war zu kostbar, um sinnlos verschwendet zu werden. Der Hass der Geknechteten im Unterdeck schien selbst durch die Bohlen der Deckbeplankung spürbar und schließlich riskierten es selbst die Berber nicht mehr, sich alleine zu den angeketteten Gestalten zu begeben.
Neben dem inneren Ansturm ihrer Gefühle lernten die Deutschen auch die Stürme des Ozeans kennen. Der Kapitän und die Crew schienen ein Gespür dafür zu haben, aber für die Deutschen war es überwältigend, wie rasch der klare Himmel plötzlich schwarz wurde, und dann Blitze zuckten und peitschende Wellen das kleine Schiff herumzuwirbeln schienen. In solchen Momenten waren sie nicht die einzigen, denen es übel wurde. Auch wenn sie die Männer der Mannschaft aus tiefster Seele verachteten, so mussten sie doch deren Mut anerkennen. Klaglos hingen diese Seeleute in der Takelage, auch wenn das Schiff weit zur Seite kränkte und die Matrosen frei über dem tobenden Meer hingen. Mehr als einmal schlugen die Brecher über das Schiff, spülten alles lose mit sich und wer an Deck war, der musste sich an den sogenannten Sorgleinen sichern, um nicht selbst zum Treibgut zu werden.
Irgendwie überstand die Marbelle alle Unbilden und drängte unentwegt dem Kontinent Amerika und ihrem Ziel entgegen. Das Schiff brauchte für die Überfahrt fast zwei Monate und die Deutschen hatten keine Ahnung, ob das eine schnelle oder langsame Fahrt gewesen war, doch der Kapitän war offensichtlich zufrieden. Er blickte auf die Küstenlinie die vor ihnen auftauchte. „Amerika, meine Freunde. Ihr seid am Ziel. Im gelobten Land.“
Sie hatten erwartet, eine tiefempfundene Freude in sich zu spüren. Friedrich fühlte sich hin und her gerissen zwischen Erwartung auf das Neue, was sich ihnen bieten würde und dem Ekel über das, was er zugelassen hatte. Aber er wusste, dass sie sonst nicht überlebt hätten. Die Marbelle glitt auf die Küste zu, als der Ausguck oben im Mast einen lauten Schrei ausstieß und auf die ferne Küste wies. De Croisseux trat an die Reling und hob sein Fernglas an Auge. Er stieß einen innigen Fluch aus. Dann grinste er die Baumgarts und Kahlmann an.
„Zum Abschluss der Reise wird euch doch noch etwas Spannendes geboten.“ Er lachte leise auf. „Eine englische Dampffregatte. So wie es aussieht, eine der ganz neuen. Das wird ein aufregendes Rennen.“
Die Marbelle beschleunigte und die langsame Annäherung des englischen Kriegsschiffes erinnerte an die Verfolgungsfahrt vor der afrikanischen Küste. Aber diesmal stand die britische Fregatte zwischen dem Sklavenschiff und seinem Ziel.
„Wir sind noch außerhalb der amerikanischen Hoheitsgewässer“, knurrte Lerousse. „Die Engländer sind schneller und wollen uns abdrängen. Und sie sind darauf aus, uns zu entern.“ Er grinste sie an. „Sind vielleicht scharf auf das Prisengeld. Ein aufgebrachtes Schiff wird von der Admiralität verkauft. Da fällt was ab für die Crew, die das Schiff eingebracht hat.“
Lerousse blickte zu dem Engländer. Friedrich trat neben ihn. „Er hat keine Schaufelräder.“
„Nein.“ Lerousse seufzte. „Schraubenfregatte. Hat am Heck einen Propeller im Wasser, der das Schiff antreibt. Kein Wasserwiderstand an den Radschaufeln. Ja, die sind schneller als wir.“
Dem Kapitän war bewusst, dass der Engländer sie erreichen würde, bevor die Marbelle amerikanische Hoheitsgewässer erreichte. De Croisseux rief ein paar Befehle nach unten. Die Baumgarts und Kahlmann wichen zurück, als Mannschaftsmitglieder verdreckte und verängstigte Schwarze an Deck zerrten und zur Reling schoben.
„Was soll das?“, fragte Karl unsicher.
„Ihr werdet es gleich sehen“, sagte Lerousse angespannt.
Die Fregatte kam näher und es wurde deutlich, um wie viel größer sie war. Von der Gaffel des Schiffes flatterte eine übergroße weiße Fahne, mit dem roten Georgskreuz und einem kleinen Unionjack in der oberen Ecke. „Welche Ehre“, spottete Lerousse. „Sie haben sogar die Kriegsflagge für uns gehisst.“
„Nah genug!“, rief der Kapitän. „Sie können alles sehen.“
Matrosen hoben die schwarzen Sklaven auf die Reling. Friedrich stöhnte auf, als ihm klar wurde, was geschehen würde und dass er und die anderen erneut hilflos waren. De Croisseux gab einen Wink und mit einem Aufschrei wurde der erste Sklave ins Wasser hinabgestoßen. Noch immer in eisernen Handfesseln verschwand er rasch unter der Oberfläche. Der Kapitän wartete einen Moment, winkte erneut, dann wieder und wieder. Jedes mal starb ein hilfloser Mensch und es ließ die Besatzung der Marbelle scheinbar völlig ungerührt.
Plötzlich drehte die englische Fregatte ab. De Croisseux nahm seine Schirmmütze ab und winkte spöttisch hinüber. „Verdammt, diese englischen Bastarde haben sich Zeit gelassen. Das hat uns eine Menge Geld gekostet.“ Er sah die Baumgarts an. „Sie drehen jedes Mal ab, wenn ihnen klar wird, dass wir sonst alle Schwarzen über Bord werfen. Sind zu weich, die Briten. Natürlich werden sie sich bei den Yankees über uns beschweren, aber Sklaverei ist hier noch nicht verboten. Und außerdem, “ er blickte zum Bug und lächelte erneut, „sind wir jetzt in amerikanischen Gewässern. Willkommen in Amerika.“
Hinter ihnen verlangsamte das englische Kriegsschiff seine Fahrt und drehte ab, während vor ihnen die Küste Amerikas immer größer wurde. Der Verkehr wurde dichter. Immer mehr Schiffe liefen auf einen bestimmten Punkt an der Küste zu oder entfernten sich von ihm.
„Da vorne liegt Charleston“, erklärte Lerousse. „Manche sagen, die Stadt sei das Herz Amerikas und nicht dieses kalte Washington, oben im Norden.“
Sie fuhren in eine Bucht ein und erkannten an ihren Rändern Befestigungsanlagen. Meist waren es nur die typischen Schanzen von Küstenbatterien, aber vor ihnen, im Hafen selbst, erhob sich eine wuchtige Kontur über der das Sternenbanner flatterte.
„Fort Sumter“, sagte der Kapitän.
Sie musterten die Festung, während die Marbelle an ihr vorüber glitt. Das Fort war ein unschöner eckiger Kasten mit dicken Mauern. Als kleine Insel ragte es mitten im Wasser auf, ohne jegliche feste Verbindung zum Land. Die Wände schienen gespickt mit Schießscharten. Die Marbelle grüßte die amerikanische Hoheit durch das Dippen ihrer Flagge. De Croisseux wies auf die vorbei gleitende Festung. „Die Yankees lieben es, sich mit anderen zu schlagen. Erst haben sie mit den Engländern gegen die Franzosen um den Kontinent gekämpft, dann mit den Franzosen gegen die Engländer um ihre Unabhängigkeit. Nachdem sie die hatten, kämpfen sie gegen alles Mögliche. 1814 haben sie den französischen Kaiser unterstützt und das englische Kanada angegriffen, und vor ein paar Jahren schlugen sie sich mit den Mexikanern. Zwischendurch vergnügen sie sich mit den Indianern.“ Der Kapitän lachte leise auf. „Wenn sie nichts mehr haben, wogegen sie Krieg führen können, dann werden sie sich untereinander bekämpfen.“ De Croisseux sah die Deutschen ernst an. „Das gilt auch für die Leute, die hier leben. Haltet eure Zungen im Zaum, ich rate es euch. Hier duelliert man sich noch aus den merkwürdigsten Anlässen. Und glaubt nicht, man wird sich hier über ein paar tote Schwarze aufregen. Man regt sich ja nicht mal über ein paar tote Weiße auf.“
Die Vier verstanden den versteckten Wink durchaus. Das Schiff schob sich tiefer in den weitläufigen Hafen. Ein kleiner Kutter näherte sich. Er führte die Lotsenflagge. Rufe wurden zwischen einem Uniformierten und dem Kapitän ausgetauscht, dann steuerte de Croisseux sein Schiff auf eine der Anlegestellen zu und ankerte. Rings um die Marbelle herrschte geschäftiges Treiben. Die Anlegestellen waren voller Menschen und Waren. Mehrere Arbeiter halfen beim Vertäuen des Schiffes und fixierten die Planke, welche die begehbare Verbindung zwischen der Marbelle und dem Kai bildete. Die Arbeiter waren schwarz und das verwirrte die Deutschen.
Pierre Lerousse lachte. „Das ist die Arbeitskraft des Südens, meine Freunde. Seht ihr die Lagerhäuser dort? Sie sind voller Baumwolle. Holz und Baumwolle, das sind die großen Exportartikel. Vor allem England ist ein wichtiger Handelspartner. Habt ihr schon mal die riesigen Webereien in England gesehen?“
„Sagen die Engländer denn nichts gegen die Sklaverei hier?“
Lerousse sah Hans an. „Junge, sei nicht so naiv. Hast du schon mal gesehen, wer in den britischen Webereien arbeitet? Die brauchen keine Sklaven, die haben ihre Kinder.“
Aus einem großen Viermaster wurden Tuchballen, Fässer und Kisten an Land gebracht. Ein vornehm gekleideter Mann schob sich durch das Gedränge und die Schwarzen machten ihm eifrig Platz. Der Mann näherte sich der Marbelle und betrat die Planke ohne Zögern. Er rümpfte die Nase, als ihm der typische Geruch des Sklavenschiffes entgegen schlug.
Der Mann blickte de Croisseux an und umarmte ihn lächelnd. „Mein lieber Freund, du solltest dein Schiff dringend lüften. Es riecht erbärmlich.“
Der Kapitän lachte auf. „Es riecht nach Geld, mein Freund.“
„Ich hoffe, es ist gute Ware.“ Der Mann blickte gleichgültig über Deck. „Du kommst genau richtig. Morgen ist Auktion bei Grummond. Sind jetzt schon eine Menge Plantagenbesitzer in der Stadt, die daran teilhaben wollen. Charleston entwickelt sich, mein Freund.“
„Ja, das sehe ich“, erwiderte de Croisseux.
„Gut, dann bring die Ware in mein Lager. Wahrscheinlich werden wir sie wieder erst säubern und ausstaffieren müssen, damit sie einen guten Preis erzielen. Wie viele hast du?“
„Ich denke, es werden noch um die 250 sein. Es gab Verluste, du verstehst?“
„Es gibt immer Verluste, mein Freund. Wer ist das?“ Der Mann wies auf die vier Deutschen. „Sie wirken ein wenig echauffiert.“
„Einwanderer“, sagte de Croisseux lakonisch. „Sie sind ein wenig unerfreut wegen der Sklaven.“
Der Mann lachte auf. „Yankeementalität. Sie sollten nach Norden gehen. Preußen?“
Karl schüttelte automatisch den Kopf. „Wir sind Deutsche.“
„Oh.“ Der Mann lachte amüsiert. „Und wir hier sind alle Amerikaner.“ Er lachte erneut. „Die einen mehr, die anderen weniger.“
Die vier Deutschen fühlten sich unwohl. Es drängte sie, vom Schiff zu kommen, auf dem sie so viel Elend und Tod erlebt hatten. Sie gingen nach unten, packten ihre Bündel und Lerousse und de Croisseux sahen zu, wie sie die Marbelle grußlos verließen. Der Kapitän blickte sie an und lächelte verständnisvoll.
Die drei Brüder Baumgart und ihr Freund Bernd Kahlmann eilten vom Schiff fort, hatten genug vom Wasser und dem Anblick von Ketten. Ein wenig abseits des Gedränges hielten sie an, blickten zum Hafen hinüber und sie waren sich nicht sicher, ob sie den richtigen Entschluss gefasst hatten, nach Amerika zu kommen. Immerhin, sie waren da. Doch sie hatten nicht die geringste Vorstellung, wie es weitergehen sollte.
Ziellos schlenderte sie durch die Straßen und sogen die Eindrücke in sich auf. Was ihnen zuerst auffiel, das war die Tatsache, dass die meisten Gebäude aus Holz errichtet wurden. Keine billigen Hütten, sondern prachtvoll gearbeitete mehrgeschossige Gebäude. Weiß war die vorherrschende Farbe. In der Innenstadt gab es sogar gepflasterte Straßen. Vor den meisten Häusern führten zumindest geplankte Bürgersteige entlang, überdacht und von sorgfältig und kunstvoll bearbeiteten Säulen gestützt. Auch die Steinbauten waren eindrucksvoll, oft mit massiven Säulen, welche die Vordächer der Eingangsbereiche stützten.
Viele Häuser hatten Vorgärten und es gab eine Anzahl von Parks, die wohl der Erholung und Erbauung dienten. Dort wurde musiziert, Theater gespielt oder diskutiert. Zahlreiche Kutschen und Fuhrwerke mit Waren vermittelten einen gelegentlich chaotischen Eindruck. Dazwischen Menschen, die geschäftig umhereilten oder gemütlich zu spazieren schienen. Vor allem die weiblichen Bewohner nahmen sofort die Aufmerksamkeit der Deutschen in Anspruch. Diese Frauen gingen nicht einfach, nein, sie schwebten förmlich über den Boden. Vor allem, wenn sie die weiten Röcke trugen, die von Reifen gestützt wurden. Keine dieser Damen war alleine unterwegs. Dabei war die Begleitung nicht unbedingt männlich. Oft waren es andere Damen oder Diener, die ihren Herrschaften folgten. Immer wieder sahen sie sauber gekleidete Schwarze, die bereitwillig Waren hinter den Frauen her trugen und alle möglichen Dienste verrichteten. Keiner von ihnen machte auf die Deutschen den Eindruck, als sei er besonders unzufrieden, was die Deutschen nach dem Erlebten überraschte.
Am meisten jedoch verwirrten sie die Vorführungen in einem der Parks, wo eine Gruppe gastierte. Bunte Plakate wiesen auf Daniel Decatur Emmets berühmte Virginian Minstrels hin. Sie hatten keine Ahnung, was das sein sollte, aber da viele Menschen hinüber strömten, schlossen sie sich an. Sie hörten beschwingte und fröhlich wirkende Musik und erkannten eine geschmückte Bühne, auf der Musiker zu sehen waren, dazu eine Gruppe von tanzenden und singenden Negern. Doch als sie näher kamen, stellten sie verblüfft fest, dass es sich überhaupt nicht um Schwarze handelte, sondern um weiße Männer, die sich mit Schminke und Perücke als schwarze Menschen ausstaffiert hatten.
Die fröhliche Musik ging einem in die Füße und nicht wenige der Parkbesucher tanzten im Hintergrund, auch wenn sich die Vornehmeren zurückhielten. Zwischendurch ertönten auffordernde Rufe. „Dixie! Dixie!“
Bernd Kahlmann vermutete sofort, es handle sich bei Dixie um eine besonders attraktive Sängerin, die gleich auftreten müsse. Aber er wurde enttäuscht. Der Leiter der Minstrelgruppe trat vor und kündigte ein unterhaltsames Stück an. Es nannte sich „United States Mail and Dixie in difficulties“. Der Inhalt war denkbar einfach. Es ging um einen ausgesprochen dummen Postboten. Natürlich einen Neger.
„Wirklich“, hörten sie eine junge Dame sagen, „ich hätte nicht gedacht, dass man im Norden Sinn für solchen Humor hat.“
„Es ist ein ganz neues Stück, meine Verehrte“, sagte ihr Begleiter. „Ich glaube, von den Sabine Minstrels in Portsmouth. Ich habe gehört, die Yankees nennen die Schwarzen alle Dixies.“
„Ja, das passt“, sagte die Dame. „Dieser Bote Dixie ist wirklich unmöglich. Gott, mein Vater würde ihn sofort von der Plantage jagen lassen.“
Ihr Begleiter lachte leise auf. „Die Yankees sagen zum Süden inzwischen schon Dixies Land.“
„Empörend“, echauffierte sich die junge Dame. Sie wedelte aufgeregt mit einem zarten Fächer und drehte in der anderen Hand unbewusst ihren Sonnenschirm. „Wollen die damit sagen, wie seien ein Negerland?“
„In gewisser Weise“, sagte der Mann.
„Empörend“, bekräftigte die Dame. „Aber das passt zu diesen kulturlosen Barbaren aus dem Norden.“
Der Mann lachte und griff in seine Brieftasche. Friedrich erkannte eine Banknote. Der Mann zeigte sie seiner Begleiterin. „Ich persönlich mag eher diesen Dixie.“
Es war eine Zehn-Dollarnote die in New Orleans hergestellt wurde. New Orleans konnte seine französische Herkunft nicht verleugnen und im Französischen hieß die Zehn „Dix“. Die Dame sah ihren Begleiter ein wenig spöttisch an. „Sie haben eine Yankeementalität, mein Lieber.“
Ihr Begleiter verbeugte sich und schob die Geldnote in die Brieftasche zurück. „Dann muss ich mich aus tiefstem Herzen bei Ihnen entschuldigen, meine Verehrteste.“
Das Theaterstück war zu Ende und die Minstrelgruppe spielte „Jordan is a hard road to trabbel“, ein Lied, das offensichtlich religiöse Motive der Schwarzen aufgriff.
Als die Brüder Baumgart und Bernd Kahlmann später in einer Ecke des Parks Platz nahmen, waren sie noch verwirrter als zuvor.
„Ein merkwürdiges Land“, seufzte Karl. „Sie halten sich die Neger als Sklaven und zugleich verkleiden sie sich als Schwarze und spielen deren Musik.“
Friedrich zuckte die Schultern. „Wir sollten uns jetzt eher darum kümmern, was wir in Zukunft machen. Wir brauchen etwas zu Essen, eine Unterkunft und Arbeit. In dieser Reihenfolge.“
Ohne Geld würden sie all dies nicht bekommen, das wurde ihnen rasch klar. Sie hatten noch einen Goldtaler, doch der würde sie nicht weit bringen. Während sie ihre Zukunft diskutierten, schlenderten sie durch die Straßen, bis sie plötzlich verharrten, weil sie eine Stimme hörten, die ihnen bekannt vorkam.
„Den kenne ich doch“, sinnierte Friedrich Baumgart. „Verdammt, ich habe die Stimme schon mal gehört.“
„Du sollst nicht so lästerlich fluchen“, wies Karl ihn zu Recht. „Aber es stimmt. Ja, klar, dass ist dieser Mann, der an Bord der Marbelle kam.“
Sie blickten auf und erkannten nun, dass sie vor einem hohen Gebäude standen, neben dem sich ein kleiner Platz befand. Es war nicht zu sehen, was dort vor sich ging, denn eine dichte Menge drängte sich dort und laute Rufe ertönten. An dem Haus befand sich ein sorgfältig gemaltes Schild.
„Grummonds Auctionary“, las Friedrich vor. „Davon hat der Mann doch gesprochen, nicht wahr?“
Sie konnten sich weit genug vordrängen, um zu sehen, was auf dem Platz stattfand. Es war eine Sklavenauktion. Bewacht von etlichen Bewaffneten standen im Hintergrund die Schwarzen aus der Marbelle. Auf einer kleinen Bühne stand ein gut gekleideter Mann und führte die entführten Afrikaner einzeln vor. Einige der Neger wurden sofort gekauft, andere erst ausgiebig begutachtet. Muskeln und Gebiss wurden geprüft und eine weiße Lady fragte bei einem hageren Farbigen nach, ob er wenigstens als Zuchthengst tauge.
„Unmöglich“, knurrte ein Mann neben den Deutschen. Er blickte auf und musterte sie. „Was ist? Noch nie bei einer Auktion gewesen?“ Er betrachtete ihre Kleidung. „Nein, wohl nicht.“ Der Mann machte sich Notizen, hob seine Hand und rief einen Betrag, mit dem er einen der Farbigen ersteigerte. Erneut sah er die Brüder und Kahlmann an. „Die Schwarzen sind mies behandelt worden, aber das kennen wir bei de Croisseux ja schon. Hat wohl Glück gehabt, dass überhaupt so viele von der Ladung überlebt haben. Die Leute muss man erst mal ordentlich anfüttern, bevor sie Gewinn bringen.“
„Die brauchen die Peitsche, dann werden sie schon ordentlich arbeiten“, wandte ein anderer ein.
Der Mann mit dem Notizbuch lachte auf. „Unsinn. Aber das passt zu Ihnen, George. Immer kräftig prügeln, nicht wahr? Kein Wunder, dass Sie kaum Gewinn erwirtschaften.“ Er sah die Deutschen an. „Nein, man muss sie gut behandeln. Gutes Essen und die Peitsche nur, wo es unbedingt sein muss. Die Schwarzen sind eine gute Kapitalanlage. Eine, die sich selbst vermehrt, wenn man sie vernünftig pflegt. Sucht ihr Arbeit?“
Friedrich schüttelte automatisch den Kopf. Wer Sklaven hielt, konnte ihm wohl kaum eine rechte Arbeit bieten. Doch er sah irritiert, dass Hans bereitwillig nickte und auch Bernd Kahlmann kratzte sich zustimmend am Kopf.
„Ich habe eine große Plantage in Virginia“, sagte der Mann mit dem Notizbuch. „Baumwolle und Melasse. Bringt guten Gewinn. Mit dem Schwung an Sklaven, den ich neu erstanden habe, werde ich auch noch ein paar Aufseher brauchen. Wie wäre es? Ich zahle fair und die Arbeit ist nicht besonders schwer.“
Hans und Bernd sahen Friedrich an. „Na, was sagst du? Klingt doch nicht übel.“
Friedrich schüttelte den Kopf und auch Karl schien nicht begeistert. „Nehmen Sie es mir nicht übel“, sagte Friedrich zögernd, „aber Menschen zu unterdrücken, das ist nichts für mich.“
Der Mann sah ihn überrascht an. „Unterdrücken? Gott, wie sollen die armen Kreaturen denn sonst durchkommen? Sie werden nicht unterdrückt. Sie bekommen Arbeit, Unterkunft und Verpflegung und sogar Lohn.“
„Lohn?“ Sie sahen den Mann erstaunt an. „Also, Geld für Arbeit?“
„Ja, natürlich.“ Der Mann schüttelte über soviel Unverständnis den Kopf. „Schließlich müssen sie ja auch für einiges aufkommen. Aber wenn ihr nicht wollt...“
„He, Moment“, sagte Bernd Kahlmann hastig. Er führte die Brüder zur Seite. „Hört mal, wir brauchen Arbeit und wir brauchen Geld. Es hört sich doch nicht so übel an, finde ich.“
„Nein, das ist nicht für mich.“ Friedrich musterte Bernd und dachte angewidert daran, wie Bernd die schwarze Frau für seine Befriedigung benutzt hatte. Gott, was war das nur für ein Mensch, der solches tun konnte? „Nein. Zudem muss ich nach New York.“
Karl nickte verständnisvoll. „Verstehe. Deine Friederike, nicht wahr? Glaubst du denn, sie ist dort und wartet auf dich? Gott, Friedrich, ihr habt euch jetzt fast eineinhalb Jahre nicht gesehen. Du weißt doch selbst, wie viel in solcher Zeit geschehen kann.“
„Nein, wir lieben uns.“ Für Friedrich war es eine schlichte und unverrückbare Wahrheit und sein Weg war vorbestimmt. Aber er hätte nicht gedacht, dass eintreten könnte, was nun geschah. Die Trennung der Gefährten zeichnete sich ab. Hans und Bernd schienen entschlossen, dem Plantagenbesitzer zu folgen, während Friedrich dieser Gedanke widerwärtig schien. Auch Karl schien andere Vorstellungen vom Leben in den Vereinigten Staaten von Amerika zu haben.
Der Plantagenbesitzer schien ein gutmütiger Mann zu sein. Er wies einen der Mitarbeiter des Auktionators an, die ersteigerten Sklaven bereitzuhalten und lud die vier Deutschen ein. „Ihr seht hungrig aus und ich bin durstig. Ich denke, mit vollem Magen lässt es sich besser beratschlagen. Ich muss mich übrigens entschuldigen. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin John Obediah Jones aus Old Church, Virginia.“
So stellten sie sich vor und gingen dann in ein kleines Hotel in einer der Nebenstraßen. Während sie hungrig aßen und tranken, erzählte der Plantagenbesitzer von sich und seinem Land. Interessiert hörte er den Erzählungen der Deutschen zu und lachte auf, als sie ihrer Empörung über die Vorgänge auf der Marbelle Luft machten.
„Ihr solltet euch darüber nicht zu sehr aufregen. Sicher, es ist eine Verschwendung von Kapitalanlagen und de Croisseux wird nie ein wirklicher Geschäftsmann werden. Es gibt sogar ein paar Verrückte im Norden, welche die Nigger für gleichberechtigte Menschenwesen halten. Nun, Spinner gibt es wohl überall. Aber ich sage euch, hier haben die Schwarzen ein weit besseres Leben, als sie es in Afrika je haben würden.“ Er sah Friedrich an. „Du und Karl, ihr wisst noch nicht so Recht, was ihr tun sollt, nicht wahr? Warum geht ihr nicht beide nach New York im Norden? Friedrich wird dort sein Mädchen finden und da gibt es bestimmt noch genug andere für alle Baumgarts. Ich verstehe die Yankees da oben zwar nicht so ganz, aber ich weiß, dass in New York eine ganze Menge Deutscher leben. Ich glaube, da würdet ihr rasch Anschluss finden. Macht euch über den Weg dorthin keine Sorgen. Bis Old Church könnt ihr mit uns reisen und danach gebe ich euch Geld, damit ihr nach New York kommt.“
„Danke, aber ich möchte kein Geld geschenkt bekommen.“
Jones lachte gutmütig. „Prinzipiell nicht oder im speziellen von mir nicht? Nein, ich bin nicht beleidigt. Ihr versteht noch zu wenig von Amerika, aber ihr werdet es lernen. Nun, wenn Hans und Bernd bei mir arbeiten, können wir es vielleicht als Vorschuss auf ihre Arbeit betrachten. Wie wäre das?“
Es war das Jahr 1851, als sich die Wege der drei Brüder Baumgart und ihres Freundes Bernd Kahlmann trennten.
Hans Baumgart und Bernd Kahlmann blieben in Old Church.
Friedrich Baumgart reiste als einziger weiter nach New York, denn seinen Bruder Karl zog es nach Westen. Sie trafen auf ihrem Weg nach Norden einen kleinen Wagenzug, der auf dem Weg nach Kentucky war. Friedrich glaubte, dass es weniger die Beschreibung des Reiseziels, als vielmehr die hübsche Tochter einer der Familien im Treck war, die Karl dazu beeinflusste, mit dem Wagenzug weiterzuziehen.
Friedrich selbst musste einfach nach New York, denn dort würde Friederike schon auf ihn warten oder ihn zumindest später treffen, denn er wusste nicht, ob die Familie Ganzweiler schon eingetroffen war. Aber Friedrich kannte Josef Ganzweiler und wusste, der Mann würde seine Ankündigung, in die Vereinigten Staaten von Amerika auszuwandern, auch wahr machen. Es hieß ja auch, eine ganze Reihe anderer deutscher Demokraten seien nach New York ausgewandert. Nein, auf ihn wartete Friederike, und als er seine Brüder und Bernd Kahlmann hinter sich zurückließ, da wurde ihm bewusst, wie sehr er sich nach ihr sehnte.