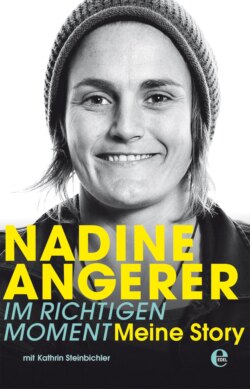Читать книгу Nadine Angerer - Im richtigen Moment - Nadine Angerer - Страница 13
Die Großstadt ruft
ОглавлениеMeine Zweier-WG lag in der Balanstraße, die sich in München vom innerstädtischen Haidhausen bis ins ruhigere Perlach zieht. Wir waren also mittendrin im Geschehen, und ich fühlte mich, als hätte ich eine neue Welt betreten. So muss es sich anfühlen, wenn man erwachsen ist, dachte ich mir. Ich hatte ja keine Ahnung, dass dazu noch einiges mehr gehört, als ohne die Eltern zu leben und in eine fremde Stadt zu ziehen.
Kaum in München angekommen, legten Staubi und ich die Eignungsprüfung ab, die man neben der mittleren Reife für das Studium zum »Sportlehrer im freien Beruf« braucht. Sie zog das Studium letztlich auch durch, aber ich blieb nicht lange bei der Sache. Um ehrlich zu sein: Die Uni hat mich nach dem ersten Semester Probezeit exmatrikuliert, weil ich so gut wie nie anwesend war. Es war eine wilde Zeit damals, in der ich das neue Großstadtleben in vollen Zügen genoss. Die erste eigene Wohnung, das erste eigene Geld, das erste Mal ohne direkte Aufsicht der Eltern – ich habe die ersten drei Jahre in München neben der Schule und dem Fußball nur Party gemacht. Und zwar nicht nur am Wochenende. Da aber tauchte ich bald bevorzugt ab ins Fortuna und ins Soul City, zwei jeweils im Keller gelegene Szeneclubs am Maximiliansplatz im Herzen von München, die ich über meine damalige Freundin kennenlernte. Beide Clubs gibt es heute nicht mehr, aber in meiner Münchner Zeit waren sie die Orte, an denen ich das Leben der Großstadt am unmittelbarsten spürte.
Während sich im Fortuna vor allem Frauen tummelten, traf sich im Soul City das gesamte verrückte München: Schwule, Lesben, Transen und feierwütige Heteros machten dort die Nacht zum Tag, es gab keine Regeln und keine Erwartungen, jeder wollte einfach nur eine gute Zeit haben. Oft gingen wir mit einem Teil der Wacker-Mannschaft dorthin, völlig egal welche sexuelle Orientierung eine hatte. Im Frauenfußball ist Homosexualität kein großes Thema oder besser gesagt: Es gab und gibt lesbische Fußballerinnen, homosexuelle Beziehungen werden hier als genauso normal gesehen wie heterosexuelle. Manch eine brachte zu unseren Ausgehabenden also ihre Freundin mit, manche ihren Freund, niemand störte sich an irgendetwas. Im Soul City und auch bei Wacker war es egal, wer und wie man war, und genauso wollte ich es. Das Gefühl, keinen vorgegebenen Rahmen ausfüllen zu müssen und unbesehen von Herkunft und Geschlecht miteinander eine gute Zeit zu haben, ist für mich bis heute der Idealzustand.
Ob ich selbst nun homo-, hetero- oder bisexuell war, definierte ich für mich damals gar nicht. Ich hatte überhaupt nicht das Gefühl und das Bedürfnis, mich auf etwas festlegen zu müssen. Ich wusste nur, dass ich inzwischen meine erste Freundin hatte und in sie verliebt war. Was das bedeutete, interessierte mich nicht, es interessiert mich noch heute nicht. Ich finde es albern, dass die Leute immer sofort versuchen, jemanden zu kategorisieren und in eine Schublade zu stecken. Ich wollte noch nie in einer Schublade sein, ich muss es auch nicht, denke ich. Niemand sollte das müssen.
Um mir zu dem Taschengeld des Vereins etwas dazuzuverdienen und meinen Eltern nicht zu sehr auf der Tasche zu liegen, jobbte ich in einem Lebensmittelladen, und zwar im Laden der Eltern einer Klubkollegin, in dem auch meine Mitspielerin Christine Paul immer wieder mal aushalf. Christine Paul ist eine ehemalige Nationalspielerin, die in den 80ern und frühen 90ern mit dem FC Bayern mehrmals bis ins damalige Endspiel um die Meisterschaft und bis ins Pokalfinale vorgedrungen war, bevor sie zum FC Wacker wechselte. Paulchen, wie wir sie alle nur riefen, war die unumstrittene Anführerin, als Fußballerin wie als Persönlichkeit. Sie war eine kraftvolle, robuste Spielerin, die allein schon durch ihr Auftreten Respekt einflößte. Sobald es nicht mehr um Fußball ging, war sie ein total lieber, zurückhaltender Mensch. Auf sie konnte man sich in jeder Hinsicht verlassen, im Spiel wie neben dem Platz. Paulchen vermittelte mir also den Job in dem Laden, dort habe ich stundenweise die Regale eingeräumt, Joghurts sortiert und Dosen gestapelt. Oft hatte ich die Nacht zuvor gefeiert und bin, ohne zu schlafen, direkt danach am Morgen in den Laden zum Arbeiten. Ich war jung, ich hatte Energie ohne Ende.
Wahrscheinlich war es auch meiner Jugend zu verdanken, dass ich trotz dieses Lebenswandels meinen Alltag auf die Reihe gebracht und auch auf dem Fußballplatz meine Leistung gezeigt habe. Ich zehrte allerdings noch immer vor allem von meinen körperlichen Grundvoraussetzungen und meinem Talent. Tina Theune wusste ja nichts davon, wie ich in München so lebte, zumindest hoffte ich das. Als aber mal in der Nationalmannschaft wieder ein Leistungstest anstand und die Daten ausgewertet waren, konnte sie nur staunend den Kopf schütteln: Ich hatte vom gesamten Kader mit die besten Ausdauerwerte, und das als Torfrau! In meinen Augen gab es also keinen Grund, an meinem ausschweifenden Leben etwas zu ändern, es lief doch alles bestens.
Am Trainingsgelände in Sendling hatten wir unter der Vereinsgaststätte unseren eigenen Trakt, wir konnten also unsere Sachen dalassen und mussten zu unseren wöchentlich vier Trainingseinheiten und zum Spiel nicht immer die Schuhe und unsere Ausrüstung mit uns schleppen. Wenn man bei Wacker die Treppen hinunterstieg zur Mannschaftskabine, in der jede auf einer der Holzbänke über der Heizung ihren Platz hatte, betrat man in meinen Augen den Kosmos der guten Laune. Oft hatten wir dort die Musik aufgedreht, während wir uns umzogen, wir tanzten und scherzten dabei, es war genial. Meist waren wir auch schon eine Stunde vor dem Treffpunkt da, weil es immer so viel zu bequatschen gab und so viel Neues zu erzählen. Wacker war eine der schönsten Stationen in meiner Karriere und für mich in der Zeit so eine Art Ersatzfamilie. Ich war ja mit 17 Jahren das erste Mal weg und von zu Hause gewohnt, immer Menschen und Verwandte um mich zu haben. Wacker war in der Zeit mein Lebensmittelpunkt, von dem aus ich die Welt erkundete. Und die Fahrten zu den Auswärtsspielen waren für mich unsere Familienausflüge.
Es war auch völlig egal, ob eine Geld hatte oder nicht, bei einer von uns wurde immer gekocht oder gegrillt oder nett zusammengesessen, und wenn mal nichts im Kühlschrank war, fuhr man eben zu den Eltern einer der Spielerinnen und half sich dort aus. Wir waren jung und unbeschwert, alle waren unkompliziert und herzlich, man wusste voneinander und über die Sorgen und Pläne Einzelner Bescheid. Und niemand stellte Fragen nach dem Lebenswandel, solange die Leistung auf dem Platz stimmte. Ich fühlte mich aufgehoben und angenommen, so wie ich bin. Und wieder hatte ich nicht das Gefühl, an meinem Leben etwas ändern zu müssen, ich war ja inzwischen schon in der Nationalmannschaft der Frauen angekommen und galt dort als das Torwarttalent, das in Zukunft die Nummer eins sein würde.
In der Zeit meldete sich einmal der Trainer einer amerikanischen Unimannschaft bei mir. Er hatte sich meine Telefonnummer besorgt und wollte mich in die USA an die University of Hartford holen, eine Universität im Bundesstaat Connecticut an der Ostküste. Ich hätte ein Vollstipendium erhalten, und er versuchte wirklich, mich zu überreden. Aber damals wollte ich noch nicht ins Ausland. Ich war gerade dabei, mich in München einzuleben, ich dachte damals noch gar nicht an etwas anderes. Ich war auch noch nicht reif genug, um aus Deutschland wegzugehen, und es hätte wohl auch meine Aussichten im Nationalteam gemindert. Eine Collegespielerin wird nicht so eben mal eingeflogen für einen Lehrgang oder ein Spiel.
Nach den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta hatte mich Tina Theune das erste Mal zur A-Nationalmannschaft eingeladen. Am 27. August 1996 kam ich schließlich im niederländischen Lichtenvoorde beim 3 : 0 gegen die Niederlande zu meinem Debüt und durfte dabei gleich von Beginn an ran. Ich hatte es geschafft. Dachte ich.
Mir ging es in meiner ersten Zeit in München wirklich nur darum, Spaß zu haben, Fußball zu spielen und in diesem übersichtlichen Rahmen mein Leben zu genießen. Wenn Tina Theune uns Nationalspielerinnen bei einem Lehrgang aufforderte, im Verein Extraschichten einzulegen und an unseren Schwächen zu arbeiten, dachte ich mir: Warum, klappt doch auch so gut!? Allerdings habe ich einige Dinge schleifen lassen. Um alles, was mit Organisation zu tun hatte, habe ich mich nicht gekümmert. Ich hatte keinen Sinn dafür, dass es etwas zu organisieren und zu kümmern gibt im Leben, das eben nicht warten kann. Rechnungen zum Beispiel. All die Briefe, die regelmäßig im Briefkasten lagen, habe ich einfach ungeöffnet in die Wohnung gelegt. Oft habe ich den Briefkasten tagelang gar nicht erst aufgemacht. Damals aber war es mit dem Schreiben von E-Mails noch nicht so weit her, und so lagen da natürlich auch die Einladungen zu Nationalmannschaftslehrgängen drin.
Eines Morgens, ich lag nach einer Party noch um 10 Uhr im Bett, klingelte mein Telefon. Am anderen Ende der Leitung war Silvia Neid, damals die Assistenztrainerin von Tina Theune. »Sag mal, Natze, wo bist du denn?« Na ja, antwortete ich, wo soll ich schon sein: zu Hause, in meiner Wohnung, in München. »Na«, flötete Silv, »dann warte mal kurz, ich geb dich an die Tina weiter.« Als Tina Theune am Hörer war, änderte sich der Tonfall drastisch: »Natze, wo um alles in der Welt bist du?« Ich begriff noch immer nicht. »Wir sind hier gerade mit der Nationalmannschaft in Dessau, wir haben ein Länderspiel gegen Neuseeland!« »Ach du Scheiße«, entfuhr es mir. Unter all den ungeöffneten Briefen in der Küche lag offenbar auch einer von der Nationalmannschaft.
»Ich komme nach, ich nehme den nächsten Zug, den ich kriegen kann«, stammelte ich ins Telefon. »Lass mal, Natze, du kannst in München bleiben«, kam es von Tina zurück, »wir haben für dich jemanden nachnominiert.« Ich war also offiziell ausgeladen. Am 26. Mai 1998 wurde dann im Freundschaftsspiel gegen Neuseeland zur zweiten Halbzeit Kerstin Wasems für Silke Rottenberg eingewechselt. Es sollte ihr einziges Länderspiel bleiben.
Ich war zerknirscht, aber so ganz hatte ich die Tragweite der Situation trotzdem nicht begriffen, ich fühlte mich offenbar zu sicher. Am Abend nach dem Telefonat ging ich wie immer zu Wacker ins Training und erzählte meiner Mannschaft von der verpennten Einladung und dem Ärger, den ich deswegen bekommen hatte. Das hielt mich aber nicht davon ab, nach dem Training mit den Mädels wieder feiern zu gehen, und zwar so richtig. Wir tanzten irgendwann sogar auf den Tischen, und als ich am nächsten Morgen verkatert aufwachte, sah ich, was ich in der Nacht nur mehr schemenhaft mitbekommen hatte: Die Mädels hatten quer über meinen Arm mit schwarzem Edding in großen Buchstaben nur ein Wort geschrieben: Ausgeladen. Ich war ein Kindskopf.
Meinen Briefkasten machte ich weiterhin nur selten auf. Wenige Wochen später aber hatte der DFB erneut Post an mich verschickt. Es war eine Aufforderung, zu einem Torwartstützpunkttraining mit Jörg Daniel an die Sportschule Schöneck nach Karlsruhe zu kommen. Wieder versäumte ich es, den Termin wahrzunehmen. Wieder kam der Anruf: »Wo bist du?« Und wieder musste ich sagen: »Oh Gott, das habe ich nicht mitbekommen!« Ich beteuerte, ich hätte keine Post vom DFB bekommen, was mir natürlich niemand abgenommen hat, aber ich war zu feige meinen Fehler einzugestehen.
Heute wäre so ein Verhalten wie das meine nicht mehr denkbar, die Konkurrenz in der Nationalmannschaft und auch schon in den Jugendauswahlen ist heute so groß und so stark, dass man sich keinen Fehler und keine Disziplinlosigkeit erlauben darf. Mein Glück – und damit auch mein Problem – war, dass es damals in letzter Konsequenz nur Silke Rottenberg gab, die sich mit mir um die Nummer eins im Tor stritt, da es einen Generationenwechsel in der Nationalelf gab und andere wie Claudia von Lanken, Katja Kraus und Kerstin Wasems sich zu der Zeit nicht dauerhaft durchsetzen konnten.
Womit ich verdient habe, dass ich noch eine zweite Chance bekam, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich bin dankbar, dass ich sie bekam. Auch wenn ich sehr lange darauf warten musste.