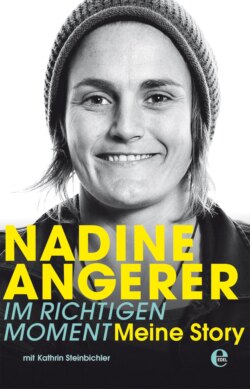Читать книгу Nadine Angerer - Im richtigen Moment - Nadine Angerer - Страница 8
Der Kreis schließt sich
ОглавлениеIn meinem ganzen Leben geht es immer wieder aufs Neue darum, zu sehen, was ich will, manches zu schaffen und auch oft zu scheitern, aus dem Erlebten zu lernen, mir neue Ziele zu setzen und mich darauf zu fokussieren. Sich im richtigen Moment absolut konzentrieren zu können, diese sogenannte Siegermentalität zu haben und zu leben, ist eine bereichernde Erfahrung. Diese Siegermentalität kann man sich aneignen, man kann nach ihr suchen und, wenn man sie in sich entdeckt hat, sie zu leben versuchen. Ich weiß inzwischen, dass ich das in mir habe, das nimmt mir auch keiner mehr weg. Wenn man einmal erlebt hat, dass man etwas hinbekommt, wenn man sich einem Ziel mit Haut und Haaren verschreibt, dann weiß man, dass einem das auch ein weiteres Mal gelingen kann. Man kann auch scheitern dabei, klar, aber dann weiß man wenigstens, dass man es versucht hat. Warum also, dachte ich mir, sollten wir es nicht auch voller Zutrauen gegen die favorisierten Schwedinnen versuchen?
Mit dem Halbfinale gegen Schweden hatte ich das Gefühl, dass sich für mich bei dieser EM ein Kreis schließen würde. Die Begegnung Deutschland – Schweden zählt inzwischen zu den Klassikern des Frauenfußballs, es ist das ewige Duell um die Vorherrschaft in Europa. Bei meiner zweiten EM 2001 in Deutschland, bei der ich noch als Ersatztorhüterin dabei war, hatte ich mich mit Schwedens Nationaltorhüterin Caroline Jönsson angefreundet, die mir zu einer langjährigen Weggefährtin und engen Freundin wurde. Ich habe seitdem ein Jahr in Schweden gelebt und dort Fußball gespielt. Und jetzt, nach all den Jahren, war ich nun also zurückgekommen, in meinem eventuell letzten Turnier als deutsche Nummer eins. Ich wusste ja vor dieser Europameisterschaft nicht, wie sich die Dinge entwickeln sollten. Ich stand nach der Weltmeisterschaft 2011 unter Beobachtung, und da ich nach einem Knorpelschaden im Knie einige Zeit gebraucht hatte wieder fit zu werden, auch in der Kritik. Und da war es nun: das Spiel, in dem alles zusammenkam, was meine Karriere bis dahin ausgemacht hatte.
Natürlich war auch Caroline Jönsson für dieses Halbfinale im Stadion, wie so viele frühere schwedische Nationalspielerinnen, die sich diese Neuauflage des alten Duells nicht entgehen lassen wollten. Sie war mit dem Auto von Malmö nach Göteborg gekommen, um im Gamla-Ullevi-Stadion dabei zu sein, und trug dabei stolz das schwedische Nationaltrikot. Diesmal, im eigenen Land, hoffte sie wie die meisten anderen Schweden, sei die Zeit reif, Geschichte zu schreiben und Schweden für all die vergeblichen Anläufe zuvor endlich mit dem ersehnten Titel zu belohnen. Genau diese Hoffnung, die in den Anfeuerungsrufen der Fans zu hören und zu spüren war, machte den Schwedinnen sichtlich schwere Beine. Und das, obwohl sie mit ihrer neuen, vom Olympiasieger USA zurückgeholten Trainerin Pia Sundhage wirklich eine extrem gute Mannschaft ins Turnier gebracht hatten.
Das Gamla Ullevi war mit 16.600 lärmenden Zuschauern komplett ausverkauft. Singend und trommelnd waren die Fans durch die Innenstadt zur Arena gezogen, die Stimmung war unglaublich. Vor dem Anpfiff dann konnte ich sehen, wie Schwedens Kapitänin und Torjägerin Lotta Schelin noch einmal nach oben sah: dorthin, wohin sie unter dem Dach der Haupttribüne bei einem Stadionrundgang im Jahr vor der EM ein Paar ihrer Fußballschuhe über das Quergestänge geworfen hatte, das jetzt für alle sichtbar dort baumelte. Das Gamla Ullevi, betonte sie während der EM, ist das Heimstadion der schwedischen Frauenfußballnationalelf, ihr Wohnzimmer sozusagen. Und dieses Wohnzimmer machten wir Deutschen uns nun daran zu erobern. Schließlich hatten wir nichts zu verlieren, im Gegenteil: Zum ersten Mal war zu spüren, dass wir ein Spiel dieser EM bei aller Anstrengung auch genossen. Auch wenn Célia unserem Angriffsspiel wegen einer Muskelverletzung fehlte.
Nach etwas mehr als einer halben Stunde des offenen Schlagabtauschs, in dem sich keine der beiden Mannschaften zurückhielt, war es dann die in Malmö spielende Anja Mittag, die für uns Deutsche vorbereitete, was die Schweden mitten ins Herz traf: Anja schickte Dzsenifer Marozsán in den Strafraum, und die spitzelte den Ball zum 1 : 0 ins lange Eck. Wir schrien uns beim Jubel alle ungläubig an vor lauter Freude! Nach der Halbzeit ging es weiter in dem rasenden Tempo, mit dem die Schwedinnen sich bei ihrem Heimturnier als offensivstärkste Mannschaft gezeigt hatten. Immer wütender sprintete Lotta Schelin auf mich zu, sobald sie an den Ball kam, und einige Male konnte ich gerade noch retten. Schließlich traf sie sogar, hatte sich aber vor dem Torabschluss mit derart heftigem Körpereinsatz gegen Annike Luft verschafft, dass es als Foul gepfiffen und der Treffer nicht anerkannt wurde.
Als das Spiel schließlich vorbei war, wir im Finale standen und wieder einmal in der langen Geschichte deutsch-schwedischer Duelle gewonnen hatten, schickte Caroline Jönsson mir in den Minuten danach nur eine kurze SMS: »I hate it, when Germany wins, but I like you.« Die Zeile fasste die Fassungslosigkeit der Schwedinnen an diesem Tag zusammen. Zwischen Schweden und Deutschland besteht im Frauenfußball eine enge Freundschaft, aber es macht den Skandinavierinnen zu schaffen, dass sie sich in großen Spielen bislang nicht durchsetzen konnten gegen uns. So sehr ich mich freute, so sehr konnte ich die Trauer der Schwedinnen nachvollziehen: Es schmerzt, alles zu geben und am Ende mit nichts dazustehen.
Nicht nur zwischen mir und Caroline, auch zwischen den Nationalteams aus Schweden und Deutschland gibt es eine besondere Beziehung, die über die Jahre gewachsen ist. Es gab schon so viele tolle Spiele, oft Entscheidungsspiele oder sogar Endspiele um einen Titel. Die jungen Spielerinnen jetzt kennen es nicht anders, als wie wir es ihnen von früher erzählen, und so gilt noch heute: Trotz des Wettkampfs und der Konkurrenz mit den Schwedinnen gibt es zwischen Deutschland und Schweden eine lang gewachsene, mit viel Anerkennung verbundene Freundschaft.
Wir hatten mit den Schwedinnen immer die legendärsten Partys. Was umso bemerkenswerter ist, als die besten davon dann stattfanden, wenn wir uns soeben in einem Finale gegenübergestanden hatten. Obwohl dabei bislang jedes Mal Schweden unterlag, hatten die Schwedinnen immer die Größe, bei uns mitzufeiern. Schweden hat da inzwischen schon in der dritten Spielerinnengeneration ein regelrechtes Trauma entwickelt: So wie wir in uns über die Jahre die Überzeugung entwickelt haben, dass wir in der Lage sind, jeden noch so starken Gegner bezwingen zu können, hat sich bei den Schwedinnen seit 2001 offenbar festgesetzt: Wenn es in der Begegnung wirklich um etwas geht, gewinnen die Deutschen, komme, was da wolle. So war es 2001 im EM-Finale, so war es 2003 im WM-Endspiel, so war es 2008 im olympischen Viertelfinale und so war es jetzt 2013 im Halbfinale der EM auch wieder.
2013, als Gastgeber im eigenen Land, waren die Schwedinnen als eine der besten Mannschaften der Vorrunde durchs Turnier gezogen. Als es dann aber gegen uns losging und der Pfiff ertönte, war auf dem Platz richtig zu spüren, wie bei uns jede noch eine extra Schippe Motivation draufpackte. Und die Schwedinnen? Waren sichtlich nervös. Das zu registrieren hat mich noch mal zusätzlich beflügelt.
Die unterschiedlichen Mentalitäten, die in einer Gesellschaft vorherrschen, sind auch im Sport zu spüren. Das ist nicht gut oder schlecht, aber es hat einen Einfluss. In Schweden jedenfalls haben es die Spielerinnen schwer, die einen sichtbaren Ehrgeiz haben und innerhalb der Mannschaft Leistung einfordern. Das wird schnell als unangenehm und unangebracht empfunden. In Deutschland oder auch den USA wirst du dazu angehalten, es so zu machen. Damit du und die Mannschaft sich am Ende durchsetzen.
Diese Siegermentalität, dieser unbedingte Wille zum Erfolg, der bei uns in Deutschland schon in jedem Training zu spüren ist, geht meiner Meinung nach den Schwedinnen bislang ein Stück weit ab. Ich habe das ja mitbekommen, als ich für ein Jahr in Stockholm gespielt habe. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass es bei uns in Deutschland im Training untereinander härter zugeht als bei den Schwedinnen in einem Spiel. »Wenn ihr da nichts ändert, wird das nie was«, sagte ich einmal zu meinen Mitspielerinnen bei Djurgården. Das sollte nicht überheblich klingen, ich wollte sie wachrütteln und anstacheln. Aber die Schweden sind einfach ein sehr nettes Volk. Da ist es schon das Höchste der Gefühle, wenn eine im Spiel zu dir sagt: »Kannst du den Ball bitte etwas härter passen?«
Die EM 2013 hat für mich eine noch größere Bedeutung als die WM 2007. Denn diese Europameisterschaft war für mich vom Kopf her das anstrengendste Turnier, das ich je gespielt habe. 2007 war ich zwar ein Neuling und entsprechend aufgeregt. Ich hatte auch Druck, aber ich konnte mich noch hinter den erfahrenen Säulen der Mannschaft verstecken. Da waren eine Birgit Prinz, eine Renate Lingor, eine Kerstin Stegemann und eine Kerstin Garefrekes. 2007 in China musste ich mich in erster Linie nicht um die Mannschaft kümmern, ich konnte mich schön auf meine eigene Leistung konzentrieren. Jetzt, 2013, war ich die Kapitänin. Bei der Weltmeisterschaft zuvor war ich mitschuldig gewesen, dass es kein gutes Turnier von uns war und wir schon im Viertelfinale gegen den späteren Weltmeister Japan ausschieden. Danach hatte ich eine Weile mit Versagensängsten zu kämpfen – bloß nicht wieder so einen Fehler machen wie beim Gegentor, sagte ich mir oft. Ich stand also bei der EM 2013 aus verschiedenen Perspektiven unter Beobachtung.
Als kritisch beäugte Nummer eins musste ich meine Leistung bringen, zugleich als Kapitänin die Mannschaft anführen und darauf achten, dass diese junge, neu zusammengewürfelte Rasselbande miteinander klarkommt und sich trotz aller persönlichen Nöte und Premierenängste als Team begreift. Und dann muss man als Kapitänin auch noch zwischen dieser Rasselbande und dem Trainerteam vermitteln – und mit den eigenen Versagensängsten umgehen. Die EM 2013 in Schweden war deshalb das bisher krasseste Turnier meines Lebens.
Ich war allerdings schon oft zuvor gezwungen, innerhalb eines kurzen Zeitraums viele Entscheidungen zu treffen und abzuwägen, und genau das kam mir nun bei der EM zugute. Ich betrachtete das Turnier einfach als die nächste Aufgabe, die es abzuarbeiten galt. Was danach kommen würde, wusste ich nicht, ich konnte es auch nicht wissen, aber ich wusste, wie ich diese EM bestreiten wollte: mit vollem Einsatz und der ganzen Aufmerksamkeit und Hingabe, zu der ich imstande war.
Als Kapitän musst du schließlich – noch mehr als als Nationalspielerin ohnehin – deine Leistung bringen. Du musst dabei überzeugen, denn man kann nicht von sich sagen, man sei Führungsspielerin, und dann nicht mit vollem Einsatz und echter Klasse vorangehen. Das funktioniert auch den Mitspielerinnen gegenüber nicht: Eine Mannschaft merkt, wenn eine Spielerin etwas nachlässt, und wenn du eine Führungsspielerin bist, wird das erst recht registriert. Um in der Rolle als Kapitänin also akzeptiert zu werden, muss man immer alles geben, man darf sich nicht ausruhen auf dem Erreichten.
Dass ich 2007 schon einmal in einem Endspiel einen Elfmeter gehalten hatte, damals gegen Brasiliens Marta, zählte im EM-Finale 2013 also rein gar nichts. Anja Mittag hatte uns aus gut zehn Metern nach einem zielgenauen Pass von Célia nach 49 Minuten in Führung gebracht, nachdem ich bereits gegen Trine Rønning einen Strafstoß pariert hatte. Als ich nach etwas mehr als einer Stunde dann auch den zweiten Elfmeter gegen Solveig Gulbrandsen abgewehrt hatte, war ich so vollgepumpt mit Adrenalin, dass ich nicht mehr genau wusste, wie das Spiel zu Ende ging. Wie ich die beiden Elfer gehalten habe? Schwer zu sagen. Ich warte einfach immer bis zum letztmöglichen Moment und dann passiert es einfach, ich verhalte mich da ganz intuitiv. Irgendetwas in mir entscheidet sich für die Ecke, in die ich springe. Ich bin immer ganz gut gefahren damit, mich auf mein Bauchgefühl zu verlassen.
Als ich nach dem gewonnenen Endspiel in Solna mit der Bundestrainerin zusammen zur Pressekonferenz musste, konnte ich noch gar nicht klar denken. Gerade eben hatte ich im Stadion den EM-Pokal in die Höhe gestemmt, meinen ersten als Kapitänin, den achten, den die deutsche Nationalelf der Frauen je gewonnen hat. Kaum hatten Silvia Neid und ich die ersten Fragen der Journalisten beantwortet, ging plötzlich die Tür zum Pk-Raum auf. Laut singend hüpfte die Mannschaft herein, bis sie hinter mir und Silv stand, und rief immer wieder: »Super-Natze, Super-Natze, hey, hey!« Silv und ich mussten total lachen, an eine Pressekonferenz war jetzt nicht mehr zu denken.
Ich habe mich in dem Moment total gefreut, Silv auch, man hat uns das auch angesehen, glaube ich. Gleichzeitig dachte ich mir: »Oh Mann, die haben einen Mordsspaß und ich muss hier sitzen und kann nicht mitfeiern! Die sind in ein paar Minuten dermaßen betrunken, das kann ich ja nie aufholen!« Es dauerte, bis ich wieder zur Mannschaft konnte, denn ich musste viele, viele Fragen beantworten und Statements abgeben, die nationalen und auch die internationalen Medienvertreter wollten immer wieder und wieder von mir hören, wie es war, diese beiden Elfmeter zu halten. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da alles gesagt habe, ich stand noch völlig unter Strom und war zugleich total erschöpft. Währenddessen lief mir die ganze Zeit auch noch eine Dopingbeauftragte hinterher, die mir nicht von der Seite wich, denn ich war für die Urinprobe gelost worden und musste also noch unter Aufsicht aufs Klo. Dabei wollte ich doch nichts anderes, als einfach mal ein Bierchen mit der Mannschaft zu trinken!
Im Hintergrund sprangen derweil immer wieder mal Spielerinnen von uns durch die Stadionflure, aus der Kabine dröhnte Musik und lautstarker Gesang. Ich bekam mit, wie die Mannschaft feierte, ich aber konnte nicht dabei sein. Es gibt so viele Fotos und Videoaufnahmen von diesen Momenten nach dem Spielende in den Katakomben der Arena, auf denen alle feiern und Spaß haben. Nur ich bin nicht zu sehen! Weil ich nicht dabei war, sondern vom Spiel erzählen musste!
Am Abend des Finales haben wir natürlich ausgiebig im Mannschaftshotel gefeiert, sogar Wolfgang Niersbach, der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), war dabei und rockte mit uns ab. Als wir am Tag danach schließlich reichlich verkatert und ohne Schlaf auf dem Balkon des Frankfurter Römers standen, überwältigte mich ein unglaubliches Gefühl: Tausende Fans waren zu unserem Empfang gekommen und jubelten uns zu. Und auch wenn überall zu lesen war, dass wir wegen meiner zwei gehaltenen Elfmeter gewonnen haben – dieser EM-Titel war ein tolles Gemeinschaftswerk. Wir haben das zusammen geschafft und ich bin total stolz auf die Mannschaft. Es war wichtig, gemeinsam mit den anderen Erfahrenen wie etwa Saskia Bartusiak und Annike Krahn die Führungsrolle in dieser Zeit des Umbruchs zu übernehmen. Aber wie die Jungen sich bei der Europameisterschaft verhalten haben, wie sie immer ihr Bestmögliches gaben und wie wir alle zu einer verschworenen Einheit wurden – das werde ich nie vergessen. Nie.