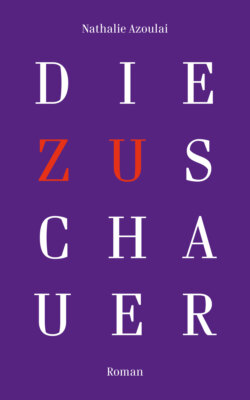Читать книгу Die Zuschauer - Nathalie Azoulai - Страница 22
ОглавлениеIn der Bahn nach Paris bleibt sein Vater stehen; um die Metallstange, die er fest an sich presst, hat er die Fahne gewickelt und darüber ein großes Blatt Packpapier geklebt. Er steht ebenfalls, dicht neben seinem Vater, ohne ihn zu berühren, und stellt sich vor, dass auch er eine in Schach gehaltene, eingerollte Fahne ist. Er schließt die Augen, sieht zwei parallele Geraden gen Himmel streben, einer ganz anderen Geometrie folgend als der zwischen ihm und seiner Mutter, wo die Linien sich kreuzen, vereinen, oft zusammenwachsen. Er weiß nicht, ob dieser Unterschied ihn freut oder bedrückt. Als sie durch die Stadt laufen, wirkt die Packpapierrolle wie eine dritte Gestalt zwischen ihnen, lang und stumm; sie erinnert ihn an die Stoffballen des Marché Saint-Pierre: mal wie in Ecken gedrängte Statisten, über und über mit Lamé und Pailletten geschmückt, mal wie nach einem Strandtag geschlossene Sonnenschirme, oder auch – der Gedanke kommt ihm zum ersten Mal – noch nicht entrollte Fahnen.
Am oberen Ende der Avenue des Champs-Élysées entfernt sein Vater langsam das Papier. Seine Hand zittert, noch nie hat er seine Finger so zittern sehen. Ab und an blickt er um sich, als würde gleich jemand auftauchen und ihm befehlen aufzuhören, alles wieder einzupacken. Er reicht ihm das Papierblatt, das er schon zerknüllen will, aber sein Vater bittet ihn, es zusammenzufalten, für die Rückfahrt könne es noch nützlich sein. In der Bahn ist das ratsamer, fügt er hinzu. Er faltet es ordentlich, einmal, zweimal, dreimal, klemmt es unter den Arm wie ein Buch oder ein großes Heft. Während er seinen Arm eng am Körper hält, streckt sein Vater einen Arm aus und schwenkt die Stange: Der Stoff wellt sich im Wind, ein so weißer Satin im fast kobaltblauen Himmel – so weiß, wie jener, den seine Mutter kaufen gegangen ist, schwarz sein wird.
Sein Vater wirft den Kopf nach hinten, schaut zu, wie das emporgestreckte Rechteck sich immer stärker wellt. Er verliert das Gleichgewicht, stürzt fast. Er hält ihn fest, streift flüchtig den Stoff. So einen hat er noch nie berührt, und er fragt sich, wo die Fahne die ganze Zeit bei ihnen aufbewahrt wurde, warum er sie nicht gesehen hat. Hast du sie gekauft oder anfertigen lassen?, traut er sich zu fragen. Gekauft natürlich. Hätte Maria nicht eine machen können? Nein, eine Fahne ist heilig, sagt er entschieden, weit mehr als nur ein Stofffetzen. Du bekommst sogar eine Geldstrafe, wenn du eine verbrennst. Ist gesetzlich verboten.
Es ist das erste Mal, dass sie sich über Fahnen unterhalten, obwohl die zwei Seiten darüber in seinem Wörterbuch seine Lieblingsseiten sind. Um das jeweilige Land zu erraten, verdeckt er die Namen mit dem Finger. Inzwischen kennt er fast alle auswendig. Wenn seine Mutter ihn bei seinem Spiel überrascht, erklärt sie jedes Mal, sie liebe die amerikanische Flagge über alles. Warum?, fragt er. Weil sie reicher verziert ist als die anderen, die vielen Sterne, die Streifen, wie Muster eines Kleidungsstücks. »Wir nehmen die Sterne vom Himmel, das Rot von unserem Mutterland, während die weißen Streifen zeigen, dass wir uns von ihm getrennt haben; weiße Streifen, die die Freiheit für die Nachwelt darstellen.« Wer hat das gesagt?, fragt sie. George Washington. Außerdem sieht man sie in allen Filmen, ich bin ganz einfach daran gewöhnt. »Während am 14. Mai 1948 die englische Fahne vom Mast herabsinkt, wird die neue in Azur gehisst, bauscht sich auf und flattert im Wind«, liest er weiter, bevor er das Wort »Azur« aufgreift. Heißt eine Farbe so? Seine Mutter zögert, es gibt Königsblau, Saphirblau, Kobaltblau, Marineblau, Türkis, Himmelblau, Denim, aber Azur … ich weiß nicht, ob man beim Schneidern von Azur spricht … ich werde Maria fragen. Das Wörterbuch gibt keine Auskunft darüber, wo seine Eltern an jenem Tag waren, ob sie loszogen oder vom Strand zurückkamen, ob sie zu Hause die neue Fahne ans Fenster hängten, ob man in einem Land leben und gleichzeitig die Fahne eines anderen schwenken kann.
Auf den Champs-Élysées wird sie von allen in die Höhe geschwenkt. Er weist seinen Vater darauf hin, dass manche aus Satin, andere aus Seide seien. Was macht das für einen Unterschied?, wundert dieser sich. Seide ist robuster als Satin, Maria sagt das die ganze Zeit, aber ich mag Satin lieber. Er merkt schon, seinem Vater wäre es lieber, wenn er schwiege, doch er muss sprechen, muss all den Blicken, die sich auf sie heften, etwas entgegensetzen, den Schaulustigen, die mal lächelnd, mal misstrauisch am Straßenrand stehen bleiben, um sie vorbeiziehen zu sehen, diese krausköpfigen, schnurrbärtigen Männer in Anzug und Krawatte oder nur, wie sein Vater, im Oberhemd mit hochgekrempelten Ärmeln und heller Hose – diese voranschreitenden Männer, die sich Gehör verschaffen, weiterrücken und in der Gruppe Konturen aufweisen, die mit denen der Franzosen nicht mehr ganz übereinstimmen. Seit dem Krieg hat man sie nicht mehr so vereint gesehen, vor allem nicht die hier, so dunkelhaarig und mit so typischen Zügen.
Seid ihr Araber?, fragt Pepito einmal.
Nein, antwortet er.
Aber ihr kommt doch aus einem arabischen Land?
Ja.
Über Dreißigtausend greifen die Worte des Generals auf, »unser Freund, unser Verbündeter«, diese Worte, die sie sieben Jahre zuvor kaum vernommen hatten, da er sie auf der Vortreppe des Élysée-Palastes gesprochen hatte. Er kann weder Frauen noch Kinder entdecken, bereut allmählich, mitgekommen zu sein. Warum hat sonst kein Vater sein Kind mitgenommen, obwohl heute schulfrei ist? Unter den Männern, denen sie begegnen, erkennt er vertraute Namen und Vornamen wieder, zwingt sich, ein wenig zu lächeln. Manche sagen zu ihm, sie seien so glücklich, ihn endlich kennenzulernen, sie hätten schon so viel von ihm gehört, von seiner Klugheit, den glänzenden Noten, in Mathe, Französisch, Geschichte und sogar Deutsch. Andere erklären, eine Kundgebung könne stets ausarten, vor allem diese, deshalb seien sie lieber allein gekommen. Sofort hat er das begierige Gesicht seiner Mutter vor Augen, bereit für den Marché Saint-Pierre, überglücklich, ihn ausnahmsweise los zu sein.
Denn auch wenn er sich nicht direkt beschwert hätte, wäre ihm doch zu warm gewesen, er hätte sich hinsetzen, sich ganz klein machen wollen, um zu verschwinden, nicht der einzige Junge zu sein, den die Mutter in einen Stoffladen mitschleppt; er hätte um Wasser gebeten, sich den Hals verrenkt, um die Uhrzeit an den Handgelenken der Verkäuferinnen abzulesen, hätte den daheimgebliebenen Pepito beneidet. Sicher, er hätte auch Marias Hände und die seiner Mutter beim Aufrollen, Befühlen und Betasten der Ballen beobachtet, wie sie die Stoffdrucke, die Durchsichtigkeit vergleichen, ihre flinken Finger wie Tierchen, die von einem Stoff zum andern hüpfen. Er wäre enttäuscht gewesen, dass sie nicht behutsamer vorgehen, zärtlicher über die Baumwolle fahren, über die Seide, den Krepp, die Spitze, den Twill, über alles, was mit Schildern benannt ist wie Richtungsanzeigen im Raum, und jeder Name ein Kampf zwischen Maria und seiner Mutter: Maria hat woanders einen Stoff entdeckt und geht ihn unter den wütenden Blicken der Verkäuferinnen holen, die es nicht leiden können, wenn ihre Waren derart umherwandern. Manchmal schleppt sie einen ganzen Ballen herbei, um ihn neben dem anderen abzulegen, den seine Mutter gerade gefunden hat und nicht mehr loslassen will. Er kommt näher, beobachtet die umtriebigen Hände, die sich übereinanderstapeln, jede mit dem eigenen Fundstück, und einen Totempfahl aus Fleisch gespickt mit kunterbunten Stofffetzen bilden, sodass er nicht mehr weiß, wem welche Hand gehört. Doch erfahrungsgemäß – wie oft hat er sie schon dorthin begleitet, sechs-, acht- oder zwölfmal? –, liegt das letzte Wort eher bei Maria, denn seine Mutter liebt es, für die Verkäuferinnen deutlich hörbar zu verkünden, dass die Fachfrau schließlich Maria sei, sie selbst, fügt sie hinzu, sei nur ihre Kundin. Doch die Verkäuferinnen schauen enttäuscht drein, wenn sie begreifen, dass die, die sie für eine Kostümbildnerin gehalten hatten, die Stars einkleidet, ihre Regale nur für diese Frau durcheinandergebracht hat, die diesen kleinen unglücklichen Jungen mit sich schleppt.
Zumal diese Frau schwanger ist, als sie sich an einem Apriltag des Vorjahres in den Kopf setzt, denselben Blauton ausfindig zu machen, wie ihn das Negligé von Gene Tierney aufweist, in einem Film, den sie 1946 gesehen hat, betont sie beim Betreten des Ladens. Leave Her to Heaven. Sie steht oben an einem Treppenaufgang, der das gleiche Blau aufweist, erklärt sie, hell und kräftig zugleich, leicht perlmuttschimmernd, und will sich hinunterstürzen, um das Kind zu töten, das sie in sich trägt. Maria macht große Augen, während sie weiter auf die Titelseite der Photoplay starrt, mit der sie die Regalreihen abschreitet, als hielte sie einen Exerzier- oder Blindenstock in der Hand. Ohne die Stimme zu senken, ohne ihren eigenen runden Bauch zu verbergen, beschreibt seine Mutter Gene Tierneys Füße in den hochhackigen Pantoletten, ihre rot lackierten Nägel unter dem perlmuttblauen Satin der Kreuzriemchen, und darüber den wallenden Stoff, ein Ton in Ton bedruckter Musselin, ein herrlich schillerndes Blau, so blau wie die Tapete dahinter. Aber warum?, fragt Maria. Warum was? Warum das Kind töten, sagt Maria widerwillig. Weil sie verrückt ist, erwidert seine Mutter, Gene Tierney spielt nur geistig gestörte Frauen. Ach, dieses Blau, Maria, dieses schöne Blau … wiederholt sie. Wie es wohl heißt? Maria zögert, versucht, das Wort zu verdrängen, das ihr in den Sinn kommt, presst die Lippen zusammen, schafft es nicht und sagt dann, Bonbonblau. Ja, natürlich!, erwidert sie ausgelassen, Bonbonblau, ich wollte schon Babyblau sagen, aber Sie haben recht, Maria, für mein Kleid will ich Bonbonblau. Diese Kostümbildner aus Hollywood denken wirklich an alles, ein Bonbonblau, um sein Kind zu töten, alle Achtung!
Auf einem der Tische entsteht ein kleiner Stoffhügel, dann ein Stapel, ein Berg, eine Fülle an Blau, wie er es noch nicht gesehen hat, tiefe Blautöne, die allmählich verblassen, sich aufhellen, zu Flusswasser werden; aber auch zartes Blau, das dunkler wird wie ein Himmel bei Einbruch der Nacht. Fast schon weiße Blautöne, verwaschen vom Neonlicht. Namenloses Blau. Sie kommen und gehen und geben stets neue Schichten hinzu, Durchsichtigkeiten, Spuren auf der rastlosen Suche nach Bonbonblau, das sich nicht einfangen lässt.
Plötzlich wird eine Jagd daraus, die die beiden Frauen vergeblich führen. Er vergisst den Durst und die Müdigkeit, sieht einen Haufen toter Vögel vor sich, aufgeschichtetes Holz, eine Farbpalette, fragt sich, was passieren würde, wenn er ein Streichholz hineinwürfe, welche Farbe der Haufen beim Brennen annähme, ob die Flammen blauer wären als die eines anderen Feuers. Verschämt wendet er den Kopf ab, sieht zu den Verkäuferinnen, erkennt in ihrem Ärger leichte Belustigung, als Maria sich plötzlich entfernt und verschwindet.
Allein vor dem Stapel wirkt seine Mutter unschlüssig. Er geht hin, schaut mit ihr zusammen, so, wie man sich über einen Teich beugt, und fragt sich, ob sie die vielen Blautöne nicht schließlich sogar leid geworden ist. Eine Verkäuferin fragt sie, wann das freudige Ereignis anstehe. Im September, antwortet sie, für den Sommer brauche ich kräftig leuchtende Kleider. Schauen Sie, wie wunderbar, sie zeigt ihr die Titelseite ihrer Zeitschrift: Gene Tierney präsentiert sich im Baumwollkleid, oben an den Schultern sind die Ärmel abgeschrägt. Man muss nur auf den Gürtel verzichten, erklärt sie mit Bedauern, weil für sie nichts über Gürtelkleider geht, vor allem dieses hier, schauen Sie sich dieses Detail an der Taille an, dieses herrliche Schmuckstück! Jetzt muss nur noch das richtige Blau gefunden werden … Bei diesen Worten – zum ersten Mal seit ihrer Ankunft in der Kaufhausetage – streckt er den Arm aus und lässt seine Finger zu einem der aufgehäuften Stoffe wandern, Alpen-Vergissmeinnicht, kommentiert die Verkäuferin, eine Gebirgsblume. Der Blauton verändert sich, wenn man näherkommt. Was für ein Auge du hast!, auch wenn das Blau etwas dunkel ist, sagt seine Mutter. Er lächelt, froh, dass er in diesem Jagdwildhaufen eine Blume gepflückt, die Zartheit eines Blütenblatts auf dieses Schlachtfeld gebracht hat. Gar nicht mal so dunkel, Madame, stellt die Verkäuferin richtig, schauen Sie, ein changierendes Blau, aber da taucht Maria wieder auf. Die Verkäuferin lässt den Stoff sofort los. Wie auf der obersten Stufe einer Treppe steht Maria groß und fürstlich da; wie um das Geländer, das sie gleich loslassen wird, hat sie alle fünf Finger ihrer Rechten um ein neues Muster gekrampft, dann öffnet sie die Hand und lässt ein Stoffstück auf den Stapel fallen: Seladon, verkündet sie streng und gebieterisch, dieses Kleid bekommen Sie von mir nur in Seladongrün. Die Verkäuferin lächelt ihr zu. Seine Mutter zögert, wird unsicher, entgegnet, die Schauspielerin würde in diesem Film nie ein solches Grün tragen, das so … Eben, befindet Maria, Blau würde anzeigen, dass Sie einen Jungen erwarten, Rosa, dass es ein Mädchen wird. Bei Grün bleibt wenigstens alles offen.
Er greift nach dem Stoff, lässt ihn sachte zu den Fingern seiner Mutter hinübergleiten, betet, dass sie Marias Wahl samt Scheinargumenten annehmen möge, lauert auf die ersten Bewegungen ihres Nackens, ein zaghaftes Nicken, wie eine Welle, die vage in der Ferne wogt, anschwillt, ohne zu brechen oder von selbst zu verebben, jeden Moment geschluckt werden kann vom gleichmäßigen Faltenwurf. Maureen O’Hara könnte so ein Grün tragen, aber nicht Gene Tierney, grummelt sie und dreht ihm plötzlich den Kopf zu: Hättest du eigentlich lieber eine kleine Schwester oder einen kleinen Bruder, hab’ ich dich das überhaupt schon gefragt? Er weiß es nicht, sagt jedoch, er ziehe das Seladongrün vor. Zum ersten Mal spricht er das Wort »Seladon« aus. Er gibt sich Mühe, sagt es langsam, damit sie schon im Wortklang eine Harmonie vernimmt, etwas Friedliches, wie eine Frau, die ihr Kind erwartet und ihm bestimmt nichts Böses will.
Dann eben Grün, beschließt sie, aber die Amerikaner nennen das Eau de Nil.