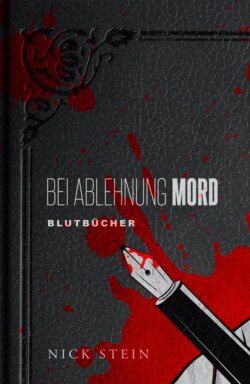Читать книгу Bei Ablehnung Mord - Nick Stein - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 9 Frau Mona Meyer-Hinrichsen
ОглавлениеIrgendetwas störte mich an diesem Text noch, auch wenn mir nicht klar war, was das war. Außerdem wusste ich längst nicht mehr, was genau vor ein paar Jahren Realität gewesen war und was ich mir später ausgedacht hatte. Der Text hatte eine Eigendynamik entwickelt, genau wie die Gefangenschaft unten im Keller.
Wie erwartet schlief die Lektorin. Aber sie musste etwas essen und trinken, noch war ihre Reise nicht zu Ende. Ich hatte ihr ein Fläschchen gemacht, da war alles drin, was sie brauchte. Losmachen wollte ich sie nach der letzten Erfahrung lieber nicht.
Als Erstes musste ich ihre neue Windel abmachen. Auch die war unbenutzt. Sie war wirklich sehr diszipliniert. Fast schade, dachte ich.
Als ich ihr den Klebestreifen vom Mund entfernt hatte und ihr das Fläschchen geben wollte, drehte sie den Kopf zur Seite. Sie wollte reden, nicht trinken.
»Sie können kein Blut sehen«, stellte sie fest. »Sie konnten mir die Finger nicht abschneiden, nicht wahr? Sie werden mich nicht umbringen. Was ist mit der Frau in diesem komischen Krimi passiert?«
»Sie konnte entkommen«, sagte ich. »Aber erst, nachdem vier andere Frauen grausam umgebracht worden waren. Und ich werde dir nicht sagen, ob du die Nummer eins oder die Nummer fünf bist.«
»Und wie sind die gestorben?«, wollte sie wissen.
Ich schob ihr die Nuckelflasche in den Mund und drückte ihr etwas vom Inhalt hinein. Nach anfänglicher Gegenwehr siegte der Hunger, und sie nuckelte gierig am Sauger. »Das ist alles von Feinkost Käfer«, informierte ich sie. »Alles püriert, natürlich. Wenn du brav bist, bekommst du sogar ein Gläschen Wein.«
Sie nuckelte weiter, gierig.
»Verschiedene Todesarten«, erzählte ich. »Eine wurde erwürgt, eine andere ist verhungert. Eine hat sich befreit und aus Ekel selbst aufgehängt. Die letzte ist im Unrat im Kanal ertrunken.«
»Alles ohne Blut«, befand sie zwischen zwei Schlucken aus der Flasche. »Schon mal schlecht. Frauen wollen Blut sehen. Blut ist wichtig. Blut ist Leben, aber auch Tod. Als Frau hat man ständig damit zu tun. Ohne Blut ist dein Krimi schon mal maximal nur die Hälfte wert.« Sie nuckelte weiter, zufrieden mit ihrer Analyse.
Da hatte sie mich vielleicht tatsächlich erwischt. Blut war in dem Text, den ich ihr geschickt hatte, tatsächlich nicht geflossen, erst zum Schluss. Das des Täters.
Ich staunte schon wieder über Frau Meyer-Hinrichsen. Sie war in keiner Position, irgendetwas entscheiden oder beeinflussen zu können. Und doch manipulierte sie mich nach Strich und Faden.
Sie werden mich nicht umbringen, hatte sie gesagt.
Mit einer ihrer Aussagen hatte sie erstaunlicherweise recht. Ich konnte tatsächlich kein Blut sehen, oder vermied es nach Kräften. Selbst als die Amis die gefangenen Taliban verhört und gefoltert hatten, hatte ich dafür gesorgt, dass das unblutig vor sich ging. Elektroschocks, Waterboarding, Prügel.
Aber es hatte auch andere Szenen gegeben, an die ich nicht gern dachte. Einem Stammesführer hatten sie eine Schweineniere transplantiert und ihm gesagt, dass sie sie nur wieder entfernen würden, wenn er redete. Einen anderen hatten sie mit Schweineblut übergossen. Das hatte mir zugesetzt.
Woher kam das, diese Abscheu vor Blut?
Ich wusste es, natürlich. Auch wenn ich es immer wieder verdrängte.
Dass mir die Priester in der Schule in die Hose gefasst hatten, beim Umkleiden vor dem Sport, beiläufig und scheinbar ohne Absicht, dass uns einer beim Nachhilfeunterricht gestreichelt hatte, das hatten wir alle noch hingenommen. Aber als ich meinem Lieblings-Priester, der uns unterrichtete, bei der Beichte erzählt hatte, wovon ich nachts träumte, von Mädchen nämlich, hatte er mir neben den üblichen Ave-Marias zeigen wollen, wohin das führte.
Ich hatte mich zur Strafe ausziehen müssen, er selbst hatte seine Hose runtergelassen, alles noch im Beichtstuhl, auf seiner Seite. Ich hatte ihn anfassen müssen, und dann hatte er mir sein dürres Glied in den Mund gesteckt und mir gesagt, was ich tun sollte.
Das war zu viel gewesen, selbst für einen hartgesottenen Schüler wie mich. Ich hatte ihm die kleine Eichel abgebissen und war damit rausgerannt, voll von dem Blut, das aus seinem Zötteli auf mich gespritzt war und mir unter der Kleidung auf der Haut herunterrann.
Zötteli. So nannte er das Werkzeug des Bösen, wenn er uns davon erzählt hatte. Ich war gleich aus der Klosterschule ins Dorf und zur Polizei gerannt und hatte ihnen das blutige, schrumpelige Teil auf den Tisch gespuckt, um anschließend in einem Weinkrampf zusammenzubrechen. Der Priester war mein Lieblingslehrer gewesen, ich hatte so viel von ihm gelernt, ich liebte ihn, und er wusste das.
Er war mir vorher noch nie körperlich nahegekommen, das waren immer die anderen gewesen. Und nun war er der Schlimmste von allen, das hatte mir am meisten zugesetzt. Und dann sein Blut, das an mir klebte wie eine Schuld, die ich auf mich geladen hatte, und die ich nie mehr abwaschen konnte. Klar, ich war im Recht, moralisch und juristisch, aber auf einer anderen Ebene hatte ich ihn verraten und war selbst schuldig.
Ich hatte jemanden verraten, der mir alles bedeutete. Andere, Schuldige umzubringen, per Drohne oder per Verrat, das bedeutete nichts. Das war das Handwerk des Krieges. Sicher, auch das waren Väter und Söhne, Lehrer und Schüler, aber ich kannte sie nicht, und sie alle waren schuldig.
Jeder war schuldig. Jeder hatte Dreck am Stecken. Keiner war ohne Sünde, ohne Schuld. Das war bedeutungslos. Sie gehörten alle bestraft.
Ich fragte mich, ob das der Grund sei, weshalb ich blutige Enden vermied. Und ob es auch der Grund sei, weshalb ich Schuldige bestrafen musste. Aber es war mir egal. Ich hatte ein Ziel. Vielleicht hing das alles mit diesen und anderen Erfahrungen zusammen. Es war egal. Nicht wichtig. Meine Mission war eine andere.
Frau Meyer-Hinrichsen hatte ausgenuckelt. Sie sah mich kritisch an. »Ich kann Ihnen immer noch helfen«, bot sie mir an. »Ich weiß, womit man Erfolg hat und womit nicht.«
»Du bist zur Bestrafung hier«, entgegnete ich. »Nicht zum Arbeiten. So einfach ist das nicht.«
Sie schloss die Augen und überlegte.
»Wie geht es denn mit der Frau in Mädchenbeute weiter?«, fragte sie. »Sie kann doch entkommen. Gut, ich habe das nicht gelesen, aber erstens kann ich nun wirklich nicht alles lesen, was irgendwo gedruckt wird, und zweitens ich muss doch meine Chance bekommen. Was muss ich tun?«
»Sie wird bestraft. Zuerst verliert sie alle Hoffnung. So wie du. Die Hoffnung, mich bestechen zu können. Die Hoffnung, befreit oder gefunden zu werden. Dass sich jemand findet, der sie sucht, der sie vielleicht von ihrem Peiniger erlöst. Die Hoffnung, unbeschadet und körperlich unversehrt davonzukommen.«
»Meine Hand tut weh«, jammerte sie. »Die Nagelbetten sind bestimmt entzündet! Wie soll ich denn jetzt arbeiten?«
»Selbst schuld. Du hättest mich nicht kratzen sollen. Aber tippen kannst du mit damit nach einer Weile wieder. Stell dich nicht so an.«
»Aber das sieht so scheiße aus!«, rief sie. »Wie soll ich denn mit so kurzen Nägeln irgendjemandem unter die Augen treten?«
Ich bemerkte die Tränen in ihren Wimpern. Dass kurze Nägel noch schlimmer waren als der bevorstehende Tod, hätte ich mir nicht träumen lassen.
Sie sah mir in meine verspiegelte Brille. »Warum verstecken Sie sich? Wenn ich Sie nicht sehen kann, weiß ich auch nicht, wie Sie aussehen. Dann können Sie mich doch auch laufen lassen. Kein Grund, mich umzubringen, nur weil Ihr Roman nicht ganz so toll ist, oder?«
»Soll ich meine Mütze lieber abnehmen?«, fragte ich vorsichtig.
»Nein«, antwortete sie und erblasste. »Dann müssten Sie mich töten. Ich will noch nicht sterben. Ich habe noch viel zu tun und viel zu erleben. Bitte.«
Aha, dachte ich. Sie verlegt sich langsam aufs Bitten.
Sie sah weiter zu mir. »Ich habe doch kaum was an. Ziehen Sie sich doch auch aus. Bis auf die Mütze, von mir aus. Wir könnten doch etwas Schönes miteinander machen. Ich werde mir Mühe geben. Und dann können Sie mich doch gehen lassen.«
»Sie versuchen das schon wieder«, grummelte ich. »Sie wollen die Initiative haben. Überlegen Sie doch mal. Nicht Sie bestimmen, wo es hier langgeht. Ich bin das. Und wenn sich hier was abspielt, dann wird das eine Vergewaltigung. Kein Liebesakt. Weiß Gott nicht.«
Frau Meyer-Hinrichsen schnaubte. »Soso! Aha! Also, worauf wartest du dann noch? Dann fick mich doch, du Arsch, oder kriegst du keinen mehr hoch? Na los, mach schon, ich kann’s kaum erwarten!« Sie versuchte, ihr Becken anzuheben und kreisen zu lassen, und mit den kleinen Brüsten zu wippen. Mit der dicken Windel, die sie anhatte, sah das alles andere als erotisch aus.
Und sie wollte mich schon wieder manipulieren. Das Tempo und die Agenda bestimmen.
»So läuft das nicht, Mona«, sagte ich. »Du glaubst immer noch, du könntest hier das Heft in die Hand nehmen. Lass lieber alle Hoffnung fahren. Vielleicht bekomme ich ja doch noch Mitleid. Aber deine Masche hier zieht nicht. Es ist spät. Du wirst jetzt schlafen.«
Ich legte mir ein paar Skalpelle und Werkzeug bereit, weit genug von ihr weg, aber so, dass sie sie sehen und darüber nachdenken konnte. Dann klebte ich ihr wieder den Mund zu und deckte sie zu. Als ich zur Treppe ging, hörte ich noch, wie sie durch die Nase schluchzte. Na also.
Morgen würde ein aufregender Tag werden.