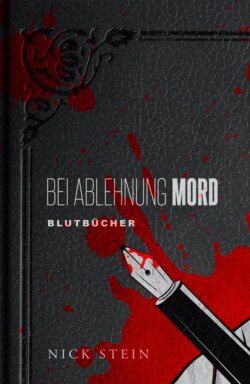Читать книгу Bei Ablehnung Mord - Nick Stein - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 4 Frau Meyer-Hinrichsen
ОглавлениеDer Text an Frau Herzog war weg, ich hatte ihn eben zur Post gebracht. Das hatte ein paar Tage Zeit. Jetzt hatte ich noch eine andere Leiche im Keller, wenn ich hier dieser so oft bemühten Redewendung einmal folgen darf. Ich hoffe, Sie werden mir das nicht übelnehmen.
Es ging um die Lektorin, Frau Meyer-Hinrichsen, die alles andere als tot war. Und sie lag auch nicht in meinem Keller, sondern in dem eines verfallenden Schlachthofes nahe München, in dem früher die Überreste der Schlachtungen in den Kanal entsorgt worden waren.
Die Lektorin war nach längerer Zeit der Abstinenz und der Abwesenheit aus Deutschland mein erster frischer Fall. So geschockt wie ich im Café von ihrer Ablehnung im ersten Moment gewesen war, so sehr freute ich mich jetzt über diesen neuen Job. Ich hatte einige Jahre im Ausland zubringen müssen, nachdem ein allzu hartnäckiger Kommissar mir viel zu eng auf den Fersen gewesen war. Ich hatte den penetranten Polizisten schließlich nur mithilfe der argentinischen Justiz abschütteln können.
Aber jetzt war ich wieder hier und konnte mein Werk weiterführen. Ich war gespannt, wo das hinführen würde.
Es war Zeit, mich um die Lektorin zu kümmern. Und um das, was jetzt in ihrem Kopf vorgehen musste. Es war wichtig, dass ich alles, was sich in ihrem Kopf abspielen musste, zu Papier brachte. Denn das würde ich alles in meinen Krimi mit einbauen, hatte ich beschlossen. Jede neue fiese Ablehnung würde ein neues Kapitel ergeben. Was jetzt wohl in Mona vorging? Ich begann zu schreiben.
* * *
Mona war stinksauer. Dieser Typ hatte sie beim Joggen betäubt und hierher verschleppt, in irgendeinen dunklen, unbequemen Keller, in den sie ganz gewiss nicht gehörte. Sie sah sich um. Außerhalb des Lichtkegels, der von der Decke auf sie herabfiel, konnte sie kaum etwas erkennen. Sie lag auf einer grauen Yoga-Matte, die schon reichlich zerschlissen und abgewetzt war. Die Matte lag teils auf Fliesen, teils auf Gitterrosten, unter denen sich etwas Kaltes, Dunkles verbarg, ein zugiger Abgrund, von dem sie gar nicht wissen wollte, was es genau war. Es roch vage nach altem Blut und Exkrementen. Nach Verlies und Moder. Nach Pfuhl.
Die Handschellen waren ihre eigenen. Rosa gefüttert, für ganz bestimmte Stunden. Sie schnaubte vor Wut. Wo hatte der Typ die her? War der etwa in ihrer Wohnung gewesen und hatte sie durchwühlt? Na klar, dachte sie, nachdem er sie betäubt hatte, war er mühelos an ihre Schlüssel gekommen. Aber woher wusste er, wo sie wohnte? Der Personalausweis in ihrer Tasche. Klar. War das so einfach gewesen, oder hatte der das von langer Hand geplant? Wie naiv war sie eigentlich gewesen, dem den Zugang zu ihrem Privatleben so einfach zu machen?
Die Lektorin hob den Kopf, so gut es ging. Ganz aufrichten konnte sie sich nicht, das ließen ihre Fesseln nicht zu. Immerhin konnte sie ihre Füße sehen, die mit rosa Bändern an das Bodengitter gebunden waren. Zu allem Überfluss hatte ihr Entführer auch noch Schleifchen in die Bänder gemacht. Sie hatte versucht, die Schleifen und Knoten durch Zerren und Treten aufzubekommen, aber das hatte zu nichts geführt. Sie war jetzt nur müde und schrecklich enttäuscht.
Nachdem sie aufgewacht war, hatte sie um Hilfe geschrien, so laut sie konnte. Es musste sie doch jemand hören können! Bis sie merkte, dass da niemand war. Sie hatte keine Ahnung, wo sie sich befand. Wie lange sie bewusstlos gewesen war. Wie der Typ sie hierhergebracht und gefesselt hatte. Was er vielleicht noch mit ihr gemacht hatte. Was er mit ihr vorhatte.
Es war drückend schwül und warm in diesem Keller, der bis auf den Lichtkegel um sie herum im Halbdunkel lag, und Mona war durstig. »Hey! Ich habe Durst! Ich brauche was zu trinken! Hilfe!!«, schrie sie noch einmal.
Keine Reaktion.
Immerhin war sie noch mit ihrer Unterwäsche bekleidet. Hatte der sie da unten angefasst? Schwer zu sagen. Aber getan hatte er ihr wohl nichts. Noch nicht. Das hätte sie gemerkt, aber untenrum fühlte sich alles normal an. Dennoch, ihre Lage war alles andere als gut. Der konnte jeden Moment runterkommen und sie vergewaltigen oder umbringen.
Sie zermarterte sich ihren Kopf. Was sollte sie hier?
Beim Fesseln an diese Gitter hier hatte der Typ etwas davon gesagt, dass sie seinen Roman verrissen hätte. Wenn sie das genau verstanden hatte, sie war noch benommen gewesen. Und dass sie statt seines Romans einen vorgezogen hätte, in dem eine Frau im Keller gefoltert würde. Es gäbe da einen, den hätte er extra noch gelesen, da war so eine Frau im Keller. Und genau das würde er jetzt mit ihr nachspielen. Sie, die Frau im Keller. Das Folteropfer. Er, der kaltblütige Killer. Der Folterknecht.
Hatte sie das wirklich gehört, oder im Tran nur eingebildet? Fakt war, dass sie gefesselt hier unten lag.
Im Krimi, den sie lektoriert haben sollte und den er gelesen hatte, sollte sich seinen Worten zufolge eine Frau aus genau der gleichen Lage befreit haben. Nur wie? Verdammt! Wie sollte sie denn hier bloß rauskommen?! War das ein blöder Test, womöglich eine Art Dschungelcamp für Lektoren, und die halbe Republik sah ihr im Fernsehen zu und lachte sich kaputt, weil sie hier nicht rauskam?
Blöd, dass sie ihre Assistentinnen die ganze Arbeit machen ließ. Sie hatte keine Ahnung, was in dem Roman gestanden hatte.
Was wollte der eigentlich von ihr? Sich rächen, weil sie ihn beleidigt hatte, weil sie ihn verächtlich behandelt hatte, so was in der Art. So ein selbstherrlicher, beleidigter Typ, der Wunder was von seinem Geschreibsel hielt, wobei es unter Garantie wieder derselbe Mist war, den sie täglich hundertfach auf den Tisch bekam.
Ich will doch nur, dass mein Werk mit Respekt und Würde behandelt wird; diese Worte von ihm hallten immer noch in ihrem Kopf nach.
Aber das sagte doch jeder von ihnen, all die achthundert zukünftigen Literaturnobelpreisträger, die sich monatlich bei ihr meldeten und ihr Geschreibsel unbedingt gedruckt sehen wollten. Eine stinkende Flut, bei der es nur half, so rasch wie möglich die Spülung zu ziehen und den Mist loszuwerden.
Aber dieser Psycho hatte ihr das krummgenommen. Und jetzt lag sie hier unten und kam und kam nicht drauf, wie sie hier wieder rauskommen sollte. Es musste irgendwie gehen. Was, wenn das wirklich ein Test oder Teil einer Show war? Dann würde sie sich scheußlich blamieren. Wenn der jetzt was von ihr wollte, womöglich vor laufenden Kameras? In ihr sträubte sich alles bei dem Gedanken. Aber sie sah nichts von technischen Geräten in diesem stinkenden Verlies, so sehr sie den Kopf auch drehte.
Mona blähte ihre Nasenflügel und stieß hörbar ihren heißen Atem aus. Sie hatte keine Zeit für so einen Scheiß. Sie hatte zu tun, im Verlag und auch sonst, sie hatte gesellschaftliche Verpflichtungen, sie hatte diese Woche ein Date, und sie musste dringend aufs Klo.
»Hey! Ich brauche was zu trinken! Und ich muss zur Toilette!«, schrie sie ins Dunkle, in Richtung Treppe, über die der Typ verschwunden war.
* * *
So oder so ähnlich musste die Frau sich da unten jetzt wohl fühlen. Ich hatte zumindest schon mal einen Text. Aber jetzt musste ich sehen, wie es ihr wirklich ging. Und auch das musste ich dokumentieren. Denn Ihnen kann ich das beichten. Wenn Sie ein Leser und nicht auch ein Lektor oder eine Lektorin sind. Oder von der Polizei.
Ich hatte jetzt einen Plan. Den nächsten Lektor-Mord, ob fiktiv oder real, in meinen Krimi einbauen, den Roman an das nächste Lektorat senden, und vielleicht eine weitere Ablehnung erhalten; einen weiteren Lektor bestrafen und aus alldem eine Stafette aus Lektormorden aufbauen, solange bis das endlich jemand druckte, oder bis mich schließlich doch die Polizei erwischte? Oder bis der Republik die Lektoren ausgingen? War das ein guter Plan?
Ich war mir noch nicht sicher. Denn dann musste ich die Lektorin ja wirklich zum Verstummen bringen. Wollte ich das? Sicher, ich wollte sie bestrafen. Um viel mehr war es mir bis hierher nicht gegangen.
Musste ich jetzt weitermachen und sie töten, nachdem ich sie entführt hatte und hier gefangen hielt? Kaum vorstellbar, dass ich sie jetzt noch zu einer Zusammenarbeit überreden konnte. Aber vielleicht konnte ich sie zu mehr Einsicht bewegen; dann könnte ich ihr später, anonym natürlich, ein anderes Werk anbieten. Dann war sie womöglich einsichtiger geworden.
War es schon zu spät für eine Rehabilitation und eine Freilassung? Musste ich sie jetzt aus der Welt schaffen? Nicht, dass ich das nicht zu Ende bringen könnte, ganz im Gegenteil. Ich bin viele Jahre lang Soldat gewesen, und wer einmal Soldat war, bleibt es sein Leben lang. Töten ist leicht, und Skrupel habe ich noch nie gehabt.
Trotzdem. Ich habe ein gewisses Problem mit den Opfern. Sie hinterlassen Blut und Dreck, wenn sie sterben. Davon hatte ich in meinem Leben schon genug gesehen. Ich finde das widerlich. Das Blut spritzt und schmiert, es läuft überall hin, es klebt und riecht und hinterlässt Spuren. Darm und Blase entleeren sich unkontrolliert. Man muss das wegmachen, man kommt mit diesem Unrat in Kontakt. Macht sich schmutzig. Es stinkt zum Himmel. Und all die Drecksarbeit bleibt an einem selbst hängen. Keine afghanischen Helfer, die einem das klaglos wegräumen. Jemanden beseitigen, gut. Aber der ganze Dreck kann mir gestohlen bleiben.
Frau Meyer-Hinrichsen lebte ja noch.
Wie sollen Leser denn meine Werke in die Hände bekommen, wenn sich diese lustlosen und bequemen Lektorinnen nicht einmal bemühen, sie auch nur anzulesen?
Mona Meyer-Hinrichsen schrie unten im Keller herum. Jetzt brauchte sie mich. Dafür hatte ich schon mal gesorgt. Vorher hatte sie mich ja anscheinend überhaupt nicht gebraucht.
Es gab eine Zeit, da war es mir um spektakuläre und geniale Exzesse gegangen, um Bestrafungen, die ihresgleichen suchten, öffentliche Bloßstellungen, Hinrichtungen, ohne dafür belangt werden zu können. Perfekte, großartige Morde. Heute bin ich bescheidener geworden; das Spektakel brauche ich nicht mehr.
Mir geht es inzwischen mehr um chirurgische Präzision, wenn jemand verschwinden muss. Nicht, was Sie jetzt beim Wort chirurgisch denken; jemanden langsam und genüsslich mit dem Skalpell aufzuschlitzen. Sicher, manch einer mag das, und solche Leute habe ich in Afghanistan zur Genüge kennengelernt.
Wenn man den Opfern in die aufgerissenen Augen sieht, wie die armen Kerle versuchen zu begreifen und doch mitansehen müssen, wie das Leben aus ihnen herausspritzt. Die aufgerissenen Münder, die den Schmerz herausschreien, all das. Natürlich. Manch einer findet das sehr, sehr schön. Es hat auch was.
Mein Ideal ist das trotzdem nicht, im Gegenteil. Das geht auch eleganter, sauberer und klinischer. Und ohne Spuren zu hinterlassen. Leute ohne das ganze Geschmiere zu beseitigen, das ist eine reizvolle und lohnenswerte Aufgabe.
Mein Ideal ist die chirurgische, non-invasive Entfernung einer störenden Person aus dieser Welt. Sauber. Perfekt. Unauffällig. Elegant. Vielleicht verstehen Sie ja, was ich meine. Ein soziales Skalpell, mit dem man jemanden für immer verschwinden lassen kann. Ohne den ganzen Dreck. Ich bin kein Sadist. Ich bin nur entsetzlich enttäuscht. Und gewohnt, ordentlich zu arbeiten. Und ich wollte endlich ein Buch veröffentlichen. Mein Buch. Meine Geschichte.
Die Lektorin lag da wie das wunderschöne Opfer in dem Roman, der ihren Wünschen entsprach. Es war schön, wie sie ihr Wunschthema in die Realität übertrug, ohne es zu wissen. Wenn sie selbst auch längst nicht so schön war wie das literarische Opfer; sie war eher klein und mager, hatte aber ein ansprechendes Gesicht zwischen ihren kleinen Ohren und unter ihren kurzen, schwarzen Haaren.
»Ich habe Durst, und ich muss mal«, stöhnte sie leise. Immerhin nicht: Wo bin ich? Dann hätte ich sie womöglich gleich umgebracht. Ich hasse Klischees.
»Das ist bald vorbei«, sagte ich zu ihr.
Sie drehte langsam den Kopf. Sehen konnte sie mich nicht. Sie lag im Lichtkegel eines Deckenstrahlers, der Rest des Kellers lag im Dunkeln. Ich trug Schwarz, über dem Kopf eine leichte Skimaske, die mir hervorragend stand, dazu eine verspiegelte Brille. Das würde das Einzige sein, was sie je von mir zu sehen bekam. Ich sehe zu markant aus, als dass man mein Gesicht wieder vergessen könnte. Und solange sie mich nicht sehen konnte, hatte sie eine Chance, zu überleben.
»Wer sind Sie? Was mache ich hier?«, krächzte sie. Und dann leider doch: »Wo sind wir hier?« Sie versuchte sich aufzurichten, aber das scheiterte. Sie war mit Hand- und Fußschellen lose an das Gitterrost am Boden gekettet, die Ketten dazwischen ließen der am Boden gekreuzigten Lektorin ein wenig Spielraum. Aber nicht genug, um sich ganz aufzusetzen.
Okay, sie war durstig und musste auf die Toilette. Zumindest dafür hatte sie mein Mitgefühl. Ich ging rüber und lockerte mit dem Fuß vorsichtig eine der Bodenfliesen, auf denen sie lag. Darunter verborgen lag ein Schlüssel für ihre Handschellen. Hätte sie ihn entdeckt, hätte sie sich befreien können, so viel Spielraum ließ ihr die Fesselung. Aber nichts dergleichen hatte sie geschafft. Ein Zeichen mehr dafür, dass sie keine Ahnung und kein Gespür hatte. Ein guter Lektor hätte alles probiert und sich vielleicht befreien können.
Aber sie hatte keinen blassen Schimmer.
Ich trat einen Schritt näher an sie heran, so dass sie meine Umrisse sehen konnte. Sie ließ den Kopf auf den Boden sinken und schloss die Augen.
»Scheiße«, stöhnte sie halblaut. »Ein Irrer.« Sie zerrte wie zur Probe an den Armfesseln. Dann mit aller Kraft. »Mist.« Sie schnaubte ärgerlich. Noch hatte sie ihre Situation nicht vollkommen verstanden. Den Ernst der Lage. Sie hatte noch Hoffnung. Sie fand sich gerade erst zurecht.
»Da lag auch ein Mädchen im Keller«, sagte ich ihr. »In einem Krimi, den du selbst lektoriert hast. Der muss doch ganz nach deinem Geschmack sein. So, wie du es gern hast.«
Sie runzelte nur die Stirn. Schüttelte den Kopf.
Ich nannte ihr den Titel des Romans, den wir hier nachspielten. Mädchenbeute. Aber sie hatte ihn wohl nur lektoriert, aber nicht gelesen. Sonst hätte sie sich befreien können. Meine Achtung vor ihr sank weiter.
Ich ging langsam um sie herum. Ihre warmen Wintersachen hatte ich ihr ausgezogen, hier im Keller war es warm genug. Sie hatte nur noch ihre Unterwäsche an. Ich beendete meine Runde und stand wieder an meinem alten Platz.
Sie war mir mit den Augen gefolgt.
»Und?«, fragte ich.
Sie schloss die Augen wieder und schien nachzudenken. »Nein. Tut mir leid. Nie gehört.«
»Du hast im Café mit der Praktikantin über meinen Krimi gesprochen«, erklärte ich. »Lea Walter. Die hatte ihn durchgelesen und fand ihn eigentlich ziemlich gut. Sie hat dir eine Synopse davon gegeben, bei Kaffee und Kuchen.« Ich ging zu ihr hinüber und setzte mich vor ihre nackten Füße.
Frau Meyer-Hinrichsen saugte die Wange auf einer Seite in den Mund ein. Sie dachte nach. »Ja, und?«
»Du hast gesagt, das wäre ein Schmarrn von einem Arschloch. Der Autor wäre deppert. So in dem Stil. Ich möge mich doch bitte zum Teufel scheren. Und Lea Walter hast du gesagt, dass sie mir eine Ablehnung schicken soll.«
»Aber sie schreibt das doch wirklich immer so nett«, versuchte sie sich rauszureden.
»Schon. Wir bedauern, leider, gegenwärtig nicht möglich, schade, viel Glück weiterhin. So was in der Art. Aber ich hatte euch beiden ja zugehört. Ich habe dich bei diesem Betrug erwischt, Mona. Und das läuft mit mir nicht.«
Sie überlegte und zerrte dann wieder an ihren rasselnden Ketten. »Lassen Sie mich hier raus! Ich verspreche Ihnen, ich lese mir Ihr Werk sofort selbst und sehr aufmerksam durch.« Sie zog wie wild an der rechten Handfessel, ihre Haut rötete sich bereits stark. Tat ihr das nicht weh? »Na los! Ich hab’ zu tun, verdammt noch mal!!«
»Du bist keine gute Lektorin«, erklärte ich ihr sehr behutsam. »Du nimmst deinen Job nicht ernst genug. Du lässt deine Arbeit von anderen machen und hörst nicht zu. Du bist faul. Du lässt dich von Wunschdenken treiben. Und du hast mich schwer beleidigt.«
Frau Meyer-Hinrichsen versuchte es an den Fußfesseln und zog mit aller Kraft die Knie hoch. Ihr Fußknöchel knackte laut. »Au! Das tut weh, Mann! Machen Sie mich sofort los! Ich muss mal!«
Ich hörte darüber hinweg. »Wir beide werden jetzt überprüfen, wie gut dein Wunschkrimi ist. Du und ich. Wir spielen das jetzt bis zum Ende durch. Du bist das Mädchen, ich bin der Täter. Ganz so, wie du es magst.«
Sie sah indigniert in meine Richtung, wie zu einem räudigen Köter, der ihr gerade einen Haufen vors Auto gesetzt hatte. »Ach leck mich doch! Lassen Sie mich sofort hier raus!« Auf ihrer Stirn erschienen trotz ihrer Forschheit die ersten Perlen der Angst. Dann fiel ihr Blick auf die Fesseln. »Und das sind meine Handschellen! Die hat mir mein Freund geschenkt!« Sie sah in meine Richtung. »Sie waren in meiner Wohnung«, stellte sie angewidert fest.
Ich trat an ihre rechte Seite, kniete nieder, klappte die lose Fliese hoch, nahm den Schlüssel heraus und zeigt ihn ihr. »Der war für die Handschellen. Mit etwas Nachdenken hättest du ihn gefunden und hättest fliehen können. Stand so in dem Roman.«
Ich stand auf, trat einen Schritt zurück und warf den Schlüssel durch das Bodengitter in den darunterliegenden Kanal. Einen Moment später platschte es dumpf, als ob er in einen zähflüssigen Morast geplumpst wäre. Irgendetwas quiekte dort unten. Und hörte ich da ein Geräusch von kleinen, trappelnden Füßchen?
»Jetzt musst du hier durch. Tut mir leid.«
Das brauchte eine Weile, um einzusinken. Die junge Frau sackte auf ihre dünne Matratze zurück und seufzte. Sie atmete tief durch. Noch hatte sie Kraft und Mut. »Ich muss jetzt wirklich dringend aufs Klo«, verlangte sie.
Schön! Ich mochte das. Sie wehrte sich mit allen Mitteln. Aufs Klo gehen war ein Naturrecht. Ein Akt der Würde. Ein Menschenrecht. Wenn ich sie ließ, hatte sie einen Punkt gegen mich gemacht.
»Zieh einfach deine Matratze etwas zur Seite«, empfahl ich ihr. »Darunter ist ein grobes Gitter und unter dem ein tiefer Schacht. Anschließend ziehst du deine Matratze wieder unter dich.«
Dass das Gitter zu einem Fluchtweg führte, hatte auch in diesem Roman gestanden, der ihr gefallen hätte. Mit dem gefolterten Mädchen im Keller. Es war ein unangenehmer und stinkiger Fluchtweg, der von dem stillgelegten, alten Schlachthof in die städtische Kanalisation führte, aber ein gangbarer Weg. Wenn sie das Gitter aufbekam. Auch dazu musste sie etwas wissen, das im Krimi gestanden hatte.
Sie klang jetzt etwas kleinlauter. »Das geht nicht. Ich komme doch nicht an mein Höschen. Und ich muss mich auch saubermachen können.« Sie sah besorgt aus, als sie das Wort Höschen aussprach. Hoffentlich führt das nicht noch zu etwas Schlimmerem, sagte ihr Gesichtsausdruck.
»Das lass mal meine Sorge sein.« Ich stellte ihr ein Glas Wasser und eine geöffnete Packung Kekse in Reichweite, drehte die Heizung runter und machte die volle Beleuchtung im Keller an. Grelles Licht flutete den verdreckten Raum. Schlafentzug wirkt Wunder, das kannte ich nur zu gut. »Ich hole dir ein paar Rentnerwindeln von oben runter. In der Zwischenzeit darfst du über deine Situation nachdenken.«
»Moooment!« Das klang wie ein Befehl. Als ob sie es gewohnt wäre, ständig das Kommando zu führen.
»Okay, ich verstehe, ich soll hier das Opfer spielen. Und Sie den Täter. Aber Sie wissen doch, wie alle Krimis ausgehen. Der Bad Guy wird am Ende immer geschnappt. Sie haben keine Chance. Man wird mich vermissen. Die haben Mittel, rauszufinden, wo ich bin. Die Polizei ist mit Sicherheit schon auf dem Weg. Die kommen Sie holen! Machen Sie mich los. Jetzt! Dann haben Sie noch eine Chance!«, sagte sie triumphierend.
»Netter Versuch«, sagte ich ihr. Aber ich ärgerte mich doch. Klar wurde der Kerl in Mädchenbeute am Ende geschnappt. Aber bis in dieses Detail wollte ich den Krimi nicht nachspielen. Mich würde niemand erwischen. Mich nicht.
»Jetzt hältst du mal schön dein freches Mundwerk.« Ich klebte ihr ein Stück Isolierband über den Mund. Sie versuchte trotzdem zu schreien. »Hier findet dich garantiert niemand.«
Ich ging zurück nach oben in mein provisorisches Lager. Dort hatte ich alles, was ich brauchte, und ich schlief auch dort. Seit meiner Zeit in Afghanistan brauche ich keine weichen Betten mehr. Härte gegen meinen Körper und gegen andere kenne ich seit meiner Kindheit.
Wenn einer wie ich zu einer katholischen Grundschule und danach aufs Canisius-Kolleg in Berlin, nach Ettal und St. Blasius gegangen ist, ist er hart im Nehmen. Physisch und sozial.
Es gibt immer noch Dinge, über die ich noch heute nicht gern rede. Aber ich hatte an diesen Schulen auch meinen ersten großen Durchbruch. Wenn Sie von Skandalen mit abhängigen Schülern an einer dieser Institutionen gelesen haben, dann war ich immer mittendrin.
Und an einer dieser Schulen war es niemand anderes als meine Wenigkeit, die den Skandal aufgedeckt hatte. Ich. Mit Pauken und Trompeten. Seit diesen Tagen kenne ich das Gefühl von Macht. Und das der Rache. Ich spürte eine leichte, prickelnde Freude in mir aufsteigen. Das konnte hier noch schön werden.
Windeln für Inkontinente hatte ich schon vor langer Zeit besorgt, in einer Apotheke in Bamberg, weit genug weg. Planung ist mein dritter Vorname.
Ich ging wieder in den Keller und zog der Lektorin den Slip herunter, um ihr die Windel anzulegen. Sie versuchte sich zu wehren, aber mit Hand- und Fußschellen hatte das wenig Sinn. Außer Aufbäumen war da nicht viel drin. Sie grunzte gegen das Klebeband an wie ein Schwein beim Schlachter.
Ich musste über ihre warme und hässliche Unterwäsche schmunzeln. Dass die so was trug! Dann musste ich richtig lachen.
Sie hatte ihre Schamhaare so rasiert, dass zwei kleine Kreise und darunter ein Halbmond stehen geblieben waren. Ein Smiley. Darunter ein winziges Tattoo mit einer Zunge, eine Kopie der Grafik auf der Stones-LP Sticky Fingers. Und über dem Smiley saß eine hässliche, schwarze Warze mit drei abgeschnittenen Haaren darauf. Das war ihr peinlicher als ihre Nacktheit, ihrem Gesichtsausdruck nach zu schließen.
Ich legte ihr umständlich die Windel an. Sie wollte das nicht und drückte ihren Po gegen den Boden. Aber sie hatte gegen meine Kraft keine Chance. Dann stand ich auf und begutachtete mein Werk. »Fertig. Du kannst jetzt.«
Sie verzog nur angeekelt das Gesicht. Sie wirkte gedemütigt. Sie war nicht vergewaltigt worden, was sie vielleicht erwartet hatte, aber sie war wie ein unmündiger Mensch behandelt worden. Sie fing wieder an zu würgen, wie am Anfang, als ihr von der Betäubung noch schlecht gewesen war. Aber es kam nichts. Sie sah mich flehend an.
»Ich lasse dich jetzt allein. Gute Nacht.« Ich ließ den Deckenstrahler an und verschwand nach oben.