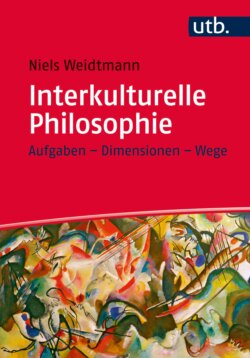Читать книгу Interkulturelle Philosophie - Niels Weidtmann - Страница 10
1.2 Transkulturalität
ОглавлениеIn den 1990er Jahren hat Wolfgang WelschWelsch, Wolfgang den Begriff der Transkulturalität in den deutschsprachigen Raum eingeführt und für eine kritische Reflexion des Kulturbegriffs herangezogen.1 Der Begriff geht auf Fernando OrtizOrtiz, Fernando zurück, der ihn bereits um 1940 dazu verwendete, den kulturellen Wandel auf Kuba zu beschreiben.2 Später wurde er, zunächst vor allem in Amerika, in verschiedenen Disziplinen aufgegriffen.3
WelschWelsch, Wolfgang übernimmt den Begriff der Transkulturalität, um die kulturelle Wirklichkeit der Gegenwart zu beschreiben, die, so Welsch, durch die Auflösung der Einzelkulturen geprägt ist. Das Leben des Einzelnen ist nicht so sehr durch seine kulturelle Herkunft als vielmehr durch die ökonomische Situation, durch Bildungschancen, politische Gestaltungsmöglichkeiten, die Freiheit des Glaubens, ökologische Rahmenbedingungen und viele weitere Faktoren bestimmt, die allesamt nicht kulturspezifisch sind, sondern in den verschiedenen Kulturen gleichermaßen virulent sind. In allen Kulturen stellen sich heute ähnliche Probleme, und immer häufiger lassen sich Antworten auf diese Probleme nur noch gemeinsam finden. Das führt zu einer Angleichung der Kulturen aneinander. Zugleich aber beobachten wir einen starken Differenzierungsprozess innerhalb der Kulturen. Früher als verbindlich erachtete Lebensformen weichen einer Vielzahl individueller Lebensstile, die längst auch Praktiken anderer kultureller Traditionen integrieren. So wird etwa die christliche Verwurzelung der meisten europäischen Kulturen keinesfalls nur durch den Abfall vom Glauben und eine sich stark verbreitende ›Unmusikalität‹ in Glaubensfragen (Max Weber) relativiert; vielmehr treten immer häufiger neben den christlichen Glauben auch andere Glaubensformen, die aus anderen Kulturen übernommen und in den Lebensentwurf von Menschen integriert werden, die in überwiegend christlich geprägten Gesellschaften leben. Noch viel offensichtlicher wird die Durchmischung der Kulturen mit Blick auf alltäglichere Phänomene, etwa die Essgewohnheiten, die Musik, die Literatur und den Sport. Ganz selbstverständlich hören wir heute afrikanische Musik (bezeichnender Weise unter dem Titel der ›Weltmusik‹), lesen lateinamerikanische Literatur und treiben asiatische Kampfsportarten. Die Durchlässigkeit der Kulturen wird durch Migration und globale Kommunikation immer weiter vorangetrieben. Keine Kultur kann es sich heute noch leisten, sich gegen andere abzuschotten und ihre eigenen Traditionen gegen äußere Einflüsse zu verwahren. Welsch spricht davon, dass kulturelle Authentizität heute zu Folklore verkommen ist. In jeder Kultur sind Lebensformen und -praktiken aller Kulturen zu finden. Diversifizierung der Einzelkulturen und Angleichung der verschiedenen Kulturen stellen die zwei Seiten ein- und desselben Prozesses dar: Dieser Prozess besteht in der Auflösung der traditionellen und traditionsbezogenen Kulturen zugunsten einer diversifizierten und transkulturellen Globalität. Der Einzelne gewinnt seine Identität nicht mehr vorrangig aus seiner kulturellen Herkunft, sondern setzt sie, so Welsch, aus einer Vielzahl von Komponenten ganz verschiedenen kulturellen Ursprungs zusammen.
Es ist WelschWelsch, Wolfgang wichtig zu betonen, dass ein solch transkulturelles Modell nicht nur besser geeignet ist, die gegenwärtige Situation zu beschreiben, sondern darüber hinaus auch in seinem normativen Anspruch vertretbar ist. Es befreit den Einzelnen aus kulturellen Zwängen und löst die Kulturen aus der abwehrenden Konkurrenz, in der sie Welsch zufolge traditionell zueinander standen (obwohl Welsch keinesfalls leugnet, dass es gelegentlich auch früher schon einen fördernden Austausch zwischen den Kulturen gegeben hat; nur war dies nicht die Regel und hat schon gar nicht das Selbstverständnis der Kulturen geprägt).
WelschWelsch, Wolfgang grenzt seine Konzeption der Transkulturalität strikt gegen jene von Multi- und Interkulturalität ab, denen er beiden vorwirft, an einem alten, traditionsbezogenen Kulturbegriff festzuhalten. Um diesen alten Kulturbegriff zu veranschaulichen, greift Welsch auf die HerderHerder, Johann G. entlehnte Metapher der Kugeln zurück. Demnach sind Kulturen kugelartig – in sich ruhend und nach außen abgeschlossen. Eine solche Vorstellung (die freilich so von Herder selbst gar nicht vertreten wurde) geht davon aus, dass jede Kultur ihr eigenes Wesen besitzt, das sich in allen Lebensformen dieser Kultur zeigt. Dieses traditionelle Kulturmodell ist deshalb das einer homogenen, substantiell kaum wandelbaren und eben deshalb in hohem Maße traditionsbezogenen Kultur. Zudem wird ein solch kugelartiges Kulturverständnis häufig mit einem einzelnen Volk in Verbindung gebracht, so dass die Zugehörigkeit zu einer Kultur damit korreliert, einem bestimmten Volk anzugehören. Schließlich sind die kugelartigen Kulturen auf ihr Wesen als dem eigenen Mittelpunkt bezogen und grenzen sich gegen andere Kulturen radikal ab. Daraus resultieren zahlreiche Konflikte. Welsch versteht die Konzeption der Interkulturalität nun als den Versuch, diesen Konflikten durch einen Dialog der Kulturen zu begegnen. Die Kulturen sollen trotz ihrer vehementen Abgrenzung gegeneinander lernen, sich wechselseitig zu respektieren und in Frieden miteinander zu leben. Ganz ähnlich versteht er auch Multikulturalität als das geregelte Nebeneinander verschiedener, voneinander getrennt bleibender kultureller Einheiten innerhalb einer Gesellschaft. Freilich, so ehrenhaft das Bestreben, Konflikte zu vermeiden, auch ist, kranken Welsch zufolge sowohl Interkulturalität als auch Multikulturalität daran, dass sie an einem traditionellen Kulturverständnis festhalten, das den Gegebenheiten der Gegenwart nicht mehr entspricht und ihren Anforderungen nicht genügen kann.
Das Konzept der Transkulturalität scheint die kulturelle Situation der Gegenwart auf den ersten Blick in der Tat adäquat zu beschreiben. Wir sind heute nicht mehr auf eine kulturell einheitliche Lebensform festgelegt; im Gegenteil, wir legen großen Wert auf einen individuellen Lebensstil und greifen bei der Gestaltung dieses Lebensstils ganz selbstverständlich auf Errungenschaften anderer Traditionen zurück. Schon der zweite Blick freilich sollte uns ein wenig vorsichtiger werden lassen. Was uns in Nord- und Mitteleuropa selbstverständlich zu sein scheint, gilt in anderen Gegenden nicht unbedingt in gleicher Weise. Schon im südeuropäischen Raum ist die Bindung an Traditionen ungleich stärker als im Norden. Und doch mag man die transkulturelle Beschreibung grosso modo für den gesamten Westen, einschließlich Nordamerikas gelten lassen. Aber leben die Menschen in islamisch geprägten Ländern auf gleiche Weise transkulturell? Wir unterstellen zumeist, dass sie das anstreben, und wundern uns dann, wenn religiös geprägte Parteien, die sich auf eine bestimmte Tradition stützen, in einer demokratischen Wahl an die Macht kommen. Wie steht es mit Schwarzafrika, mit Ostasien, mit Lateinamerika? Lassen sich die Unterschiede zwischen den Lebensformen in diesen Gegenden tatsächlich auf individuell verschiedene Stile reduzieren? Sicherlich, das Internet verbindet das afrikanische Dorf mit der japanischen Metropole, aber liegen die Unterschiede deshalb wirklich nur noch in der Differenz zwischen Dorf und Stadt, zwischen arm und reich begründet? Viel nahe liegender ist es anzunehmen, dass sich weiterhin die Lebenserfahrungen der nächsten Umgebung prägend auf die Gestaltung individueller Lebensstile auswirken. Diese Lebenserfahrungen freilich ändern sich in unserer globaler werdenden Welt. Insofern ist WelschWelsch, Wolfgang durchaus zuzustimmen in seiner Diagnose eines Wandels der Kulturen. Nur bedeutet ein solcher Wandel nicht die Auflösung konkreter, geschichtlich geprägter Lebenskontexte – und eben das sind die Kulturen.
Vor allem aber ist die Konzeption der Transkulturalität keineswegs voraussetzungslos: Die transkulturelle Gesellschaft setzt ganz ähnlich wie die multikulturelle einen liberalen, wertneutralen Rechtsstaat voraus, der die Gleichberechtigung der diversen Lebensformen und -stile sichert. Es sei darum nochmals an TaylorsTaylor, Charles Wort vom Liberalismus als einer »kämpferischen Weltdeutung« erinnert.4 Transkulturell kann eine Gesellschaft nur werden, wenn dies die Richtung ist, in die sich eine Kultur entwickelt. Transkulturalität ist dann aber eben auch nur so etwas wie ein kultureller Stil.
Aus philosophischer Sicht stellen sich freilich noch ganz andere Fragen. Die Vorstellung einer Auflösung der Kulturen zugunsten einer Pluralität von Lebensformen, die sich aus Komponenten verschiedener Traditionen zusammensetzen, offenbart ein Kulturverständnis, das gerade im Licht von WelschsWelsch, Wolfgang Kritik am traditionellen Kulturbegriff höchst fragwürdig erscheint:
Philosophisch gesehen liegt der entscheidende Schritt vom traditionellen zum transkulturellen Kulturbegriff, so wie WelschWelsch, Wolfgang beide darstellt, in der Auflösung einer als homogen und auf ihr eigenes Wesen ausgerichtet vorgestellten Entität zugunsten der Verflechtung, Durchmischung und Wechselbeziehung zwischen heterogenen und wandelbaren Lebensformen. Die Kulturen sind dieser Vorstellung zufolge nicht durch unveränderbare Wesensgehalte, sondern durch konkrete Lebensformen und Lebenspraktiken bestimmt. Die Lebensformen wandeln sich mit der Zeit und sie können sich kulturübergreifend mischen. Schon innerhalb einer Kultur treten ganz verschiedene Lebensformen in einen lebendigen Austausch untereinander und bedingen dadurch Heterogenität schon auf der Ebene des Individuums. So ist es viel zutreffender, jemanden als heterosexuell, vermögend, kinderlieb, fußballbegeistert und Liebhaber des No-Theaters zu beschreiben, denn ihn als Asiaten oder Japaner zu bezeichnen. Nicht die Herkunft, sondern die gelebte Praxis bestimmt, wer der Einzelne ist. Der Gedanke bleibt aber auf halbem Wege stehen, wenn man statt der Kulturen nun die verschiedenen Lebensformen als wesenhaft bestimmt versteht. Dann wäre die eben beschriebene Person zwar nicht durch das Wesen der asiatischen Kultur, wohl aber durch die Wesensgehalte von Heterosexualität, Reichtum, Kinderliebe, Fußball und No-Theater geprägt. Gegenüber dem von Welsch als traditionell bezeichneten Kulturverständnis wäre damit eine größere Auswahl an Lebensformen gewonnen, an der Traditionsbezogenheit der verschiedenen Lebensformen aber würde sich nichts ändern. Der Einzelne würde nicht mehr in die große Schublade des ›Asiatisch-seins‹ passen, er würde dafür aber in eine Vielzahl kleinerer Schubladen gesteckt. An die Stelle der kulturellen Kugeln träten lebensformende Kügelchen.
Die Annahme einheitlicher Lebensformen aber widerspricht der Wirklichkeit der Phänomene massiv. Kinderliebe ist nicht gleich Kinderliebe. Die Beziehung zu Kindern hat sich in den letzten hundert Jahren stark gewandelt (und sie war auch davor keinesfalls unveränderlich). Kinder haben heute einen anderen gesellschaftlichen Stand, als dies noch vor hundert Jahren der Fall war. Unsere ganze Gesellschaft ist zunehmend auf Jugend ausgerichtet; wir achten sehr viel mehr auf die Kindesentwicklung als früher; die Familienstruktur ist eine andere geworden und vieles andere mehr. Zudem stellt sich die Liebe zu Kindern bei der einen Person u.U. ganz anders dar als bei der anderen. Kinderliebe kann dazu führen, selbst viele Kinder haben zu wollen; sie kann aber ebenso gut zu politischem Engagement für die Rechte und das Wohl von Kindern führen. Was Kinderliebe im Einzelnen bedeutet, hängt an der jeweiligen Person und an der historischen Situation und den aktuellen Gegebenheiten, in denen diese Person lebt. Was Kinderliebe genau bedeutet, bestimmt sich sehr viel mehr durch die von der einzelnen Person gelebte Praxis, als dass umgekehrt die Person durch das Wesen einer kinderlieben Lebensform geprägt wäre. Gleiches gilt selbstverständlich für alle anderen Lebensbereiche. Schon der Begriff der Lebensform weist darauf hin, dass es auf die gelebte Praxis und nicht auf das Wesen einzelner Lebensformen ankommt. Lebensformen können also keinesfalls aus einer anderen Kultur einfach übernommen und in die eigene integriert werden. Die Übernahme einer Lebensform bedeutet deren praktischen Vollzug und damit immer auch deren Vernetzung mit anderen Lebensformen, wodurch die Lebensform gleichsam neu kontextualisiert und dadurch eben immer auch angepasst und verändert wird. Die Freiheit des Einzelnen besteht eben nicht allein darin, sich seinen Lebensstil nach dem Baukastenprinzip aus verschiedenen Komponenten zusammenzusetzen, sondern vor allem darin, die verschiedenen Lebensbereiche individuell zu gestalten. Solche Freiheit ist zugleich Aufgabe; der Einzelne übernimmt Verantwortung für die Gestaltung seines Lebens – ein Zug, der in WelschsWelsch, Wolfgang Konzept der Transkulturalität merkwürdig unterbelichtet bleibt.
Die individuelle Lebensgestaltung findet allerdings nicht im luftleeren Raum statt, sondern muss sich den jeweiligen historischen und aktuellen Gegebenheiten stellen. Ich kann nicht beschließen, reich zu sein, wenn ich es nicht bin; ebenso wenig kann ich wählen, schwarz zu sein, wenn ich doch weiß bin. Wohl aber kann ich den Umgang mit Wohlstand und Hautfarbe gestalten, ich kann nach Wohlstand streben und ich kann mich für die Gleichberechtigung der Hautfarben einsetzen. Ob ich das tun werde, hängt dabei nicht allein von persönlichen Vorlieben, sondern immer auch von der jeweiligen geschichtlichen und konkreten Situation ab. In den Südstaaten der USA spielt die Hautfarbe eine viel größere Rolle als in Italien; und auch in den USA hat das Thema vor hundertfünfzig Jahren noch eine andere Brisanz gehabt als heute. Das wird Einfluss darauf haben, ob Hautfarbe für den Einzelnen eine Rolle spielt oder nicht. In der Kindererziehung kann man heute nicht einfach frei wählen, sein Heil in der körperlichen Züchtigung zu suchen, und das eben nicht nur deshalb nicht, weil das Gesetz es verbietet, sondern weil die Sittlichkeit dagegen steht. Wenn wir heute sagen, dass ›man Kinder nicht schlägt‹, dann ist dies keinesfalls bloße Traditionsgebundenheit, sondern in erster Linie eine sittliche Errungenschaft, der wir selbst uns verpflichtet fühlen. An diesem einfachen Beispiel wird deutlich, dass wir selbstverständlich Kinder unserer Zeit sind und uns über das geschichtlich gestaltete Lebensumfeld, in dem wir uns bewegen, nicht einfach hinwegsetzen können. Gestalten und verändern können wir es aber, und das auch durch Einführung von Lebensformen anderer Kulturen. Gestaltung der eigenen Kultur freilich ist etwas grundlegend anderes als deren Auflösung.5
Weitere Ungereimtheiten in WelschsWelsch, Wolfgang Ansatz seien hier nur angedeutet. So schließt Welsch aus der Zentriertheit des traditionellen Kulturmodells auf Ausschließlichkeit und Abgrenzung gegenüber anderen Kulturen. Ich will hier keinesfalls ein Kugelmodell der Kulturen verteidigen, aber die Problemlage ist doch sehr viel komplexer, als Welsch sie darstellt. So liegt die besondere Stärke des traditionellen Kulturverständnisses gerade in der integrativen Kraft der auf ein wesenhaftes Zentrum hin ausgerichteten Kultur. Fremdkulturelle Phänomene werden grundsätzlich auf dieses Zentrum bezogen und so in die eigene Kultur integriert. Dabei werden die fremdkulturellen Phänomene natürlich verändert und häufig genug auch einfach als unpassend oder irrelevant verworfen; sie bleiben aber nicht außerhalb der Kultur stehen, sondern werden auf die eine oder andere, zustimmende oder ablehnende Weise aufgenommen. Diese Form der Integration wird den fremdkulturellen Phänomenen häufig nicht gerecht, Vertreter anderer Kulturen fühlen sich missverstanden. Das integrierende Verstehen versteht aber nicht, dass es missversteht. Das Besondere des traditionellen Kulturverständnisses ist gerade diese Form der Universalität, alles, auch das Fremde, in der eigenen Perspektive zu sehen. Konflikte entstehen nicht durch Abgrenzung gegenüber anderen Kulturen, sondern umgekehrt gerade durch den Anspruch, alles, auch fremdkulturelle Phänomene, nach einer einheitlichen Struktur ordnen zu können. Während die Abgrenzung anderen kulturellen Lebensformen ja gerade ihren eigenen Raum belassen würde, führt der Universalitätsanspruch des traditionellen Kulturverständnisses zur Ausgrenzung einer Vielzahl von Lebensformen innerhalb der eigenen Kultur. Das Problem ist nicht so sehr, dass sich eine weiße gegen eine schwarze Kultur abgrenzt, sondern dass die weiße Kultur die schwarze aufnimmt (die schwarze Bevölkerung in den USA hat ihre Wurzeln schließlich im Sklavenhandel), dann aber ausgrenzt. Ähnliches gilt für die innerkulturelle Vielfalt von Lebensformen. Die heterosexuelle Gesellschaft grenzt sich eben keinesfalls einfach gegen eine homosexuelle ab, sondern grenzt diese aus. Für solche Aus- statt Abgrenzung gibt es viele weitere Beispiele. Der Universalanspruch, den jede einzelne Kultur für sich erhebt, macht eine Verständigung zwischen den Kulturen einerseits sehr viel schwieriger; andererseits darf man solchen Universalanspruch nicht vorschnell aufgeben, bildet er doch auch die entscheidende Grundlage für die Möglichkeit, Kritik aneinander zu üben. Gibt man den Universalismus zugunsten eines Relativismus auf, dann verliert man damit die Rechtfertigung, anderen kulturellen Lebensformen kritisch zu begegnen. Das ist sicherlich nicht die Absicht des transkulturellen Kulturverständnisses. Im Gegenteil, die Pluralisierung der Lebensformen soll die gegenseitige Kontrolle und Kritik gerade befördern. Das geht aber eben nur, wenn die universale Geltung bestimmter Rahmenbedingungen vorausgesetzt wird. Diese Rahmenbedingungen liegen in so etwas wie einer liberalen Rechtsstaatlichkeit (s.o.), und die entspringt selber einer »kämpferischen Weltdeutung«. Transkulturalität bleibt eine universalistische Konzeption.
Schließlich sei auf die unklare Rolle hingewiesen, die dem Subjekt in der transkulturellen Konzeption zukommt. WelschWelsch, Wolfgang betont immer wieder, dass es in der transkulturellen Gesellschaft Aufgabe des individuellen Subjekts ist, seine eigene Identität aus einer Vielzahl von Komponenten (gemeint sind verschieden kulturelle Lebensformen) zusammenzustellen. Das suggeriert, dass wir es zunächst mit einem a-kulturellen und damit letztlich a-sozialen Subjekt zu tun haben, das sich im Laufe seines Lebens eine den eigenen Vorlieben entsprechende Identität bastelt. Aber was soll das sein – ein a-kulturelles, gar a-soziales Subjekt? Das reale, leiblich verfasste menschliche Wesen ist jedenfalls schon aus biologischen Gründen immer ein soziales Wesen. Gemeint sein kann deswegen nur ein vorgängiges, ein transzendentales Subjekt; ganz allgemein die Vernunft. Aber woher gewinnt ein solches Subjekt seine Vorlieben? Und wieso unterscheiden sich die Vorlieben dann von Mensch zu Mensch? Das ergibt keinen Sinn. Dass die Konzeption der Transkulturalität dennoch von einem allgemeinen Subjekt ausgeht, sieht man aber daran, dass sie auf der Idee basiert, dass der Einzelne frei ist, global unter allen kulturellen Lebensformen die für ihn passenden auszuwählen. Die Motivation dieser Wahl darf darum natürlich nicht ihrerseits kulturell beeinflusst sein. Darum muss in der transkulturellen Konzeption so etwas wie ein absolutes, d.h. von jeglicher Kultur losgelöstes, a-kulturelles Subjekt angenommen werden. Tatsächlich ist jede Wahl der Lebensform aber abhängig von der konkreten Situation, in der sich der Einzelne befindet; sie ist abhängig von den Lebenserfahrungen, die der Einzelne macht; und sie ist abhängig vom Einfluss anderer, von deren Vorbildcharakter oder auch abschreckendem Beispiel, von deren Erfahrungen und Erzählungen. Es gehört, um nur ein einziges Beispiel zu nennen, zur westlichen Kultur des 21. Jahrhunderts, sich ebenso gut für eine buddhistische wie eine christliche oder auch ganz gegen jegliche Glaubenshaltung entscheiden zu können. Das war nicht immer so und das ist nicht überall so. Und wir stoßen damit auch keinesfalls überall auf Zustimmung. Deswegen aber andere Kulturen als rückständig zu betrachten, entspricht kaum dem auf Diversifizierung bedachten Selbstverständnis der Transkulturalität.