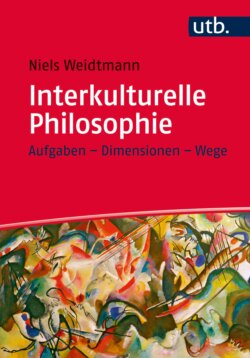Читать книгу Interkulturelle Philosophie - Niels Weidtmann - Страница 13
1.3.1 Ein spielerisches Verständnis von Kultur
ОглавлениеIn der interkulturellen Dimension werden wir auf die Lebendigkeit der Kulturen aufmerksam. Damit wandelt sich auch der Kulturbegriff selbst. Das soll im Folgenden kurz dargestellt werden.1
Kulturen sind keine starren Entitäten, die sich um ein unveränderliches Wesen herum gruppieren. Schon gegen Ende des 17. Jahrhunderts verwendete Samuel von Pufendorf den Begriff der Kultur, um mit ihm die Gesamtheit der Tätigkeiten einer Gesellschaft zu bezeichnen. Die Tätigkeiten des Menschen, also sein Verhalten und seine Handlungen, sind nicht an das Wesen der Kultur gebunden, sondern entspringen der freien Entscheidung des Einzelnen. Und doch sind sie nicht völlig beliebig, sondern beziehen sich auf konkrete Handlungssituationen und sind überdies von Erfahrungen aus ähnlichen Situationen beeinflusst. Nicht in jeder Situation ist jede beliebige Handlung sinnvoll. Grundsätzlich möglich vielleicht schon; da wir mit unseren Handlungen in aller Regel aber etwas erreichen wollen, die Handlungen also an einem Handlungsziel orientiert sind, wählen wir unsere Handlungen so, dass sie auch das gewünschte Ergebnis zeitigen. So gibt die jeweilige Handlungssituation entscheidende Parameter vor, an denen wir uns bei der Ausführung unserer Handlungen orientieren. Das tut sie vor allem dadurch, dass sie unser Handeln in einem Handlungsfeld situiert. Ein solches Handlungsfeld könnte beispielsweise das Fußballspiel sein. In einem Fußballspiel treten viele verschiedene Situationen auf, in denen ganz unterschiedlich gehandelt werden muss. All diese Situationen aber sind durch vorangehende Handlungen auf dem Platz hervorgerufen; die situationsbedingten Handlungen reagieren also auf den Verlauf des Fußballspiels, führen es weiter oder geben ihm eine bestimmte Wendung. Jede Bewegung eines Spielers nimmt die Bewegungen der Mitspieler, die aktuellen ebenso wie die vorangegangenen, auf und bezieht sich auf sie. Offensichtlich wird das beim Lauf und Pass in den freien Raum, die ohne ihren Bezug aufeinander sinnlos wären. Aber auch ganze Spielverläufe haben einen, wenngleich sehr viel schwächer ausgeprägten, inneren Zusammenhang. So lässt das Engagement einer Mannschaft in aller Regel spürbar nach, wenn das Spiel als entschieden wahrgenommen wird. Wer ein Spiel ›lesen‹ kann, hat einen Sinn für diesen inneren Zusammenhang. Handlungen beziehen sich auf Handlungen, sowohl auf vorangegangene wie auf antizipierte. Die jeweilige Handlungskonstellation ist dabei das, was wir Situation nennen. Sie ist es, an der wir uns bei der Ausführung einer Handlung orientieren. Jede Handlung bezieht sich auf eine solche Handlungskonstellation, gleich ob diese einfach oder komplex ist. Nur in dieser Beziehung ist eine Handlung sinnvoll und nur von dieser Beziehung her kann sie verstanden werden. Wir müssen, wenn wir von Handlungen sprechen, also eigentlich immer die Handlungsfelder mitdenken. Freilich ist es nicht so, dass die Handlungsfelder einseitig die Handlungen bestimmen; die Beziehung zwischen Handlungen und Handlungsfeld ist eine wechselseitige. Die eine Ebene macht ohne die andere keinen Sinn. Die Handlungsfelder sind letztlich nichts anderes als die Art und Weise, wie sich die verschiedenen Handlungen aufeinander beziehen; sie werden durch das Zusammenspiel der einzelnen Handlungen überhaupt erst konstituiert. Und doch sind sie ihrerseits entscheidend für die Sinnhaftigkeit der einzelnen Handlung. So bedingen sich Handlungen und Handlungsfelder wechselseitig, weshalb es auch keinen Sinn macht, die Handlungsfelder auf Regeln oder gar so etwas wie ein inneres Wesen reduzieren zu wollen. Was ein Handlungsfeld ist und wie es auf die Ausführung von Handlungen Einfluss nimmt, das wird überhaupt erst im Wechselspiel von Handlungen und Handlungsfeld herausgespielt.
Heinrich RombachRombach, Heinrich hat diese Überlegungen ausgearbeitet.2 Er spricht statt von Handlungsfeldern von den »sozialen Ordnungen« menschlichen Handelns. Das gesamte menschliche Leben spielt sich in sozialen Ordnungen ab. Als Beispiele solcher Ordnungen nennt Rombach Arbeit und Beruf, Wirtschaft, Familie, Verkehr, Sittlichkeit, Sport, Religion, Kunst, Wissenschaft, Sprache und andere. Das Entscheidende ist nun auch für ihn, dass die sozialen Ordnungen die einzelnen Handlungen in einen Zusammenhang stellen, der ihnen ihren spezifischen Sinn verleiht. Erst das Zusammenspiel von transzendentaler Ordnung und empirischen Handlungen eröffnet überhaupt jenen Raum, den wir als ›Handlungsspielraum‹ bezeichnen und in dem sich das gesamte menschliche Leben abspielt. Die einzelnen Ordnungen bleiben wandelbar, ja sie werden in jeder einzelnen Handlung auf bestimmte Weise aufgenommen und weitergeführt. In jeder einzelnen Handlung steht die gesamte zugehörige Ordnung ›auf dem Spiel‹ und erfährt in ihr eine Erneuerung. Im Einzelfall ist das kaum wahrnehmbar, nicht jeder einzelne gespielte Pass revolutioniert das Fußballspiel im Ganzen. Aber auf längere Sicht kommt es zu spürbaren Veränderungen. So stellen die sozialen Ordnungen gleichsam die geschichtliche Dimension aktueller Handlungen dar, womit freilich nicht der bloße Ablauf vorangegangener Handlungen gemeint ist, sondern die Gestaltung bzw. das Herausspielen eines eigenen Sinnfeldes. Die Geschichte der sozialen Ordnungen verläuft denn auch keinesfalls linear, sondern ist durch Phasen relativer Stabilität und Momente größerer Umbrüche gekennzeichnet. Sie verläuft also in Epochen.
Der Weg zu einem Kulturverständnis, das diese Erfahrungsgesättigtheit des sozialen Lebens aufnimmt, führt nun über die Einsicht in die Pluralität sozialer Ordnungen. Das soziale Leben ist nie von einer Ordnung allein bestimmt, sondern zeugt grundsätzlich vom Zusammenspiel mehrerer Ordnungen. Auch das Leben eines Profifußballers lässt sich nicht auf die Ordnung des Sports reduzieren, sondern spielt sich zudem in einer Vielzahl weiterer Ordnungen ab, etwa der Familie, der Wirtschaft, der Religion, der Sprache, der Politik und vielen anderen mehr. Freilich wird die Ordnung des Sports im Leben eines Profisportlers eine größere Rolle spielen, als das bei anderen der Fall ist. Diese besondere Bedeutung der Ordnung des Sports hat Auswirkungen auch auf die anderen Ordnungen, in denen sich der Profisportler bewegt. So wird er die wirtschaftliche Ordnung vermutlich stark von der Bedeutung der Wirtschaft für den Sport her verstehen. Auch sein Blick auf die Politik mag durch sportliche Belange geprägt sein; und den Gedanken sportlicher Fairness überträgt er möglicherweise auf private Beziehungen. Die konkrete Gestalt der verschiedenen Ordnungen wird also von der besonderen Bedeutung, die eine einzelne Ordnung im Leben des Einzelnen erhält, beeinflusst; freilich gehen die anderen Ordnungen deshalb nicht in dieser einen auf. Die Wirtschaftsordnung folgt auch in der Form, in der sie für den Sportler von Bedeutung ist, ihren eigenen, wirtschaftlichen Gesetzmäßigkeiten und nicht etwa denen des Sports. Aber die verschiedenen Ordnungen beeinflussen sich wechselseitig. RombachRombach, Heinrich spricht davon, dass die Ordnungen »Entsprechungen« untereinander ausbilden. Nur so gelingt es dem Einzelnen, die verschiedenen Rollen, die er in den einzelnen sozialen Ordnungen spielt, zu einer zwar vielseitigen und u.U. auch spannungsreichen, aber doch nicht in lauter Einzelteile zerfallenden Person zusammenzubinden. Ähnliches gilt nun auch für größere soziale Lebenskontexte. In einer Gesellschaft bilden sich sehr viele verschiedene und immer wieder auch neue soziale Ordnungen, die die Gesellschaft keinesfalls immer in die gleiche Richtung ziehen. Zwischen den verschiedenen Ordnungen gibt es Spannungen und immer wieder auch Bedeutungsverschiebungen. Während eine Zeit lang die Ordnung der Religion besonders wichtig gewesen sein mag, ist es zu einem anderen Zeitpunkt möglicherweise die Ordnung der Wirtschaft, die stärkeren Einfluss auf die anderen Ordnungen ausübt. Auch das Zusammenspiel der Ordnungen hat eine eigene Geschichte, das heißt die Konstellation der Ordnungen zueinander gestaltet sich immer wieder neu. Im Laufe dieses Zusammenspiels bilden sich wechselnde Entsprechungen aus, die über einen kürzeren oder längeren Zeitraum die Bedeutung der einzelnen Ordnungen in einer Gesellschaft prägen. Dieses Entsprechungsverhältnis der sozialen Ordnungen in der Lebenspraxis einer Gesellschaft bezeichnet Rombach als Kultur. Kultur ist demnach das Zusammenspiel der sozialen Ordnungen in einer Gesellschaft.
Man sieht sogleich, dass dieses Verständnis von Kultur weit von jeder Form des Essentialismus entfernt ist. Kulturen sind überhaupt keine Entitäten, folglich können sie auch nicht nebeneinander stehen, wie es der Konzeption der Interkulturalität von Kritikern fälschlicherweise immer wieder vorgeworfen wird. Kulturen verdanken sich dem Zusammenspiel sozialer Ordnungen; sie stellen so etwas wie die Geschichte dieses Zusammenspiels mit Blick auf die konkrete Lebenspraxis einer Gesellschaft dar.3 Zugleich verdanken sie sich natürlich dem Zusammenspiel der verschiedenen Kulturen in der interkulturellen Dimension. Erst im Zusammenspiel mit anderen Kulturen werden sie sich ihrer eigenen Geschichtlichkeit bewusst.
Ein solches Kulturverständnis widerspricht nun nicht mehr der Wandlungsfähigkeit der Kulturen. Im Gegenteil, was eine Kultur ausmacht, steht letztlich in jeder einzelnen menschlichen Handlung auf dem Spiel. Zudem lernen die Kulturen voneinander und sie beeinflussen sich wechselseitig. Allerdings lassen sich die Kulturen nicht ohne weiteres in Komponenten zerlegen und beliebig mischen, wie dies in der transkulturellen Konzeption angenommen wird. Die sozialen Ordnungen sind ebenso wenig wie die Kulturen eigenständige Entitäten, sondern verdanken sich dem Zusammenspiel von Handlungen. Wenn wir in der westlichen Gesellschaft heute beispielsweise von einer freien Wahl der Religionszugehörigkeit sprechen und diese als Gewinn gegenüber christlich geprägten Traditionen preisen, dann drückt sich darin der Wandel der religiösen Ordnung in unserer Gesellschaft aus; nicht aber stehen in unserer Gesellschaft heute eine Vielzahl verschiedener religiöser Ordnungen, die anderen Kulturen entstammen, einfach nebeneinander. Wenn sich ein Mitteleuropäer dem hinduistischen Glauben anschließt, gehört er deswegen noch nicht der gelebten religiösen Ordnung der indischen Gesellschaft an. Diese hängt nicht allein am hinduistischen Glauben. Das widerspricht nicht der Ausbildung globaler Gemeinsamkeiten. Aber solche Gemeinsamkeiten bilden sich nicht durch Vereinheitlichung aus, auch nicht durch Vermischung, sondern in der Form der Entsprechung. So wie die Wirtschaft nicht im Sport aufgeht, beide Ordnungen aber sehr wohl Entsprechungen untereinander ausbilden können, so gehen auch die verschiedenen Kulturen nicht ineinander auf, sondern bilden Entsprechungen untereinander aus. Kulturen sind Lebensgeschichten. Die lassen sich weiterspinnen und gegebenenfalls zusammenflechten, aber nicht mischen.
Ein letzter Punkt soll an dieser Stelle zumindest angedeutet werden. Nach dem bislang Gesagten sollte klar geworden sein, dass pauschale Bezeichnungen wie ›der Deutsche‹, ›der Marokkaner‹ oder ›der Muslim‹ interkulturell nicht möglich sind. Kulturen sind heterogene Gebilde, ja sie sind nichts anderes als das Gespräch und Zusammenspiel einer Vielzahl verschiedener Lebensbereiche und Lebensformen. Um die interkulturelle Situation richtig zu beschreiben und auf sie antworten zu können, ist aber ein weiterer Aspekt wichtig: Wir müssen dimensionale Unterscheidungen treffen und uns immer darüber klar werden, in welcher Dimension sich eine Fragestellung oder eine kulturelle Begegnung bewegt.4 Mir geht es im vorliegenden Buch um die interkulturelle Dimension. Das ist weniger selbstverständlich, als es klingt, und tatsächlich finden sich auch in der interkulturellen Philosophie zahlreiche Ansätze, die eigentlich auf eine andere Dimension zielen.5 Wenn sich Menschen unterschiedlicher kultureller Herkunft begegnen, dann können sie das in vielen verschiedenen Dimensionen tun. Beispielsweise können sie sich am Postschalter begegnen; dann sind die jeweiligen Rollen, in denen sie sich begegnen, durch die alltägliche und öffentliche Situation der Post bestimmt – der eine ist Schalterbeamter, der andere Kunde. Diese Rollen sind völlig unabhängig davon, welcher kulturellen Herkunft die beiden sind. Oder sie können sich auf einem philosophischen Kongress begegnen, beispielsweise einem KantKant, Immanuel-Kongress. Ganz gleich, wo der Kongress stattfindet, und ganz gleich, welcher Herkunft die beiden Personen sind, stellt nun die kantische Philosophie den Rahmen bzw. den Boden ihrer Begegnung dar. Sie begegnen sich als Kantforscherinnen. Sie können sich nun aber auch so begegnen, dass ihre kulturelle Herkunft in dieser Begegnung eine Rolle spielt. Beispielsweise können sich eine Muslima und eine Christin begegnen und über den Religionsunterricht an deutschen Schulen diskutieren. In diesem Fall können die verschiedenen religiösen Überzeugungen der beiden, die sie möglicherweise aufgrund ihrer unterschiedlichen kulturellen Herkunft gewonnen haben, für die Begegnung wichtig sein. Auch in diesem Fall gibt es aber einen gemeinsamen Boden, auf dem die Begegnung stattfindet, etwa die Schulgesetzgebung des betreffenden Bundeslandes oder die Religionsfreiheit, die in Deutschland gewährleistet wird. In dieser Dimension der Begegnung ist es übrigens sehr wohl auch möglich, dass die Muslima deutscher, die Christin aber nicht-deutscher Herkunft ist; ebenso können die beiden ihre religiösen Überzeugungen ändern – der Einzelne ist nicht an seine kulturelle Herkunft gefesselt. Bei der Diskussion der Multikulturalität haben wir gesehen, dass ein Zusammenkommen ganz verschiedener religiöser Überzeugungen und kultureller Lebensformen auf dem Boden eines freiheitlichen Verfassungsstaates gut möglich ist. Wir haben aber auch gesehen, dass diese Pluralität nur auf dem Boden eines solch freiheitlichen Verfassungsstaates möglich ist.
In der interkulturellen Dimension geht es nun aber gerade um die Begegnung von Kulturen; um beim Beispiel zu bleiben: In der interkulturellen Dimension begegnen sich die Menschen so, dass in ihrer Begegnung die jeweiligen Kulturen gemeint sind. Es geht in dieser Begegnung nicht um religiöse Überzeugungen und kulturelle Lebensformen, sondern um die geschichtlich gestalteten Lebenswirklichkeiten der Menschheit. Eine solche Begegnung kann auf keinem Boden stattfinden, müsste der doch dies- oder jenseits aller Kulturalität und damit außerhalb aller menschlichen Lebenswirklichkeit liegen. Das weist erneut darauf hin, dass die Kulturen durch nichts getrennt sind. Und doch lösen sie sich nicht in einer gemeinsamen Identität auf. Sie sind alle wirklich, aber so, dass die Wirklichkeit in jeder einzelnen Kultur im Ganzen verwirklicht ist. Die Kulturen teilen sich die Wirklichkeit nicht untereinander auf, sondern die Wirklichkeit kommt in jeder einzelnen Kultur voll zur Entfaltung, wenn auch auf besondere Weise. Das heißt auch, dass in jeder Kultur alle anderen Kulturen auf diese Weise mit aufgenommen sind bzw. fortlaufend mit aufgenommen werden. Dies einzusehen und die Autonomie und die Verantwortlichkeit der Kulturen, die daraus folgen, aufzuzeigen, ist die Aufgabe interkultureller Philosophie. In diesem Sinne ist die Begegnung in der interkulturellen Dimension übrigens bislang einzig von NishitaniNishitani, Keiji und RombachRombach, Heinrich beschrieben worden, sie ist aber bislang für keine einzelne philosophische Tradition prägend geworden.6 Das zeigt, dass die interkulturelle Philosophie selbst interkulturell arbeitet.