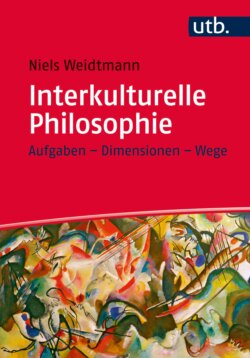Читать книгу Interkulturelle Philosophie - Niels Weidtmann - Страница 12
1.3 Interkulturalität
ОглавлениеDer Begriff der Interkulturalität bezieht sich auf jenes ›Zwischen‹ von Kulturen, das in der Begegnung und im Austausch der Kulturen sichtbar wird. Interkulturell werden die Kulturen grundsätzlich von diesem Zwischen her verstanden, das jenseits der Kulturen liegt und diese deshalb zu einer Orientierung über ihr Eigenes hinaus bewegt. Interkulturalität betont darum von Beginn an die innere Dynamik, die allen Kulturen zueigen ist und die sich nirgendwo so deutlich erweist wie im Kontakt zu anderen Kulturen. Dieser Kontakt ist es, der Kulturen lebendig erhält: die Kritik aneinander ebenso wie das Lernen voneinander. Interkulturalität zielt deshalb nicht primär auf ein Modell für das Verstehen anderer Kulturen, sondern versucht demgegenüber, auf die Selbstverantwortung und die Lebendigkeit von Kulturen aufmerksam zu machen, die jedes von außen herangetragene Modell irgendwann sprengen müssen.
Einen Austausch zwischen Kulturen gab es vermutlich immer, mal friedlicher, häufiger weniger friedlicher Natur. In vielen Fällen hat solcher Austausch die Entstehung von neuem befördert und den Wandel der Kulturen begünstigt. Dabei ist ein solcher Austausch auch über Epochengrenzen hinweg möglich, wie etwa in der islamischen Welt, als zwischen dem 9. und 12. Jahrhundert ein großer Teil der verfügbaren griechischen Literatur ins Arabische übersetzt wurde und die Entwicklung der arabischen Wissenschaften und eines arabisch-islamischen Staatswesens nachhaltig beeinflusst hat. Umgekehrt gilt, dass sich eine Kultur, die von der Außenwelt abgeschnitten ohne irgendwelche externen Einflüsse lebt, sehr viel schwerer tut, Gewohntes in Frage zu stellen und Neues auszuprobieren. Faktisch kennen wir solch annähernde Isolation nur von wenigen sehr kleinen Naturvölkern, bei denen der Druck zu Veränderung schon wegen der geringen Größe und dem darum vergleichsweise stabilen, wenn auch kargen Ressourcenangebot niedrig ist. Freilich gibt es selbst hier Austausch zwischen benachbarten Gruppen. Kulturen leben vom Austausch. Das Zwischen ist lebensnotwendig, es ist konstitutiv für die stetige Erneuerung und damit das Fortbestehen von Kulturen.
Das am häufigsten gegen den Begriff der Interkulturalität vorgebrachte Argument zielt darauf ab, dass die Rede von einer Inter-Kulturalität voneinander getrennte, für sich existierende Kulturen voraussetze; andernfalls mache es keinen Sinn, von so etwas wie einem Zwischen zu sprechen.1 Die Voraussetzung voneinander getrennter, für sich existierender Kulturen aber berge die Gefahr, Kulturen zu essentialisieren, d.h. ihnen ein unveränderbares Wesen zuzuschreiben, das sie von anderen Kulturen radikal unterscheidet. Ein solches Kulturverständnis erlaube keinerlei Wandel und leugne zudem letztlich die Möglichkeit einer Verständigung zwischen den Kulturen. Tatsächlich ist dieser Kritik darin zuzustimmen, dass ein essentialistisches Kulturverständnis weit an der Realität vorbeigeht. Kulturen verändern sich und nehmen Einflüsse von außen auf; auch kann der Einzelne in eine andere Kultur eintauchen und diese kann zu seiner eigenen werden. Falsch ist dagegen die Annahme, Interkulturalität setze klar voneinander getrennte, kugelartig abgeschlossene Kulturen voraus. Im Gegenteil, der Begriff der Interkulturalität macht gerade darauf aufmerksam, dass die Kulturalität einer Kultur nur vom Zwischen her zu verstehen ist. Eine Kultur hängt konstitutiv am Zwischen und dem Austausch mit anderen Kulturen, für die eben dasselbe gilt. So ist das Zwischen der eigentliche Lebensquell der Kulturen; damit ist auch klar, dass eine Kultur niemals zu so etwas wie der Verwirklichung ihrer selbst gelangt, kann dieses Selbst doch immer bloß eine Momentaufnahme der Auseinandersetzung mit jenem Zwischen sein und ist damit also selber stetigem Wandel unterworfen. Das Aufmerken auf die interkulturelle Dimension eröffnet uns deshalb ein ganz neues und tieferes Verständnis von Kultur: Nicht nur verändert sich jede Kultur über die Zeit, vielmehr ist sie ihrem Wesen nach Veränderung, Wandel und Austausch. Sie ist, um es in der Begrifflichkeit von LévinasLévinas, Emmanuel auszudrücken, die WaldenfelsWaldenfels, Bernhard für interkulturelle Fragestellungen fruchtbar gemacht hat, zu keinem Zeitpunkt mehr als der Versuch einer »Antwort« auf den aus dem Zwischen der Kulturen kommenden »Anspruch«.2 Der Anspruch selbst entzieht sich der Kultur grundsätzlich, und so entzieht sich ihr auch die Richtung ihrer eigenen Entwicklung – und damit das, was man vormals das Wesen genannt hat. Interkulturell verstanden sind die Kulturen also keinesfalls als absolut differente Wesen voneinander getrennt. Ein solches Verständnis greift viel zu kurz, es verdinglicht die Kulturen und versteht die Pluralität der Kulturen als ein Nebeneinander voneinander getrennter Entitäten. Ein solches Nebeneinander freilich setzt immer schon so etwas wie einen gemeinsamen Raum voraus. So entpuppt sich der Relativismus, der interkulturellem Denken gelegentlich vorgeworfen wird, als bloße Kehrseite jenes Universalismus, in dessen Namen der Vorwurf erhoben wird. In Wirklichkeit ist die Sachlage viel spannender: Die andere Kultur ist von der eigenen nicht durch einzelne Errungenschaften, Gewohnheiten oder Überzeugungen unterschieden; dafür wäre ein gemeinsamer Vergleichsrahmen notwendig. Die andere Kultur ist gar nichts anderes als die eigene Kultur, sie ist dasselbe – nur anders. Sie ist dasselbe anders und entzieht sich deshalb jedem denkbaren Vergleich. Die Erfahrung des Fremden, darauf macht Waldenfels aufmerksam, ist die der Anwesenheit des Abwesenden. Die andere Kultur zeigt sich als sich entziehende. Der Widerspruch, der darin liegt, lässt sich nur dadurch auflösen, dass man das verdinglichende Verständnis von Kulturen aufgibt und schon die eigene Kultur als lebendig, d.h. als sich stetig erneuernd und über sich hinausstrebend verstehen lernt. ›Dasselbe‹, das eine andere Kultur auf andere Weise ist, ist dann kein ›Etwas‹, sondern lediglich das Zwischen der Kulturen, aus dem heraus sich alle Kulturen gleichermaßen konstituieren.
Diese Betonung der Prozeduralität und grundsätzlichen Unabgeschlossenheit von Kulturen spiegelt sich in den methodischen Ansätzen interkultureller Philosophie wider. KimmerleKimmerle, Heinz versteht Interkulturalität dialogisch, wobei im Dialog keine Informationen ausgetauscht, sondern Zwischenräume ausgelotet werden.3 Das Hören-können geht dem Verstehen-können voraus. WimmerWimmer, Franz M. erweitert den Dialog zum »Polylog« und macht damit darauf aufmerksam, dass der Austausch zwischen Kulturen auf mehreren Ebenen und zwischen mehreren Kulturen zugleich verläuft.4 Entscheidend ist dabei freilich immer, dass die konstitutive Dimension des Austausches gesehen wird: Die Kulturen gehen aus dem Polylog verändert hervor, ja sie werden darin erst zu dem, was sie eigentlich sind – nämlich nicht dies oder das, sondern Selbstgestaltungen der menschlichen Lebenswirklichkeit.
Das Zwischen, das die Kulturen trennt, ist selbst nichts anderes als ihr Bezogensein aufeinander. Das Zwischen spannt keinen eigenen Raum aus, es hat kein eigenes Sein. Damit macht gerade das Zwischen darauf aufmerksam, dass die Kulturen durch nichts getrennt sind. Sie sind dasselbe, nämlich die jeweils andere Kultur, dies aber auf ihre je eigene Weise. Die Kulturen stehen interkulturell verstanden also nicht neben- oder gar gegeneinander und lassen sich darum auch einem multi- oder transkulturellen Paradigma grundsätzlich nicht einfügen. Interkulturell verstanden sind die Kulturen keine unterschiedlichen Interpretationen und Gestaltungen von Welt, die man gegebenenfalls miteinander vermitteln könnte, sondern Interpretationen und Gestaltungen der anderen Kulturen; die freilich ihrerseits auch nichts anderes sind, so dass jede einzelne Kultur den gelebten Versuch darstellt, Kultur überhaupt zu gestalten. In jeder einzelnen Kultur stehen alle Kulturen zugleich auf dem Spiel – und mit ihnen die Menschheit und die Menschlichkeit im Ganzen. In der interkulturellen Begegnung geht es deshalb zunächst weniger um Verstehen und Anerkennung als dem zuvor um wechselseitige Kritik und den Versuch, das, was in den Kulturen auf dem Spiel steht, in keiner einzigen scheitern zu lassen.
An dieser Stelle werden die Arbeiten von StengerStenger, Georg wichtig, der darauf aufmerksam macht, dass der Gedanke einer Konstitution der Kulturen aus dem Zwischen nur dann konsequent ist, wenn die Welthaltigkeit dieses Konstitutionsprozesses gesehen wird.5 Versteht man die Geburt bzw. Erneuerung einer Kultur aus dem Zwischen lediglich im Sinne der Konstitution eines umfassenden Horizontes, in dem Welt erscheint, dann wird das, was sich in den verschiedenen Kulturen je anders zeigt bzw. in ihnen je anders realisiert ist, als allen Kulturen gemeinsame Welt aufgefasst. Damit fällt der Gedanke zurück auf das Nebeneinander verschiedener Entitäten, die sich innerhalb einer gemeinsamen Welt durch ihre jeweilige Interpretation dieser Welt voneinander unterscheiden. Unter der Hand wird der Kulturbegriff damit wieder substanzialisiert und man bewegt sich wieder im Spannungsfeld von Universalismus und Relativismus. Welt, so Stenger, gibt es nicht jenseits der kulturellen Verständigung über sie. Welt ist selbst jener Verstehenszusammenhang, der jeweilig kulturell-historisch ausgebildet wird. Interkulturalität wird zu »Intermundaneität«.6 Allerdings muss man auch hier wieder aufpassen: Versteht man Stengers Analyse der Interkulturalität als einer Begegnung von Welten in dem Sinne, dass hier voneinander getrennte, für sich existierende Welten aufeinander stießen, ist nichts gewonnen. Der Hinweis auf den Weltcharakter von Kulturen erinnert dagegen gerade daran, dass im interkulturellen Austausch kein Allgemeines verhandelt, sondern die Wirklichkeit der Kulturen gestiftet wird. Aufgabe einer interkulturellen Philosophie ist es, diese Bedeutung der interkulturellen Dimension offen zu legen. Die Philosophie gewinnt damit eine genuin praktische Bedeutung. Damit wird auch deutlich, dass die interkulturelle Dimension die Philosophie im Ganzen betrifft und herausfordert, dass interkulturelle Philosophie also nicht lediglich ein Teilgebiet der Philosophie ist.