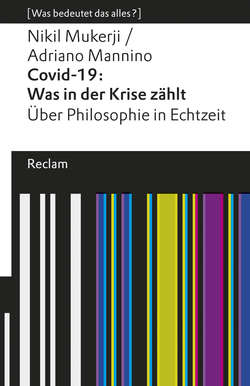Читать книгу Covid-19: Was in der Krise zählt. Über Philosophie in Echtzeit - Nikil Mukerji - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Praxis hat Vorrang
ОглавлениеDie Natur unserer Fragestellung – es geht uns um Entscheidungsprobleme, wie sie im Kontext der drohenden oder laufenden Katastrophe auftreten – gibt die epistemischen Normen vor, die für unsere Untersuchung leitend sind. Die Fragestellung bestimmt, welche Art des Schlussfolgerns zulässig ist und welche nicht. Sie definiert, was als epistemische Tugend gelten kann und was als Fehlleistung der Urteilskraft zu kritisieren ist. Um dies zu konkretisieren, ein Beispiel:
Nehmen wir an, vor uns steht eine Schale mit Münzen. Die eine Hälfte der Münzen ist normal bzw. fair, die andere Hälfte gezinkt (fällt also häufiger auf die Kopfseite). Wir nehmen eine Münze aus dem Haufen heraus, werfen sie einige Male und notieren das Ergebnis. Weil wir in Statistik aufgepasst haben, können wir berechnen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Münze häufiger auf die Kopfseite fällt und damit gezinkt ist, bei 70 % liegt. Dürfen wir daraus schließen, dass die Münze tatsächlich gezinkt ist?
Unter Normalbedingungen lassen das die gängigen Normen der wissenschaftlichen Praxis nicht zu. Eine Hypothese sollte erst dann angenommen werden, wenn – vereinfacht gesagt – die Daten, die sie stützen, mit einer Wahrscheinlichkeit von 5 % oder weniger durch Zufall erklärt werden können.
Unter Normalbedingungen ergibt dieser institutionalisierte Zweifel Sinn – auch wenn die 5 %-Schwelle natürlich zu einem gewissen Grad beliebig ist. Eine derart strenge Skepsis ist aber nicht in jeder Situation vernünftig. Stellen wir uns vor, ein Milliardär tritt auf den Plan und macht uns das folgende Angebot: Wenn wir zutreffend einschätzen können, ob unsere Münze fair oder gezinkt ist, dann zahlt er uns eine Million. Wie sollten wir uns verhalten?
Sich hier herauszuhalten bzw. agnostisch zu zeigen, wäre hochgradig irrational. Wir wissen ja aus unserer Versuchsreihe, dass die Münze mit einer Wahrscheinlichkeit von 70 % gezinkt ist. Also sollten wir darauf wetten, obwohl eine Restwahrscheinlichkeit von weit mehr als 5 % besteht, dass wir uns irren, wenn wir auf »gezinkt« tippen. Die erwarteten Konsequenzen dieser Entscheidung sind schließlich viel besser als jene der Alternative. Auch eine Wette auf »fair« wäre besser, als gar nicht zu tippen, um wissenschaftlich agnostisch zu bleiben.3
Dieses Beispiel zeigt, dass bestimmte Grundsätze der wissenschaftlichen Überzeugungsbildung, die unter Normalbedingungen vernünftig sind, mit Prinzipien der praktischen Rationalität in Konflikt geraten können.4 Das gilt umso mehr, wenn philosophische Fragen eine kurze Deadline haben und in Echtzeit beantwortet werden müssen, um etwa Katastrophenszenarien abzuwenden.
Übertragen wir das auf uns: Aus wissenschaftlicher Sicht können wir viele Fragen, die Covid-19 betreffen, noch nicht zufriedenstellend beantworten. Daraus folgt aber nicht, dass wir praktische Fragen noch nicht klar oder dass wir sie deshalb überhaupt nicht beantworten können. Wie der Harvard-Epidemiologe Marc Lipsitch unterstreicht, wissen wir inzwischen für viele praktische Zwecke genug – wir wissen genug, um beherzte Entscheidungen zu treffen. In diesem Essay wollen wir der Frage nachgehen, welche Entscheidungen das gegenwärtig – Anfang April 2020 – sind.