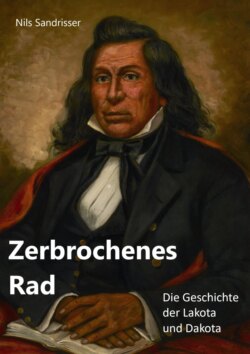Читать книгу Zerbrochenes Rad - Nils Sandrisser - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Vertrag am Horse Creek
ОглавлениеNach allgemeiner Auffassung während des ersten Drittels des 19. Jahrhunderts waren die Gebiete westlich des Mississippi für die Besiedlung durch Weiße ungeeignet. Zebulon Pike etwa war bei seinen Expeditionen zu dem Schluss gekommen, dass „diese große amerikanische Wüste auf ewig für zivile Erschließung unbrauchbar“ sei und hatte geunkt, sie würde „allein Reservat für Bison-, Mustang- und Antilopenherden, für Wölfe, Kojoten, Berglöwen, Jaguare, Klapperschlangen und Skorpione und für nackte Wilde bleiben“. Selbst das Wetter bestehe „aus einer Kette von ununterbrochenen Katastrophen“.1
Diese Vorstellung legte eine – wie man damals glaubte – elegante Lösung des „Indianerproblems“ nahe. Ende Mai 1930 unterzeichnete US-Präsident Andrew Jackson den „Indian Removal Act“. Dieses Gesetz legte die Grundlage dafür, den Mississippi zur „ewigen Indianergrenze“ zu erklären, mit Ausnahme der Staaten Missouri und Louisiana und des Territoriums Arkansas, wo bereits viele Weiße lebten.2 Alle Indianer östlich des Stroms wurden somit ausreisepflichtig, wie es heute im Behördendeutsch heißen würde. Die meisten von ihnen deportierte man ins „Indianer-Territorium“, das heutige Oklahoma, was mit hohen Verlusten an Menschenleben verbunden war, weil die USA weder für die Deportation noch für die Aufnahme so vieler Menschen dort ausreichende Vorbereitungen getroffen hatten. An Hunger, Kälte, Krankheiten und Strapazen starben zum Beispiel mehr als ein Viertel der Cherokee, die man auf dem „Pfad der Tränen“ von Georgia nach Oklahoma schaffte.3
Kaum allerdings war das Gesetz in Kraft getreten, hatten Siedler schon das Territorium Wisconsin gegründet, das teilweise westlich des Mississippi lag. Die Mdewakanton und die Wahpekute waren somit zu direkten Nachbarn der USA geworden.4 Auch die anderen Dakota, die Lakota und weitere Indianervölker sollten bald häufiger Kontakt mit US-Amerikanern haben. Denn natürlich war im Osten bekannt, dass die angebliche „große amerikanische Wüste“ wieder freundlicher wurde, sobald man die Rocky Mountains überquert hatte. Schon Lewis und Clark hatten von der Fruchtbarkeit Oregons berichtet.5 Erzählungen gingen um von der „unerschöpflichen schwarzen Erde Oregons“ und von Kalifornien als einem Land ohne Krankheiten, wo es angeblich nie schneie.6
Um 1840 zogen Aussiedler in langen Planwagentrecks, wie man sie aus den Westernfilmen kennt, durch die Prärien und über die Rocky Mountains nach Westen. Eine tiefe Wirtschaftskrise seit 1837 und steigende Bodenpreise ab Beginn der 1840er Jahre trieben die Emigranten aus dem Osten fort, um im Westen ihr Glück zu suchen. Ein Teil der Auswanderer bestand aus Mormonen, die aus religiösen Gründen gingen, um weit im Westen ihr Jerusalem zu errichten. Wegen des Goldrauschs in Kalifornien ab 1848 wurde dann der stete Fluss der Trecks zum Strom.7
Dass Kalifornien mexikanisch regiert und Oregon britisch beansprucht war, interessierte die Auswanderer wenig. Zu jener Zeit gewann die Idee der Manifest Destiny an Beachtung, die Idee einer „offensichtlichen Bestimmung“ der Vereinigten Staaten, den nordamerikanischen Kontinent zwischen dem Atlantik und dem Pazifik zu beherrschen und zu zivilisieren. Unter „zivilisieren“ verstand man – ganz zeittypisch und auch nicht anders als europäische Kolonialmächte –, ihn nach den Vorstellungen der weißen US-Amerikaner zu formen. Die Vorstellungen der roten und schwarzen Bewohner des Erdteils sowie die anderer Staaten spielten keine Rolle. Die Eingeborenen hatten sich der Lebensweise der neuen Herren anzupassen und durften froh sein über die Segnungen der Zivilisation, die ihnen zuteil wurden. Auch wenn die Manifest Destiny nie offizielle Staatsdoktrin war und viele US-Präsidenten sie explizit ablehnten, teilten viele Bürger diese Idee.8
Der Oregon Trail, auch Holy Road genannt, begann in Kansas und durchquerte entlang des Platte River die Wohn- und Streifgebiete der Brulé- und Oglala-Teton. Nach der kontinentalen Wasserscheide im heutigen Wyoming folgte er dem Snake River nach Oregon.9 Um den Trail zu schützen, etablierte die US-Armee 1848 und 1849 am Platte River Forts: In Nebraska gründete sie Fort Kearney, in Wyoming wandelte sie den Handelsposten Fort Laramie in einen Militärstützpunkt um.10 Obwohl die Aussiedler das Land nur durchzogen und sich dort nicht niederließen, bekamen die Völker dieser Region sofort die Auswirkung dieser Wanderung zu spüren: Ihr Essen wurde knapp. Wo immer Menschen vermehrt auftraten, machte sich das scheue Wild rar. Die Bison- und Gabelbock-Herden verschwanden innerhalb kurzer Zeit aus der Region am Platte River, was diese Gegend für Nomaden unbewohnbar machte.11 Die unwirtliche Zone entlang des Platte trennte die Cheyenne und die Arapaho in je eine nördliche und eine südliche Stammesgruppe.12
Die Indianer waren über die Auswanderer natürlich nicht erbaut. Regelmäßig suchten sie die Trecks auf und forderten Pferde oder Rinder als Kompensation für das verschwundene Wild, was die Siedler oft als Bettelei interpretierten.13 Erhielten sie keinen Wegzoll, nahmen sich Krieger einfach Pferde und Maultiere, seltener Zugochsen oder metallenes Kochgeschirr. Vereinzelt überfielen sie Trecks, es gab dabei auch Tote. Die Unruhe unter den Ureinwohnern war so groß, dass die USA im Jahr 1845 größere Militärverbände an den Platte River entsandten. Einen Zusammenstoß mit Soldaten wollten die Indianer nicht riskieren. Die Trecks konnten fortan weitgehend ungehindert passieren.14
Ein Großteil der Lakota, Cheyenne und Arapaho fand es weise, den Weißen aus dem Weg zu gehen, und zogen ins Land am Powder River, das heute den Nordosten Wyomings und den Südosten Montanas einnimmt, wo es noch so viel Wild gab, dass das Nomadenleben möglich war. Das führte zu Kämpfen mit den Crow, die dieses Territorium bis dahin kontrolliert hatten.15 Nicht alle Indianer entschieden sich jedoch dafür, den Weißen auszuweichen. Manche wählten sogar als Überlebensstrategie, sich in deren Nachbarschaft niederzulassen, in der Nähe der Forts und Handelspunkte am Oregon Trail. Dort lebten sie von Rationen, die sie von den Weißen bekamen, denen sie ansonsten als Bettler, Trinker, Diebe und Zuhälter ihrer Frauen und Töchter unangenehm auffielen. Die Weißen nannten diese Ureinwohner „Rationsindianer“ oder „Kaffeekühler“ – letztere Bezeichnung macht deutlich, dass viele die Existenz dieser Menschen bestenfalls als unnötig ansahen.16 Ganz nutzlos allerdings waren sie für die Euroamerikaner nicht, denn sie fädelten oft Geschäfte zwischen ihnen und den frei umherziehenden Indianerverbänden ein, die Felle abzugeben hatten. Die Kommandanten der US-Garnisonen griffen gern auf Dienste der Rationsindianer zurück, wenn sie Kontakt zu jenen Verbänden aufnehmen wollten.17
Zwischen Rations- und traditionell lebenden Indianern freilich gab es jede Menge Zwischenstufen. Viele Gruppen kamen im Winter, wenn Nahrung und Futtergras knapp waren, zu den Forts und Agenturen und ließen sich von den Weißen versorgen, um den Sommer in ihren Jagdgebieten zu verbringen. Die Zahl dieser Pendler nahm ebenso wie die der Rationsindianer im Laufe der Jahre deutlich zu.18
Mit den weißen Aussiedlern kamen Krankheitswellen. Die allerdings waren kein neues Phänomen, auch nicht auf den Great Plains, wie die Pockenepidemie zeigt, die um 1780 die Shoshone und Arikara so dezimiert hatte.19 Sie waren eher Dauererscheinung. Diese Epidemie hatte ihren Ausgang in Mexiko genommen und sich über den gesamten Kontinent verbreitet. Impfungen gab es schon im 18. Jahrhundert, und viele europäische Kolonialmächte sorgten dafür, ihre indigene Bevölkerung zu immunisieren. Die USA allerdings taten das erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts, allerdings nicht besonders erfolgreich, was einerseits an technischen Problemen lag, andererseits am Misstrauen vieler Ureinwohner gegen die Impfungen.20
Um die Wende zum 19. Jahrhundert waren auch die Lakota und Dakota von den Pocken erfasst worden, die schwer unter den Omaha, Ponca und Pawnee gewütet und sich über die Assiniboine und Blackfeet bis an die nordwestliche Pazifikküste ausgebreitet hatten.21 In den Jahren 1810 und 1811 waren die Pocken wiedergekommen und hatten diesmal besonders unter den Völkern der sieben Ratsfeuer viele Leben gefordert, zwei Jahre danach hatten die Lakota und Dakota unter Keuchhusten gelitten.22 Im Jahr 1818 oder 1819 war unter ihnen eine Krankheit ausgebrochen, von der die Forschung sich unsicher ist, ob es Pocken oder Masern waren.23
Mit dem Anschwellen der Auswandererwelle nahmen die Krankheiten zu, und neue traten auf. Eine besonders verheerende Pockenepidemie traf 1837 die Völker am Missouri.24 Von den damals rund 1.600 Mandan – die einstmals, ehe die Seuchen kamen, 15.000 Köpfe gezählt haben sollen – überlebten nur 150.24 Mit den Goldsuchern, die nach Kalifornien wollten, kam 1849 die Cholera.25 Mit den Goldsuchern, die nach Kalifornien wollten, kam 1849 die Cholera.26 Sie tötete 2.000 Cheyenne, die Hälfte der Menschen dieses Volks. Auch die Arapaho und die Pawnee litten schwer darunter.27
Häufig findet man die Auffassung, dass die Indianer absichtlich mit Krankheitserregern infiziert worden seien, die Seuchen seien also eine Art biologischer Kriegsführung gewesen. Auch Indianer selbst äußerten wiederholt diesen Verdacht. Zwar gab es in der Tat Überlegungen der Briten während der Kolonialzeit, Krankheitserreger als Waffen einzusetzen, aber tatsächlich aber ist nur ein einziger Fall sicher belegt – ein britischer Offizier hatte 1763 im heutigen Pittsburgh Waren an Indianer ausgeben lassen, die in Decken eingewickelt waren, die aus einem Blatternhospital stammten.28 Ob dieser Versuch aber tatsächlich eine Epidemie auslöste, ist unbekannt. Von einem systematischen Infizieren kann man daher nicht sprechen. Überdies wäre das Auslösen einer Seuche wahnwitzig gewesen, denn Weiße litten genauso an Krankheiten wie die Indianer, auch wenn bei Letzteren die Infektionen tödlicher waren. Auf dem Oregon Trail wütete die Cholera unter weißen Auswanderern ebenso wie unter den Eingeborenen. Oft genug begannen die Seuchen auch in weit entfernten Gebieten wie in Mexiko oder dem russisch beherrschten Alaska, was ein absichtliches Infizieren gänzlich unplausibel macht, weil man sich dort nicht um Probleme scherte, die britische Kolonien oder die USA mit Ureinwohnern hatten.29
Die Cholera löste blankes Entsetzen aus, weil sie mit sehr plötzlich mit starken Durchfällen und Erbrechen beginnt – so stark, dass der Körper innerhalb kurzer Zeit viel Wasser und Elektrolyte verliert. Krämpfe und Herzrhythmusstörungen sind die Folge. Unbehandelt führt sie oft schnell zum Tod.30 Wo immer sie ausbrach, packten die Indianer ihren Hausrat zusammen und machten, dass sie wegkamen. Oft genug hatten sie sich da aber bereits angesteckt und trugen die Seuche weiter.31 Vom Cheyenne-Krieger Little Old Man berichtet George B. Grinnel, dass er, in vollem Kriegsornat, hoch zu Ross und seine Lanze schwingend durch sein Dorf ritt, das die Cholera hart erwischt hatte, und dabei schrie, er würde gegen die Krankheit kämpfen, wenn er sie sehen würde. Noch während er schrie, fiel er vom Pferd und starb.32
Manche Cheyenne und Lakota beließen es nicht beim Schattenboxen. Sie machten die weißen Aussiedler für das große Sterben verantwortlich und begannen erneut mit Überfällen auf die Trecks.33 Offener Krieg lag in der Luft. Vor allem die Cheyenne, Arapaho, Lakota und Shoshone wären in der Lage gewesen, den Oregon Trail komplett zu blockieren, hätten sie ihre Überfälle noch intensiviert. Alternative Routen waren für die Siedler unattraktiv: Bei der Passage der Panama-Landenge drohte das Gelbfieber, und der Seeweg rund um das stürmische Kap Hoorn dauerte drei bis vier Monate, zudem sanken dabei viele Schiffe.34 Die USA hatten also ein vitales Interesse daran, den Oregon Trail zu befrieden, zumal sie das Oregon-Gebiet 1846 und Kalifornien 1848 annektiert hatten.35
Diesmal versuchten es die USA nicht mit Machtdemonstrationen, sondern mit Verhandlungen. Für den Spätsommer 1851 luden sie die Indianer zu Gesprächen bei Fort Laramie ein. Die Lakota, Cheyenne, Arapaho, Crow, Assiniboine, Gros Ventre, Mandan und Arikara kamen und machten das Treffen zu einer der größten Versammlungen von Prärieindianern in der Geschichte. Beinahe wären die Verhandlungen gescheitert, noch ehe sie begonnen hatten, weil man den Indianern Geschenke und Lebensmittel versprochen hatte, aber der Wagenzug, der diese Geschenke brachte, Verspätung hatte. Inzwischen hatten die Herden das Gras rings um das Fort abgefressen, bei einigen Pferden zeigten sich bereits die Rippen. Außerdem gab es in der Gegend kaum noch jagbares Wild. Um zu verhindern, dass die Ureinwohner vorzeitig abzogen, verlegte man das Treffen um 60 Kilometer den Platte abwärts an die Mündung des Horse Creek.36
Hier unterzeichneten die Vertreter der Prärievölker am 17. September 1851 ein Papier, das als Vertrag von Fort Laramie oder Horse-Creek-Vertrag bekannt wurde. Sie räumten – reichlich arglos – den USA das Recht ein, in ihren Gebieten Straßen und Militärposten einzurichten.37 Sie sollten Oberhäuptlinge wählen, die für ihr jeweiliges Volk sprechen konnten.38 Außerdem verpflichteten sie sich dazu, den permanenten Krieg zwischen den Völkern einzustellen und fortan in Frieden miteinander zu leben.39 Der Vertrag legte die Grenzen der Gebiete fest, die künftig den jeweiligen Völkern und Stämmen gehören sollten.40 Im Gegenzug sagten die USA zu, den Indianern zehn Jahre lang Waren im Wert von jährlich 5.000 Dollar zu liefern.41 Allerdings schränkten sie dieses Zugeständnis dadurch ein, dass sie sich in den Vertrag das Recht hineinschrieben, die Lieferungen ganz oder teilweise einzubehalten, wenn sie der Meinung waren, dass die Ureinwohner gegen den Vertrag verstoßen hätten.42
Ein ähnlicher Vertrag, der Vertrag von Fort Atkinson, sollte 1853 das Verhältnis der USA zu den Völkern der südlichen Great Plains entspannen, vor allem das zu den Kiowa und Comanche, die auf dem Santa-Fé-Trail ein ähnlicher Unsicherheitsfaktor waren wie die Lakota, Cheyenne und Arapaho auf dem Oregon Trail.43
Natürlich hatte der Horse-Creek-Vertrag eine ganze Reihe von Schwächen. Es ist mehr als zweifelhaft, ob die indianischen Vertreter den Inhalt des Vertrags in seiner ganzen Tragweite überhaupt verstanden. Mit Sicherheit war ihnen nicht bewusst, dass sie mit dem Papier im Prinzip Reservationen akzeptiert hatten. Für die künftige Reservationspolitik der US-Regierung war dieser Artikel aber ganz entscheidend. Diese Räume, die den jeweiligen Völkern zugeordnet wurden, waren zwar groß und ermöglichten das Leben als großwildjagende Pferdenomaden, schrumpften in den Folgejahren aber. Das Wort „territories“ im Vertrag war nur ein Synonym für Reservat.44
Weil die Indianer keinen politischen Mechanismus hatten, Oberhäuptlinge zu wählen, wie es der Kontrakt vorsah, kürten die Behörden selbst welche. Dabei ernannten sie aber weniger jene Männer, deren Wort bei ihrem Volk besonders schwer wog, sondern sie suchten sich Leute aus, mit denen sie selbst gut zurechtkamen. So kürten die US-Unterhändler einen Brulé namens Conquering Bear zum obersten Teton – zweifellos ein fähiger und geachteter Mann, aber nicht der einflussreichste.45 Die anderen indianischen Würdenträger fanden „Papierhäuptlinge“ wie Conquering Bear natürlich im besten Fall zum Lachen und im schlechtesten als Affront.46
Selbstverständlich hatten bei weitem nicht alle Gruppen der Lakota, der Assiniboine oder der Cheyenne an den Verhandlungen teilgenommen, den Vertrag dementsprechend nicht unterschrieben und fühlten sich daher auch nicht an ihn gebunden. Das permanente Pferdeerbeuten und die Kämpfe zwischen den Ureinwohnern gingen daher weiter.47 Schon bald beschwerten sich die Crow darüber, dass die Cheyenne und Lakota sie im Powder-River-Land angriffen, das laut Laramie-Vertrag ihr Stammesraum war. Nach den Buchstaben des Vertrags hätte man dafür den Aggressoren die Lieferungen kürzen können oder sogar müssen. Weil aber der zuständige Indianeragent an den Lieferungen verdiente, indem er Teile davon abzwackte und verkaufte, berichtete er Jahr für Jahr nach Washington, dass die Indianer schönsten Frieden hielten. So konnten die verbündeten Lakota, Cheyenne und Arapaho ungestört bis Ende der 1850er Jahre die Crow aus dem Powder-River-Land hinaus- und über den Yellowstone River zurückwerfen.48
Gleichwohl hatte die US-Regierung ihren Haupt-zweck mit dem Horse-Creek-Vertrag erreicht, allerdings nicht nachhaltig. Die Auswanderertrecks waren zunächst wieder relativ sicher, doch wurde der Friede schnell brüchig. Ab und an nahm ein Krieger den Emigranten ein Pferd, ein Maultier oder auch ein Rind weg, was Strafaktionen der US-Armee nach sich zog. Nach einem Überfall auf Siedler im Juni 1853 gab es ein kleines Gefecht zwischen Indianern und Soldaten, bei dem einige Minneconjou starben. Der einflussreiche Oglala Old Man Afraid Of His Horses hielt die Minneconjou von Racheaktionen zwar ab. Aber mehr und mehr Krieger – selbst unter den Oglala und Brulé, die den Weißen mehr gewogen waren als die Lakota weiter nördlich – begannen sich zu fragen, ob Stillhalten tatsächlich noch die beste Idee war.49
1 Stammel: Legende und Wirklichkeit, S. 130.
2 Bungert: Die Indianer, S. 107.
3 Ibid, S. 115.
4 Brown: Begrabt mein Herz, S. 19-20.
5 Stammel: Legende und Wirklichkeit, S. 130-131.
6 Taylor: Die Plains, in: ders. et al (Hg.): Ureinwohner Nordamerikas, S. 73.
7 Stammel: Legende und Wirklichkeit, S. 137.
8 Blashfield, Jean F.: The Oregon Trail, Minneapolis 2001, S. 17.
9 Taylor: Die Plains, in: ders. et al (Hg.): Ureinwohner Nordamerikas, S. 73.
10 Hyde, George E.: Spotted Tail's Folk. A History of the Brulé Sioux, 2. Aufl., Norman 1974, S. 47.
11 McMurtry: Crazy Horse, S. 28.
12 de Capua, Sarah: First Americans. The Cheyenne, New York 2007, S. 8.
13 Stammel: Legende und Wirklichkeit, S. 290-291.
14 Hyde: Red Cloud's Folk, S. 58.
15 McMurtry: Crazy Horse, S. 59.
16 Ibid, S. 29.
17 Brown: Begrabt mein Herz, S. 129.
18 McMurtry: Crazy Horse, S. 114.
19 Oeser: Epidemien, S. 116-117.
20 Bungert: Die Indianer, S. 74-76.
21 Oeser: Epidemien, S. 117-118.
22 Ibid, S. 120.
23 Ibid, S. 121.
24 McMurtry: Crazy Horse, S. 30.
25 Stammel: Legende und Wirklichkeit, S. 237. Heike Bungert gibt die ursprüngliche Zahl der Mandan allerdings nur mit 9.000 an, vgl. Bungert: Die Indianer, S. 75.
26 Oeser: Epidemien, S. 137.
27 de Capua: The Cheyenne, S. 10.
28 Lewy, Guenter: Were American Indians the Victims of Genodice?, in: History News Network 9/2004, abrufbar unter http://historynewsnetwork.org/article/7302, abgerufen am 17.09.2017. Heinz-Josef Stammel berichtet eine sehr ähnliche Geschichte. Bei ihm ist der Täter ein Schweizer Offizier in britischen Diensten in Toronto. Da beide Geschichten im selben Jahr spielen, ist es nicht unwahrscheinlich, dass es zwei Varianten ein und desselben Vorfalls sind, vgl. Stammel: Legende und Wirklichkeit, S. 96.
29 Oeser: Epidemien, S. 20-21.
30 Bach, Martina et al. (Hg.): Pschyrembel. Klinisches Wörterbuch, 261. Aufl., Berlin/New York 2007, S. 333.
31 Grinnel: The Cheyenne Indians, S. 164.
32 Ibid, S. 164-165.
33 Hyde: Spotted Tail's Folk, S. 51-52.
34 Die Verlustquote von mehr als 25 Prozent der Schiffe, die Heinz-Josef Stammel nennt, ist zwar sehr hoch gegriffen, aber ohne Zweifel war sie so hoch, dass sie abschreckte, vgl. Stammel: Legende und Wirklichkeit, S. 143.
35 Ibid, S. 143.
36 Hyde: Spotted Tail's Folk, S. 52-53.
37 Treaty of Fort Laramie, September 17th, 1851, Article 2, abrufbar unter: http://digital.library.okstate.edu/kappler/Vol2/treaties/sio0594.htm, abgerufen am 27. August 2016.
38 Treaty of Fort Laramie, September 17th, 1851, Article 6, abrufbar unter: http://digital.library.okstate.edu/kappler/Vol2/treaties/sio0594.htm, abgerufen am 27. August 2016.
39 Treaty of Fort Laramie, September 17th, 1851, Article 1, abrufbar unter: http://digital.library.okstate.edu/kappler/Vol2/treaties/sio0594.htm, abgerufen am 27.August 2016.
40 Treaty of Fort Laramie, September 17th, 1851, Article 5, abrufbar unter: http://digital.library.okstate.edu/kappler/Vol2/treaties/sio0594.htm, abgerufen am 27. August 2016.
41 Treaty of Fort Laramie, September 17th, 1851, Article 7, abrufbar unter: http://digital.library.okstate.edu/kappler/Vol2/treaties/sio0594.htm, abgerufen am 27. August 2016. In den Verhandlungen hatte man den Indianern eine Laufzeit von 50 Jahren versprochen. Der US-Senat kürzte bei der Ratifizierung des Vertrags aber die Zeit auf zehn Jahre, vgl. Stammel: Legende und Wirklichkeit, S. 144.
42 Treaty of Fort Laramie, September 17th, 1851, Article 8, abrufbar unter: http://digital.library.okstate.edu/kappler/Vol2/treaties/sio0594.htm, abgerufen am 27. August 2016.
43 Taylor: Die Plains, in: ders. et al. (Hg.): Ureinwohner Nordamerikas, S. 76.
44 Stammel: Legende und Wirklichkeit, S. 144.
45 McMurtry: Crazy Horse, S. 34.
46 Taylor: Die Plains, in: ders. et al. (Hg.): Ureinwohner Nordamerikas, S. 76.
47 McMurtry: Crazy Horse, S. 34.
48 Hyde: Red Cloud's Folk, S. 89-90.
49 Bray: A Lakota Life, S. 29-30.