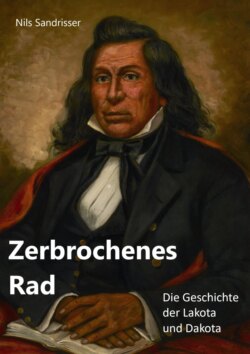Читать книгу Zerbrochenes Rad - Nils Sandrisser - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Wechselvolle Beziehungen
ОглавлениеIm Jahr 1803 ereignete sich etwas, das das weitere Schicksal der Indianer auf den Great Plains bestimmen sollte – freilich ohne dass sie es beeinflussten konnten oder auch nur davon ahnten. Sie wurden US-Amerikaner. Natürlich wurden sie keine Staatsbürger der USA, das waren Ureinwohner damals grundsätzlich nicht und würden es noch lange nicht sein. Aber das Gebiet, das sie bewohnten, kam unter die Herrschaft der USA.
Nominell war bis 1803 das Territorium westlich des Mississippi französisch und unter dem Namen Louisiana bekannt. Es erstreckte sich vom Golf von Mexiko bis zu den Rocky Mountains und zur heutigen kanadischen Grenze. Die Franzosen kontrollierten freilich maximal den Südzipfel um die Stadt New Orleans. Napoleon, der Erste Konsul der Franzosen, brauchte dringend Geld für seine Kriegskasse, und zwar viel nötiger als ein riesiges Land in Nordamerika, das weitgehend unerschlossen und zum großen Teil sogar noch unerforscht war. Er bot Louisiana den USA zum Kauf an. Die akzeptierten, zahlten 60 Millionen Francs – rund 15 Millionen US-Dollar – und verdoppelten so ihr Territorium.1
Nur einige Wochen nach Abschluss des Kaufvertrags rüstete die US-Regierung eine Expedition aus, die das unbekannte Land zwischen Mississippi und dem Pazifik erkunden sollte. Unter der Führung der Offiziere Meriwether Lewis und William Clark fuhren 33 Männer den Missouri hinauf. Neben ihrem Erkundungsauftrag sollten sie für gute Beziehungen zu den Indianervölkern sorgen, vor allem zu den gut 20.000 Lakota und Dakota. „Auf dieses Volk“, so hatte Präsident Thomas Jefferson geschrieben, „wollen wir wegen dessen immensen Stärke ganz besonders einen freundlichen Eindruck machen.“ Dass die Völker der sieben Ratsfeuer als Herrscher beidseits des Missouri etabliert waren, war in Washington also bereits bekannt.2
Die Teilnehmer der Lewis-und-Clark-Expedition waren freilich nicht die ersten Amerikaner, die die Lakota und Dakota zu Gesicht bekamen. Schon vor der Jahrhundertwende hatte sich der Kontakt zu Weißen intensiviert, vor allem zu Fallenstellern, den Trappern, die Bibern wegen deren Pelz nachstellten.3 Die Beziehungen zwischen Indianern und Trappern waren generell gut: Beide Seiten profitierten erheblich voneinander. Dafür, dass die Ureinwohner die Trapper in ihren Ländern Biber und andere Pelztiere jagen ließen, erhielten sie Werkzeuge und Kochgeräte aus Metall, Glasperlen, Zucker und Kaffee, gelegentlich auch Feuerwaffen. Mitunter tauschten die Indianer ihre selbst erjagten Felle gegen die begehrten Waren ein. Für die Fallenstellergesellschaften war dieser Handel lukrativ, denn die Pelze brachten im Osten viel Geld, während die Waren, die die Indianer haben wollten, dort vergleichsweise billig zu bekommen waren.4
Lewis und Clark begegneten, als sie den Missouri hinauffuhren, zunächst den Yankton, und zwar am 30. August 1804 an einem Ort am Missouriufer namens Calumet Bluff. Die Mitglieder der Expedition beschrieben in ihren Tagebüchern die Atmosphäre des Treffens als freundlich, die Yankton erhielten einige kleine Geschenke, hauptsächlich Tabak und Medaillen.5 Clark schätzte sie auf 2.000 bis 3.000 Köpfe, die sich in etwa 20 politisch autonome Gruppen aufteilten. Er notierte, dass einige der Gruppen mit den Ponca oder Omaha im Krieg lagen, andere mit diesen Nachbarvölkern dagegen gut auskamen. Er bekräftigte das Interesse der USA, dass Frieden zwischen den Indianervölkern herrschen solle, und lud die Yankton-Vertreter, die er traf, nach Washington ein. Die Yankton dankten zwar für die Geschenke, baten aber zugleich um Feuerwaffen für die Jagd und darum, dass die Regierung der Vereinigten Staaten ihnen Händler schicken möge.6
Mit den Teton dagegen waren die Beziehungen von Anfang an schwierig. Den Lakota waren die US-Amerikaner alles andere als willkommen. Sie fürchteten – und zwar wohl nicht ohne Grund –, ihre Hegemonie am Missouri zu verlieren. Denn die Lakota, besonders die Brulé, profitierten erheblich vom damaligen Handelssystem. Das sah so aus, dass britische Waren aus Kanada zunächst die Dakota erreichten. Von jenen übernahmen sie die Lakota im Tausch gegen Bisonfleisch und -felle sowie gegen Pferde und handelten sie bei den Hidatsa, Mandan und Arikara vor allem gegen Mais ein. Diese Rolle als Zwischenhändler sicherte ihnen einen erheblichen Teil ihrer Lebensmittelversorgung, wäre aber in Frage gestellt worden, wenn Handelsgüter künftig von Süden den Missouri hinauf gekommen wären und die Hidatsa, Mandan und Arikara direkt erreicht hätten.7
Mit einer Gruppe Brulé, die Lewis‘ und Clarks Expedition am 23. September traf, kam es fast sofort zu Spannungen. Die Indianer nahmen den Weißen ein Pferd weg,8 Und Lewis und Clark machten zugleich den Fehler, sich einen Mann namens Black Buffalo als obersten Häuptling auszugucken und ihm mehr Geschenke als den anderen Lakota zu machen, was bei jenen für erheblichen Unmut sorgte.9 Dieser Fehler, den die beiden begingen, wiederholte sich im Lauf der amerikanisch-indianischen Geschichte noch mehrfach. Larry McMurtry beschreibt das folgendermaßen:
„Was sofort deutlich wurde – zumindest den Indianern, den Weißen jedoch nicht –, war, dass die Weißen und die Indianer höchst unterschiedliche Auffassungen davon hatten, was ein Häuptling war und welche Machtbefugnisse er haben mochte. […] In weiter Ferne gab es einen Zaren aller Russen […]. Die Friedensunterhändler […] schienen anzunehmen, dass sich auch unter den Sioux solch ein Führer finden lassen würde – gewissermaßen ein Zar aller Sioux und jemand, der am allerbesten auch gleich noch die Pawnee, die Cheyenne, die Crow, die Shoshone und die Arapaho herumkommandieren konnte. Diese alberne, in den Köpfen der Weißen geisternde Annahme wirkte sich bis weit ins zwanzigste Jahrhundert hinein schädlich auf die Beziehungen der Regierung zur Urbevölkerung aus. Die Indianer hatten weder einen politischen Mechanismus, um solch einen Führer auszuwählen, noch die Absicht, ihm zu gehorchen, sollte er dennoch auftauchen.“10
In der Tat übersahen die Vertreter der USA oder nahmen gar nicht erst zur Kenntnis, dass die indianischen Vertreter oft nur für ihre erweiterte Familie sprechen konnten, bei den Lakota und Dakota also für die tíošpaye. Aber wenn McMurtry das albern nennt, urteilt er möglicherweise nicht ganz gerecht. Ethnologische Forschungen waren damals eben nicht so fortgeschritten wie heute. Gleichwohl mag es oft bequem gewesen sein, anderen Gesellschaften das eigene Modell überzustülpen. Es war eben deutlich einfacher, auf der Gegenseite einen Oberhäuptling anzunehmen als mit sämtlichen Sprechern aller möglicher Gruppen zu verhandeln. Umgekehrt waren die Eingeborenen über die politische Struktur der Weißen auch nicht besser informiert. In ihrer Vorstellung war der Große Vater in Washington ein Mann, dessen Wort bei den Weißen unbedingte Geltung hatte. Wenn so ein Mann garantierte, dass ein Stück Land ihnen gehören sollte, gingen sie davon aus, dass sie dort keine Weißen zu Gesicht bekommen würden – denn so stand es ja oft in den Verträgen. Das Wort des US-Präsidenten aber hatte bei Siedlern oder Goldsuchern in etwa dieselbe Bindungskraft wie das eines indigenen Führers bei Indianern, nämlich so gut wie keine. Das beschreibt Heinz-Josef Stammel:
„Stand heute noch ein Fort in einsamer Isolation weit von der Zivilisation entfernt in der Steppe oder in den Bergen, so genügte irgend ein ökonomischer Zündfunke, um in wenigen Tagen ganze Völkerschaften mobil zu machen, und wenn man in Washington Pläne machte und sie durchführen wollte, konnte ein solches Fort bereits mitten im brodelnden Hexenkessel des Goldbooms, des Eisenbahnbooms, des Rinderbooms oder sonst irgendeines Booms stehen. So waren die meisten Regierungsbeschlüsse oft schon überholt, noch bevor sie verwirklicht werden konnten. Sehr oft kehrten sie sich durch diese chaotische Entwicklung ins Gegenteil um.“11
In Amerika trafen also zwei auf ihre jeweilige Weise höchst demokratische Gesellschaftstypen aufeinander, in denen ein Höchstmaß an individueller Freiheit herrschte, wobei aber paradoxerweise Weiße ebenso wie Indianer davon ausgingen, dass die jeweils andere Seite autoritär dominiert sei.12
Diese Fehlannahme, der auch Lewis und Clark aufgesessen waren, hatte also die Brulé ordentlich verärgert. Die Teton traten selbstbewusst auf und forderten, Lewis und Clark sollten ihnen ein Boot voller Geschenke dalassen und dann verschwinden. Hier begingen die Weißen den nächsten Fehler: Sie gaben den Indianern Whisky, was die Stimmung endgültig aggressiv werden ließ.13 Unglücklicherweise war auch noch der fähigste Dolmetscher der Expedition bei den Yankton geblieben.14 Black Buffalo sorgte schließlich mit einem gehörigen Maß an Diplomatie dafür, dass kein Kampf ausbrach.15 Aber einige Brulé wollten die Expedition nicht weiterfahren lassen, bevor sie nicht mehr Geschenke bekommen hätten. Zuletzt gaben Lewis und Clark ihnen etwas Tabak und sahen zu, dass sie weiterkamen. Ihr Ziel, freundschaftliche Beziehungen zu den Lakota aufzubauen, hatten sie gründlich verfehlt.16 In den folgenden Jahren überfielen Teton-Krieger immer wieder US-amerikanische Händler auf dem Missouri.17
Lewis und Clark hatten die Santee nicht besucht. Zu ihnen schickte die Regierung 1805 eine Expedition unter einem Leutnant Zebulon Pike, der freundschaftliche Beziehungen zu ihnen aufbauen und sie dazu anhalten sollte, Frieden mit den Ojibwa zu schließen. Pike sollte den Santee auch Land abkaufen, denn die USA planten, in deren Gebiet Handels- und Militärniederlassungen zu gründen.18 In einem Mdewakanton-Dorf am Minnesota River schloss er am 23. September 1805 den ersten Vertrag der USA mit den Santee. Dabei waren sieben „Häuptlinge“ anwesend – oder was Pike darunter verstand –, die den USA 100.000 Acre Land abtraten, umgerechnet mehr als 40.000 Hektar. Pike schätzte den Wert dieses Lands auf 200.000 Dollar, hatte aber keine Summe in den Vertrag hineingeschrieben. Als der Senat ihn einige Zeit später ratifizierte, stand in dem Kontrakt eine Summe von 2.000 Dollar.19
Auch nachdem sich die USA erstmals offiziell gezeigt hatten, hielten die Dakota ebenso wie die anderen Völker ihrer Region regen Kontakt zu britischen Händlern, die aus Kanada kamen. Als 1812 der – bis heute letzte – Krieg der USA gegen Großbritannien ausbrach, nutzten die Briten den Einfluss, den sie unter den Indianervölkern hatten, und boten jede Menge indianische Hilfstruppen auf. Anders als die Yankton, die den USA zuneigten, kämpften die Santee fast geschlossen für die Briten.20 Das taten sie auch wohl mit großem Einsatz, denn bei einem Gefecht eroberten sie eine US-amerikanische Kanone und übergaben das Geschütz an ihre Verbündeten.21
Nach dem Krieg wurde das Verhältnis der USA zu den Santee besser. An der Mündung des Minnesota River in den Mississippi entstand 1819 das Fort Snelling, das zunächst noch Fort St. Anthony hieß. Es war nicht nur ein Militär-, sondern auch ein Handelsposten, der die Dakota und die anderen Indianer der Umgebung mit begehrten Waren versorgte.22 Viel wichtiger noch: Es war auch eine Agentur. Ein Indianeragent war der Vertreter der US-Regierung bei den indigenen Völkern, und mit ihrem ersten Agenten, Lawrence Taliaferro, hatten die Santee Glück. Taliaferro galt als unbestechlich und brachte ihnen Respekt entgegen. Zudem stand ihm jahrelang ein fähiger Dolmetscher zur Verfügung. In der Folge lebten US-Amerikaner und Santee weitgehend konfliktfrei nebeneinander, was natürlich auch daran lag, dass es bis in die 1830er Jahre hinein nur wenige weiße Siedler in Minnesota gab.23
Trotz des schwierigen Verhältnisses zu den Lakota waren diese in den 1810er und 1820er Jahren für die USA nicht die größten Problemkandidaten in der Missouriregion – das waren die Blackfeet und die Arikara. Wenn die Interessen nahe genug beieinander lagen, taten sich Teton und weiße Amerikaner auch einmal zusammen. 1823 gerieten die Arikara mit einem Trupp US-amerikanischer Trapper aneinander und töteten etwa ein Dutzend von ihnen. Die US-Armee schickte einen Oberst Henry Leavenworth mit 230 Soldaten aus, um die Arikara zu bestrafen. Ihm schlossen sich neben 120 rachedurstigen Trappern auch 400 bis 500 Lakota an.24 Der Taktik des Obersts bestand darin, das Arikara-Dorf mit Kanonen beschießen zu lassen. Allerdings verfeuerten die Soldaten Leavenworths nahezu ihre gesamte Munition, ohne großen Schaden anzurichten. Die Teton jedoch machten diese Art Krieg nicht lange mit und plünderten die Maisfelder der Arikara. Sie verzogen sich mit ihrer Beute und nahmen ein Dutzend Soldatenpferde und -maultiere mit.25
Leavenworths dilettantische Aktion hatte das Ansehen der USA bei den Missouri-Völkern und besonders bei den Lakota, die Augenzeugen gewesen waren, ordentlich ramponiert. Im Kongress und im Senat fürchteten gar einige Abgeordnete, die Indianervölker könnten sich verbünden und alle Weißen vertreiben wollen, da sie nun jeden Respekt verloren hätten. Das war natürlich nur eine schwarze Fantasie, aber in den Augen vieler Zeitgenossen schien sie real. Eine neue Expedition sollte die US-Herrschaft über den oberen Missouri sichern. Sie umfasste fast 500 Soldaten auf mehreren Booten, ihre Anführer waren der Brigadegeneral Henry Atkinson und der Indianeragent Benjamin O'Fallon.26 Immerhin schafften Atkinson und O'Fallon es, 1825 den ersten Vertrag der USA mit den Lakota abzuschließen.27 In ihm erkannten die Teton die Oberherrschaft der USA an und verpflichteten sich, Stammesangehörige auszuliefern, die eines Verbrechens beschuldigt waren. Ähnliche Verträge unterzeichneten noch elf weitere Indianervölker aus der Missouriregion.28 Ob sie deren Inhalte verstanden, darf bezweifelt werden, denn obgleich es verboten war, Alkohol an Indianer abzugeben und Atkinson als Militär den Auftrag hatte, dieses Verbot durchzusetzen, war er selbst bei Vertragsverhandlungen äußerst freigiebig mit Schnaps.29
Einen durchschlagenden Erfolg hatte die Expedition freilich nicht, denn in der Zeit danach gingen die Schwierigkeiten mit den Blackfeet und den Arikara weiter. Das mag auch daran gelegen haben, dass Atkinson und O'Fallon sich nicht dadurch beirren ließen, dass sie bei keinem Volk Häuptlinge mit allgemeinem Vertretungsanspruch antrafen. Sie behalfen sich, indem sie selbst welche benannten. Die meisten Indianer fühlten sich an diese Verträge – die ja Leute unterzeichnet hatten, die sie nicht als ihre Vertreter anerkannten – nicht gebunden, wenn sie denn überhaupt je von ihnen gehört hatten. Die Lakota verhielten sich aus Sicht der Weißen in den folgenden Jahren dennoch recht friedlich.30
1 Gerste, Ronald G.: Die Verdoppelung der USA, in: Die Zeit 18/2003 vom 24. April, abrufbar unter: http://www.zeit.de/2003/18/A-Louisiana/komplettansicht, abgerufen am 26.06.2016.
2 Ronda, James P.: Lewis & Clark among the Indians, Lincoln/London 2002, S. 30.
3 Stammel: Legende und Wirklichkeit, S. 65.
4 Ibid, S. 128.
5 Whitehouse, Joseph: Thursday, August 30th, 1804, in: Dunham, Gary/Walter, Katherine (Hg.): Lewis and Clark Journals, abrufbar unter: http://lewisandclarkjournals.unl.edu/read/?_xmlsrc=1804-08-30.xml&_xslsrc=LCstyles.xsl, abgerufen am 13.08.2016.
6 Clark, William: Friday, August 31st, 1804, in: Dunham, Gary/Walter, Katherine (Hg.): Lewis and Clark Journals, abrufbar unter: http://lewisandclarkjournals.unl.edu/read/?_xmlsrc=1804-08-31.xml&_xslsrc=LCstyles.xsl, abgerufen am 13.08.2016.
7 Ronda: Lewis & Clark, S. 30-31.
8 Clark: Monday, September 24th, in: Dunham, Gary/Walter, Katherine (Hg.): Lewis and Clark Journals, abrufbar unter: http://lewisandclarkjournals.unl.edu/read/?_xmlsrc=1804-09-24.xml&_xslsrc=LCstyles.xsl, abgerufen am 13.08.2016.
9 Ders.: Tuesday, September 25th, in: Dunham, Gary/Walter, Katherine (Hg.): Lewis and Clark Journals, abrufbar unter: http://lewisandclarkjournals.unl.edu/read/?_xmlsrc=1804-09-25.xml&_xslsrc=LCstyles.xsl, abgerufen am 13.08.2016.
10 McMurtry: Crazy Horse, S. 33-34.
11 Stammel: Legende und Wirklichkeit, S. 137-138.
12 Ibid, S. 170.
13 Clark: Tuesday, September 25th, in: Dunham, Gary/Walter, Katherine (Hg.): Lewis and Clark Journals, abrufbar unter: http://lewisandclarkjournals.unl.edu/read/?_xmlsrc=1804-09-25.xml&_xslsrc=LCstyles.xsl, abgerufen am 13.08.2016.
14 Ronda: Lewis & Clark, S. 31.
15 Clark: Tuesday, September 25th, in: Dunham, Gary/Walter, Katherine (Hg.): Lewis and Clark Journals, abrufbar unter: http://lewisandclarkjournals.unl.edu/read/?_xmlsrc=1804-09-25.xml&_xslsrc=LCstyles.xsl, abgerufen am 13.08.2016.
16 Ders.: Friday, September 28th, in: Dunham, Gary/Walter, Katherine (Hg.): Lewis and Clark Journals, abrufbar unter: http://lewisandclarkjournals.unl.edu/read/?_xmlsrc=1804-09-28.xml&_xslsrc=LCstyles.xsl, abgerufen am 13.08.2016.
17 Hyde: Red Cloud's Folk, S. 35.
18 Meyer: Santee Sioux, S. 24.
19 Ibid, S. 25.
20 Ibid, S. 28-29.
21 Brown: Begrabt mein Herz, S. 72.
22 Anderson, Gary C.: Massacre in Minnesota. The Dakota War of 1862, the Most Violent Ethnic Conflict in American History, Norman 2019, S. 7, vgl, auch Meyer: Santee Sioux, S. 35.
23 Meyer: Santee Sioux, S. 35-37.
24 Jensen, Richard E. Hutchins, James S.: Wheel Boats on the Missouri. The Journals and Documents of the Atkinson-O'Fallon Expedition, 1824-1826, Helena/Lincoln 2001, S. 18.
25 Ibid, S. 19.
26 Ibid, S. 20-22.
27 Lutz: Who-is-Who, S. 31.
28 Jensen/Hutchins: Wheel Boats on the Missouri, S. 34-35.
29 Ibid, S. 26.
30 Ibid, S. 36-40.