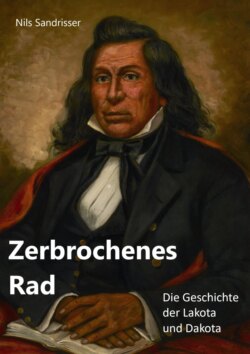Читать книгу Zerbrochenes Rad - Nils Sandrisser - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Im Land des rauchenden Wassers
ОглавлениеDer Schnee fällt in dicken Flocken. Die beiden französischen Forscher und Pelzhändler Pierre Esprit Radisson und Médart Chouart können wegen des schlechten Wetters kaum ihr Lager in den Wäldern um die Großen Seen verlassen, um zu jagen. Sie haben Hunger. Der Winter will im Jahr 1660 einfach nicht weichen.
Als der Schneefall schließlich nachlässt, finden die beiden gastliche Aufnahme bei einem Volk im heutigen Grenzgebiet von Wisconsin und Minnesota. Radisson und Chouart führen sich mit einem Knalleffekt bei ihren neuen Bekannten ein. Während sie in einer Hütte um ein Feuer sitzen und eine Pfeife rauchen, streuen die Indianer Tabak in die Flammen. Die Franzosen tun es ihnen mit Schießpulver nach, was ihre indigenen Gastgeber augenblicklich in alle Richtungen davonstieben lässt – und zwar „ohne jeden weiteren Verzug“ und „ohne vorher zu schauen, wo die Tür ist“, wie Radisson feixend notiert.1
Die französischen Kolonisten in Amerika kennen dieses Volk, das sich so gastfreundlich präsentiert, schon seit 20 Jahren von Hörensagen. Die Ojibwa, die nördlich der Großen Seen leben und mit den Franzosen Handel treiben, haben vom ihm erzählt und es „Nadoweis-siw“ genannt, was so viel bedeutet wie „kleine Schlangen“, frei übersetzt „Feinde, die man nicht allzu ernst nehmen muss“. Den respektvolleren Begriff „große Schlangen“ haben die Ojibwa für die südlich der Seen lebenden Irokesen reserviert.2 Die „Nadoweis-siw“ bezeichnen sich selbst als Lakota oder Dakota, was „Freunde“ oder „Verbündete“ bedeutet. Für die Menschen dieses Volks sind Radisson und Chouart die ersten Europäer, die sie zu Gesicht bekommen. Die Franzosen verschleifen den Ojibwa-Begriff in „Nadouessioux“ und verkürzen es zu „Sioux“.3
Den weiteren Beziehungen zwischen „Nadouessioux“ und Franzosen ist der derbe Spaß Radissons und Chouarts nicht abträglich. Radisson besucht sie später noch zwei Mal, und als er seine Schießpulver-Nummer abermals aufs Tapet bringt, erzielt er nur noch Lacherfolge.4 Zwischen den Franzosen und den Lakota und Dakota herrschen in der Folgezeit recht freundliche Verhältnisse. Missionare und Händler besuchen sie. Ein Händler namens Nicholas Perrot lässt sich im Jahr 1686 mit einem Fort in ihrem Gebiet nieder.5
Jenes Gebiet, das die Lakota und Dakota zu dieser Zeit bewohnten, umfasste den Oberlauf des Mississippi, westlich des Michigansees und des Oberen Sees, in den heutigen US-Bundesstaaten Wisconsin und Minnesota.6 Der Name „Minnesota“ leitet sich aus ihrer Sprache ab. Mni šota heißt „rauchendes Wasser“, gemeint ist der Nebel, der in dieser Region voller Wälder, Sümpfe und Seen häufig über den Gewässern hängt. Die Lebensweise der Lakota und Dakota glich jener der benachbarten Völker in dieser Region. Die Waldland-Indianer im Nordosten Nordamerikas lebten in Dörfern, die im Winter meist aus sechs bis acht Familien bestanden. Im Sommer, wenn es viel Nahrung gab, kamen größere Verbände zusammen. Zur Jagd oder für einen Kriegszug vereinigten sich manchmal mehrere Dörfer. Die Indianer bewohnten konische oder kuppelförmige Wigwams, die mit Birkenrinde oder Tierhäuten gedeckt waren, jagten in den Wäldern Hirsche und Kleinwild, fingen Fisch und betrieben Feldbau. Auf ihren Äckern wuchsen Mais, Bohnen und Kürbisse.7
Die Irokesen nannten diese Pflanzen „die drei Schwestern“, weil sie sich hervorragend ergänzen.8 Am Mais rankten sich die Bohnen empor, während die großen Blätter der Kürbispflanzen den Grund abschatteten und so einerseits das Unkrautwachstum hemmten, andererseits den Boden feucht hielten und ihn gleichzeitig davor schützten, bei Starkregen weggewaschen zu werden. Überdies hielten die Bohnenpflanzen den Boden fruchtbar, denn Bakterien an ihren Wurzeln banden dort Stickstoff, der sie und andere Pflanzen düngte.9 Auch in ernährungsphysiologischer Hinsicht ergänzen sich diese Ackerfrüchte. Mais enthält viel Stärke, aber weder Lysin noch Tryptophan – zwei Aminosäuren, die der menschliche Körper selbst nicht herstellen kann, sie aber braucht, um lebensnotwendige Eiweiße zu erzeugen. Eine Lücke, die die Bohne perfekt füllt, weil sie viel Lysin und Tryptophan enthält.10
Einige der Weißen, die die „Nadouessioux“ besuchten, berichteten später, dieses Volk sei bäuerlich, andere hingegen erzählten, dass es keinen Feldbau betreibe. Wahrscheinlich stimmt beides: Einige Dörfer waren von Feldern umgeben, andere nicht. Zu einem beträchtlichen Teil ernährten sich die Lakota und Dakota von der Jagd, wobei vor allem die westlichen Gruppen in die Grasebenen der Great Plains vordrangen und dort Bisons erlegten. Die östlichen Gruppen dagegen nutzten den Wilden Reis.11 Diese Pflanze, die botanisch mit dem Reis nichts zu tun hat, wuchs massenweise im Uferbereich der Seen im Mississippi-Quellgebiet. Die Indianer ernteten ihn, indem sie mit Kanus durch den Wildreis im flachen Wasser fuhren, die bis zu sechs Meter langen Halme niederdrückten und mit Stöcken die Körner aus den Ähren ins Kanu hinein droschen.12 Das Steuern der Boote war Männer-, das Dreschen Frauenarbeit. In einem mit Häuten ausgekleideten Erdloch zerstampften die Frauen die getrockneten Körner des Wildreises und lösten dabei die Hülsen ab.13
Im zeitigen Frühjahr, kurz nach der Schneeschmelze, begann das Einkochen von Ahornsirup. Dazu ritzten die Indianer der Region um die Großen Seen die Rinde der Ahornbäume ein und fingen den austretenden, zuckerhaltigen Saft in hölzernen Gefäßen oder in Kanus auf. Das Einkochen des Sirups war in der Regel die Aufgabe von Frauen, Kindern und älteren Männern, weil die jüngeren Männer um diese Zeit die Dörfer zum Jagen verließen. Stark eingekocht und zu Pulver zermahlen, hielt sich der Zucker das gesamte restliche Jahr. Die Ureinwohner verfeinerten damit ihre Wildreis-, Mais- und Fleischgerichte.14
Französische Händler beeinflussten die weitere Entwicklung der Lakota und Dakota ganz erheblich – wenn auch nur mittelbar und sehr wahrscheinlich ohne Absicht. Sie beeinflussten sie nämlich durch eines ihrer Handelsgüter: Feuerwaffen. Denn damit versorgten die Franzosen die Ojibwa recht ordentlich, die ihnen dafür Pelze lieferten.15 Das freilich machte die Ojibwa jedem ihrer indianischen Feinde drückend überlegen, und sie ließen sich ihre Chance nicht entgehen. Sie richteten die französischen Gewehre gegen ihre roten Nachbarn und expandierten auf deren Kosten. Allmählich gaben daher die Gruppen der Lakota und Dakota ihre gefährlich gewordenen Territorien auf und zogen sich nach Südwesten zurück. Sie gingen nicht alle auf einmal, sondern einzelne Gruppen zogen über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten fort.16 Ihr Schicksal teilten die bäuerlichen Völker der Cheyenne und der Arapaho, die ebenfalls in die Gewehrläufe der Ojibwa blickten und nach Westen auswichen.17
Die Gebiete, in die die Dakota und Lakota nun zogen, waren zuvor natürlich nicht menschenleer gewesen. Die Neuankömmlinge waren ihrerseits kaum angenehmere Nachbarn als die Ojibwa und verdrängten die Alteingesessenen nach Süden und Westen, vor allem, als sie selbst mit französischen und britischen Feuerwaffen wohlversorgt waren.18 Zunächst waren die Omaha die Leidtragenden. In deren Gebiet im südwestlichen Minnesota und nördlichen Iowa hatten die Lakota und Dakota Ende des 17. Jahrhunderts Dörfer errichtet und die Omaha an den Missouri abgedrängt. In Minnesota spalteten die Sieger sich im sieben Gruppen auf, bewahrten aber das Gefühl, sich ähnlich zu sein und zusammenzugehören.19 Sie sprachen von sich als den oceti šakówiŋ, den „Sieben Ratsfeuern“. Die Namen dieser Völker der sieben Ratsfeuer waren:
Teton,
Yankton,
Yanktonai,
Mdewakanton,
Wahpekute,
Wahpeton und
Sisseton.20
Diese Ausdifferenzierung geschah auch entlang der Dialektlinien. Die Teton sind mit den Lakota gleichzusetzen, während die anderen Gruppen zusammen die Dakota bildeten. Daneben existiert ein dritter Dialekt, das Nakota, dessen Sprecher aber nicht Teil der oceti šakówiŋ waren. In der Hauptsache unterscheiden sich diese Sprachvarianten in der Verwendung der Laute L, D und N. Worte, die die Lakota mit L aussprechen, lauten im Dakota auf D und im Nakota auf N – wie die Eigennamen bezeugen. Alle drei Worte – Lakota, Dakota und Nakota – bedeuten „Verbündete“ oder „Freunde“. Das Wort „Vogel“ heißt auf Lakota ziŋtkala, auf Dakota ziŋtkada und auf Nakota ziŋtkana.21
Lange gruppierten Sprachforscher die Yankton und Yanktonai in die Nakota ein. In der Tat sprechen sie einige Worte mit N aus, aber bei weitem nicht alle. Neuere Forschungen gehen daher davon aus, dass diese beiden Völker zu den Dakota zu zählen sind und die Westlichen Dakota bilden, während die Östlichen Dakota aus Mdewakanton, Wahpekute, Wahpeton und Sisseton bestehen, die gemeinsam unter dem Namen Santee bekannt waren.22
Unbestritten aber sind die Assiniboine Sprecher der N-Variante, also des Nakota. Sich selbst nennen die Assiniboine Nakonabi – auch in diesem Eigennamen wird die Verwandtschaft deutlich. Dennoch waren Assiniboine einerseits und Lakota und Dakota andererseits bittere Feinde. Die Assiniboine hatten sich schon vor dem ersten Kontakt zu Weißen von den Yanktonai abgespalten und waren nach Norden gezogen ins heutige Grenzgebiet der Vereinigten Staaten und Kanada. Dort hatten sie sich mit alten Feinden verbündet, mit den Cree und den Ojibwa. Die Lakota und Dakota nannten ihre Verwandten fortan hohe, „Rebellen“. Den Namen Assiniboine gaben ihnen die nun befreundeten Ojibwa. In deren Sprache bedeutet assi-nibo-in so viel wie „Jene, die auf Steinen kochen“.23
1 Wisconsin Historical Society: Voyages of Peter Esprit Radissonn, being an account of travels and experiences among the North American Indians, from 1652 to 1684, transcribed from original manuscripts in the Bodleian Library and the British Museum, S. 209, abrufbar unter https://content.wisconsinhistory.org/digital/collection/tp/id/39401, abgerufen am 4.01.2021.
2 Stammel, Heinz-Josef: Indianer. Legende und Wirklichkeit von A-Z, Sonderausgabe, München 1992, S. 276.
3 Gollner-Marin, Martin Nizhoní: Ikce Wicaša - Der Überlebenskampf der Lakota und die Liebe zur Weisheit. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen Fakultäten der Albert-Ludwigs-Universität zu Freiburg i.Br., Freiburg 1994, S. 19-20.
4 Meyer, Roy W.: History of the Santee Sioux. United States Indian Policy on Trial, 2. Aufl. Lincoln/London 1993, S. 3-5.
5 Ibid, S. 9.
6 Stammel: Legende und Wirklichkeit, S. 276.
7 DeMallie, Raymond: The Sioux at the Time of European Contact: An Ethnohistorical Problem, in: Strong, Pauline T./Kan, Sergei A.: New Perspectives on Native North America: Cultures, Histories, an Representations, Lincoln 2006, S. 248.
8 „Die drei Schwestern sind glücklich, weil sie von ihrem Sommer auf den Feldern wieder zu Hause sind“, pflegten die Frauen der Irokesen bei der Ernte zu singen, vgl. Taylor, Colin: Der Nordosten, in: ders. et al.: Indianer. Die Ureinwohner Nordamerikas – Geschichte, Kulturen, Völker und Stämme, Gütersloh/München 1992, S. 231.
9 Diese ausgeklügelte Form des Ackerbaus, bei der Mais, Bohnen und Kürbisse gleichzeitig auf einem Feld wuchsen, praktizierten viele Indianervölker in Nord- und Südamerika, unter anderem auch die Maya, vgl. Westphal, Wilfried: Die Maya. Volk im Schatten seiner Väter, Bindlach 1991, S. 79 ff.
10 Hurst Thomas, David: Die Bauern der Neuen Welt, in: Burenhult, Göran (Hg.): Menschen der Urzeit. Die Frühgeschichte der Menschheit von den Anfängen bis zur Bronzezeit, Köln 2004, S. 380.
11 DeMallie: Ethnohistorical Problem, in: Strong/Kan: New Perspectives, S. 248-249.
12 Stammel: Legende und Wirklichkeit, S. 290.
13 Taylor: Nordosten, in: ders. et al.: Ureinwohner Nordamerikas, S. 237.
14 Eastman, Charles A.: Indian Boyhood, New York 1902, S. 20-23, als pdf-Dokument abrufbar unter: http://pinkmonkey.com/dl/library1/digi152.pdf, abgerufen am 3.06.2017.
15 Stammel: Legende und Wirklichkeit, S. 215.
16 Ibid, S. 276.
17 Ibid, S. 202.
18 Hyde, George E.: Red Cloud's Folk. A History of the Oglala Sioux Indians, Norman 1975, S. 9.
19 Lutz, Gregor: Das Who-is-Who der Teton Sioux, Norderstedt 2009, S. 8.
20 Ibid, S. 8-10.
21 Krüger, Martin: Lakóta wówaglaka – Lakota (Sioux) für Anfänger, Wyk auf Föhr 2000, S. 14.
22 Miller, David et al.: The History of the Assiniboine and the Sioux Tribes of the Fort Peck Indian Reservation in Montana, 1800-2000, Poplar 2008, S. 34.
23 Stammel: Legende und Wirklichkeit, S. 203.