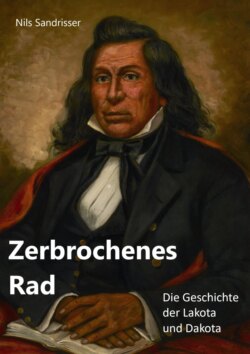Читать книгу Zerbrochenes Rad - Nils Sandrisser - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Kultur der Plains-Indianer
ОглавлениеKulturell ähnelten die Ureinwohner auf den Great Plains einander, vor allem in Bezug auf die Rolle, die der Krieg in ihrem Leben spielte. Lakota, Crow, Blackfeet oder Kiowa waren überaus wehrbereite Völkchen. Dabei ging es ihnen nicht primär darum, möglichst viele Feinde niederzumachen oder möglichst viel Territorium zu erobern. Einen Kampf zwischen Indianern charakerisiert der Pulitzer-Preisträger Larry McMurtry:
„Standen sich die beiden Seiten erst einmal gegenüber, gab es eine Menge Krakeel, Spott, Scheinangriffe, Vorstöße, ab und zu einen Verletzten und ab und zu einen Toten, wonach sich, da nun die Stammesehre verteidigt und die individuelle Tapferkeit vor Zeugen unter Beweis gestellt war, alle noch ein paar Mal gegenseitig anschrien und dann wieder nach Hause ritten. (Es gab auch ein paar ernste Schlachten und sogar einige Massaker, aber sie bildeten Ausnahmen, nicht die Regel.)“1
Die Opferzahlen, die diese Lebensweise forderte, waren also nicht so hoch, dass sie den Fortbestand der Völker als solche bedrohten. Der Grund dafür lag darin, dass Krieg im hohem Maß ritualisiert war. Das Töten eines Feindes wurde nicht einmal sonderlich hoch bewertet. Als Heldentat höchsten Ranges galt ein sogenannter Coup: das Berühren eines lebenden Gegners mit einer Hand oder einem harmlosen Stock.2 Der angesehene Cheyenne-Krieger Big Foot zum Beispiel legte Wert darauf, nie einen Feind umgebracht zu haben. Sein Ansehen speiste sich aus seinem Talent, den Gegnern die Pferde abzunehmen.3
Der soziale Rang eines Kriegers ergab sich zum Großteil aus seinen militärischen Verdiensten und dem Risiko, das er dabei einging.4 Krieg war so etwas wie ein männlicher und gefährlicher Sport. Der Wahpeton Charles Eastman erzählte in seiner erstmals 1916 erschienenen Autobiografie:
„Ich fühlte keinen Hass auf die Feinde unseres Stammes. Ich sah sie mehr so, wie ein College-Athlet seine Rivalen von einem anderen College sieht. Es gab keinen Gedanken daran, eine Nation zu zerstören, ihr das Land wegzunehmen oder ihre Menschen zu versklaven […].5
Die Ritualisierung darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass indianische Kriegsführung überaus grausam sein konnte und in der Regel auch war. Sie unterschied kaum jemals Kombattanten von Nichtkombattanten. Zwischen Kriegern mag es häufig bei Drohgebärden und Scheinangriffen geblieben sein. Frauen und Kinder der Gegenseite waren in der indianischen Vorstellung aber legitime Kriegsziele, die oft starben, wenn sie feindlichen Kriegern in die Finger gerieten. Vergewaltigung war üblich, ebenso die Verschleppung. Manchmal nahm man Gefangene, meist Frauen oder Kinder, in den Stamm auf.6 Der Hunkpapa Sitting Bull zum Beispiel adoptierte einen zwölfjährigen Assiniboine-Jungen als Bruder, nachdem sein Kriegstrupp die gesamte Familie des Jungen umgebracht hatte.7 Den Marterpfahl und die mit ihm verbundene rituelle Folterung kannten die Völker der Great Plains allerdings nicht – mit Ausnahme der Comanche, die beim Quälen ihrer Gefangenen ziemlich erfinderisch waren.8
Krieg war für die Ureinwohner der Prärien eine sehr individuelle Geschichte. Ein Kriegstrupp hatte stets nur eine rudimentäre Führung und war kein festgefügtes Heer, das Feldherren wie Schachfiguren über ein Schlachtfeld dirigieren konnten. Er war mehr eine Versammlung einzelner Krieger oder Kriegergruppen. Jeder kämpfte so, wie er seine Tapferkeit am besten für alle darstellen konnte – je jünger der Mann, umso weniger war er in der Regel geneigt, Anweisungen Folge zu leisten. Unter den Plains-Indianern hatte kein Kriegsführer je komplette Kontrolle über seine jungen Burschen, schon gar nicht langfristig.9 Loyalität konnte er sich nur sichern, indem er die Verluste gering hielt. Als zum Beispiel einige Comanche und Kiowa im Jahr 1874 einen Trupp Büffeljäger angreifen wollten, erzählte ihnen ein Comanche-Schamane namens Isatai, sein Zauber könne sie kugelfest machen. McMurtry beschreibt lapidar:
„Leider stellte sich heraus, dass die Kugeln sowohl die Medizin als auch die Comanche leicht durchdringen konnten.“10
Dem unglücklichen Isatai brachte das Desaster eine Tracht Prügel ein – obwohl dieser die Schuld einem Krieger zuschob, der angeblich den ganzen Zauber vermasselt habe, weil er ein Maultier anstatt eines Pferds geritten hatte.11
Das Skalpieren kannten fast alle Völker Nord-amerikas und wendeten es mit Fleiß an. Skalps dienten als Trophäe, als Tapferkeitsnachweis. Den Skalp einer Frau oder eines Kindes zu besitzen galt nicht als Schande, sondern als Beleg dafür, dass ein Krieger es gewagt hatte, in den unmittelbaren Nahbereich eines feindlichen Dorfs einzudringen. Allgemein üblich war auch das rituelle Verstümmeln von Leichen nach einem Kampf. Bei den meisten Prärievölkern war nämlich die Vorstellung verbreitet, man komme nach dem Tod in eine paradiesische Geisterwelt, allerdings komme man dort im körperlichen Zustand des Todeszeitpunkts an. Das Ausstechen der Augen oder Abschneiden von Händen, Ohren, Nasen und Penissen sollten den toten Feinden daher das Leben im Jenseits versauen. Es fällt jedoch schwer, ähnliche spirituelle Erklärungen zu finden für Praktiken wie zum Beispiel jene, Leichen die Blase aufzuschneiden und hineinzuurinieren oder hineinzukoten. Zu einem Gutteil dürfte sich das verbreitete Leichenverstümmeln dadurch erklären, dass die Sieger – und übrigens sehr oft auch deren Frauen – ihr überschüssiges Adrenalin abreagieren und die besiegten Feinde postmortal demütigen wollten.12 Auch die Schwelle zum makabren Scherz war mitunter schnell überschritten, wie eine Episode zeigt, die Plenty Coups beschrieb, ein prominenter Crow. Er erinnerte sich an einen Jux eines gewissen Medicine Raven, wobei Plenty Coups andeutete, dass er diese Art von Humor geschmacklos fand. Eine Gruppe Crow, darunter Plenty Coups und Medicine Raven, hatte mit Lakota gekämpft und besuchte danach in einem Handelsposten ihren Freund Paul McCormack, den die Crow Yellow Eyes nannten. Plenty Coups berichtete:
„Yellow Eyes lief geradewegs auf Medicine Raven zu, zog sich den Handschuh herunter und streckte ihm die Hand entgegen. [...] Medicine Ravens Bisonrobe war eng um seinen Körper gewickelt, und er streckte nur eine Hand heraus, die Yellow Eyes ergriff […]. Er schüttelte die Hand heftig. Als Medicine Raven sich umdrehte, um die Hand Major Peases zu schütteln, sah ich Yellow Eyes zurückspringen und etwas in den dünnen Schnee fallen lassen. Es klang wie ein Stein. Ich sah hin. Es war die gefrorene Hand eines Sioux.“13
Andererseits diente das Verstümmeln auch der Dokumentation. Jedes Volk hatte seine eigene Art, seine Teilnahme an einer Schlacht an Gefallenen kenntlich zu machen. Nach einem Gefecht zwischen Ureinwohnern und US-Soldaten in Nebraska im Juni 1967 berichtete der Arzt William Bell, wie man die Leichen von fünf Soldaten fand, die die Indianer von der Hauptabteilung abgeschnitten und aufgerieben hatten:
„Eine Handvoll Männer nur, gewiss, aber so mit Wunden übersät, dass sie, gleichmäßig verteilt, hingereicht hätten, eine ganze Kompanie zu töten. […] Die bis auf die Knochen zerhackten Armmuskeln des rechten Arms verraten die Arbeit der Cheyenne oder ‚Armabschneider‘, die aufgeschlitzte Nase ist für den ‚Kleineren Stamm‘, die Arapaho, kennzeichnend, und die durchgeschnittene Kehle legt Zeugnis darüber ab, dass auch die Sioux mitgemischt haben. […] Bis heute weiß ich nicht, welcher Stamm sich durch die Einschnitte an den Oberschenkeln und die klaffenden schräg-parallelen Risswunden in den Waden bemerkbar machte. Auch die Pfeile unterscheiden sich von Stamm zu Stamm in Machart und Farbe, und aufgrund der Formenvielfalt war klar, dass Krieger mehrerer Stämme absichtlich jeweils einen Pfeil im Körper des Toten zurückgelassen haben.“14
Weder das Skalpieren noch das Leichenverstümmeln waren rein indianische Angewohnheiten, auch Weiße zogen ihren toten eingeborenen Feinden das Fell über die Ohren.15 Und das war lediglich die verbreitetste Scheußlichkeit, die beide Seiten einander antaten. Der US-Offizier James Connor, der 1864 beim Sand-Creek-Massaker zugegen war, als weiße Milizionäre ein Dorf der Cheyenne und Arapaho überfielen, beschrieb:
„Als ich am nächsten Tag über das Schlachtfeld ging, sah ich keine Leiche eines Mannes, einer Frau oder eines Kindes, die nicht skalpiert war, und in vielen Fällen waren die Leichen auf grässlichste Weise verstümmelt. […] Außerdem hörte ich von zahlreichen Fällen, in denen Männer Frauen die Geschlechtsteile herausschnitten und sie über ihre Sattelknäufe spannten oder sie an ihren Hüten trugen, als sie weiterritten.“16
Selbstverständlich bestand das Leben eines Prärieindianers nicht ausschließlich aus Kämpfen und Verstümmeln. Es gab noch weitere Tugenden außer den militärischen, mit denen ein Kiowa, Arapaho oder Lakota sein Ansehen bei seinen Leuten steigern konnte, Umsicht zum Beispiel, Verantwortungsbewusstsein oder Großzügigkeit – im Prinzip die selben Tugenden, die fast auf der ganzen Welt gelten.17 Es wurde erwartet, dass reichere Stammesmitglieder Pferde an ärmere verschenkten oder verliehen. Wer sich freigiebig zeigte, gewann dadurch nicht nur Sozialprestige, sondern auch Autorität.18 Der Oglala Crazy Horse etwa war nicht nur für seine Meriten im Krieg bekannt, sondern auch für seine Hilfsbereitschaft, mit der er für die ärmeren Familien in seiner Gruppe sorgte.19
Auch ein geschickter Pferdedieb war ein hoch angesehener Mensch, drehte sich doch das Wohl und Wehe der Prärieindianer um den Besitz oder Nichtbesitz von Pferden. Außer auf Kriegszüge gingen sie daher oft auf Beute aus, Pferdediebstahl darf man ohne weiteres als indianischen Volkssport bezeichnen. Trupps, die auf Raubzug gingen, umfassten meist nur einige Krieger.20 Die Crow galten mit durchschnittlich 15 Pferden pro Haushalt als die Reichsten auf den nördlichen Plains, und erhielten deshalb ständig unerwünschten Besuch von Lakota-, Cheyenne-, Arapaho- und Blackfeet-Pferdedieben.21
Nahezu alle Bewohner der Great Plains kannten ein System aus sogenannten Gesellschaften. Diese Zusammenschlüsse sorgten zum Beispiel für die Ordnung im Lager oder organisierten bestimmte Feste. Es gab Gesellschaften für Krieger, für ältere Menschen, für Heiler, für religiöse Angelegenheiten, für Männer und für Frauen, und sie erinnern entfernt an das europäische Zunft- und Gildensystem des Mittelalters und der Frühen Neuzeit.22
Anders als in Europa wurde man in solch ein System aber nicht hineingeboren, und es gab in der Regel keine Sanktionen, wenn man soziale Normen nicht einhielt, solange niemand davon einen Nachteil hatte. Pazifisten, Homo- oder Transsexuelle hatten ihren Platz in diesem Gefüge. Für sie gab es entsprechende Gesellschaften, oder sie gründeten einfach welche. In den halb- oder vollnomadischen Indianervölkern erfüllten die militärischen Gesellschaften eine wichtige Schutzfunktion. Da die Mitglieder einer Familie oft weit entfernt voneinander lagerten, man auf deren Hilfe im Fall eines Angriffs daher nicht immer bauen konnte, waren die jeweils eigenen Gesellschaften eine unverzichtbare Stütze.23 Dabei waren die Gesellschaften nicht streng auf die Angehörigen des eigenen Volks beschränkt. Der Oglala Young Man Afraid Of His Horses zum Beispiel wurde Mitglied in der Crooked-Lances-Gesellschaft der befreundeten Cheyenne.24
BBestimmte Attribute oder Kleidungsstücke kennzeichneten die Mitglieder der Gesellschaften. Eine gebogene Lanze zum Beispiel wies deren Träger als Angehörigen des Speer-Bunds der Arapaho aus,25 eine nach vorn blickende Rabenfigur, die auf dem Hinterhaupt getragen wurde, bezeichnete Mitglieder des Rabenzirkels desselben Volks. Einige Gesellschaften verwendeten Schärpen als Ausweise.26
Der Federschmuck der Prärieindianer stellte eine Symbolsprache dar, die von den Kriegstaten der so Dekorierten erzählten, ähnlich wie Orden beim Militär. Durch den Winkel, in denen sie im Haar steckten oder durch die Art, wie sie bemalt und beschnitten waren, oder durch ihre Anzahl erzählten die Federn Geschichten über ihre Träger. Die bekannte Federhaube war eine Auszeichnung für die ganz Tapferen.27 Natürlich stand es jedem frei, auf derlei Tand zu verzichten. Crazy Horse zum Beispiel trug trotz einer langen Heldentatenliste niemals mehr als eine Feder – schon deshalb, weil eine Vision in seiner Jugend ihn dazu angehalten hatte.28 Und selbst jene, die solche Abzeichen gerne trugen, stolzierten nicht ständig damit umher. Der Oglala Luther Standing Bear, der später Autor und Schauspieler wurde, schrieb:
„Manche weißen Leute haben die Vorstellung, dass die Indianer die ganze Zeit Federn tragen – ich glaube sogar, sie denken, dass wir mit ihnen zu Bett gehen. Wir haben Federn nur getragen, wenn wir uns in Schale warfen – so wie weiße Leute ihre Abendkleider für eine Party oder einen Tanz anziehen.“29
Außerhalb von besonderen Anlässen also hingen die Federhauben, Büffelmützen oder Ähnliches unbeachtet in irgendeinem Winkel des Zelts. So erklärt sich, dass sie mitunter sie in die falschen Hände fielen, wie Charles Eastman schilderte:
„Eines Tages, als man mich kurz ohne Aufsicht gelassen hatte – ich war kaum zwei Jahre alt –, nahm ich die Federhaube meines Onkels und pflückte alle ihre Adlerfedern heraus, um meinen Hund und mich selbst zu schmücken.“30
Die Geschlechterrollen waren zwar relativ klar unterteilt: Frauen dominierten die häusliche Sphäre, Männer die äußere. Im Lauf der Zeit, vor allem nach der Übernahme des Pferds, wurde die männliche Dominanz in den indianischen Gesellschaften stärker. Waren zuvor zum Beispiel Frauen und Männer gemeinsam auf die Jagd gegangen, ritten die Herren nunmehr allein zur Hatz.31 Eine feste Verpflichtung für den Einzelnen oder die Einzelne war das aber nicht. Es gab Frauen, die bei der Jagd oder beim Krieg mitmachten. Insbesondere die Frauen der Cheyenne galten als wehrhaft.32 Charles Eastman berichtete über seine Großmutter:
„Diese mutige Frau hatte einen Trupp von fünf Ojibwa-Kriegern verscheucht. Jene hatten sich dem Zelt vorsichtig genähert, aber ihr [der Großmutters] Hund warnte rechtzeitig, und hinter ihrer Deckung jagte sie unter die Krieger die Ladung einer doppelläufigen Flinte – mit so einem guten Effekt, dass sie es weise fanden, sich zurückzuziehen.“33
Das materielle Leben der Indianer auf den Prärien basierte zum großen Teil auf der Jagd. Vor allem der Bison, der die Prärien in nach Millionen zählenden Herden bevölkerte, war die Grundlage ihrer Existenz. Aus den Häuten dieses Tiers fertigten die Indianer ihre Zeltplanen und warme Roben für den Winter, aus den Knochen kochten sie Leim, aus den Hufen schnitzten sie Löffel. Der Schwanz diente als Fliegenwedel, die Sehnen als Nähgarn, das dicke Leder aus den Nacken der Bullen als Sohlen für Mokassins. So gut wie jedes Teil des Tiers fand Verwendung. Den größten Teil des Fleischs machten die Ureinwohner durch Trocknen oder Räuchern haltbar für den Winter und für Zeiten geringen Jagdglücks.34
Allerdings stimmt es nicht ganz, dass die Ureinwohner nur so viel von der Natur entnahmen, wie sie brauchten, und nichts verschwendeten, wie der Topos erzählt. Eine der Jagdmethoden bestand nämlich darin, eine Bisonherde in Panik zu versetzen und sie über den Rand einer Klippe zu treiben. Auch wenn ein großer Teil des Fleischs konserviert wurde, war es bei einem so durchschlagenden Jagderfolg unmöglich, alles zu verwerten. Der Pelzhändler Alexander Henry kam 1809 im heutigen Alberta zu so einem Abschlachtort. Er schrieb:
„Die Bullen waren überwiegend unversehrt, nur die guten Kühe hatte man zerlegt.“45
So ganz sparsam mit ihren Ressourcen waren Indianer also mitunter nicht, auch wenn sie sich das nur in sehr begrenztem Umfang leisten konnten. Schon aus der Frühgeschichte Nordamerikas kennt man Vergeudungen. Bei Olsen-Chubbock in Colorado fanden Archäologen die Überreste von 200 Steppenbisons, die Paläoindianer vor rund 10.000 Jahren erlegt hatten. Auch hier fanden sich bei vielen Tieren keine Spuren der Verarbeitung.36
1 McMurtry, Larry: Crazy Horse, Berlin 2005, S. 44.
2 Stammel: Legende und Wirklichkeit, S. 218-219.
3 Grinell, George B.: The Cheyenne Indians. War, Ceremonies and Religion, Lincoln/London 1972, S. 2.
4 Taylor: Die Plains, in: ders. et al. (Hg.): Ureinwohner Nordamerikas, S. 67.
5 Eastman, Charles A.: From the deep woods to civilization (1916), Neuauflage, Mineola 2003, S. 1. Auch wenn es nie Ziel indianischer Kriegführung war, Land in Besitz zu nehmen, darf man nicht übersehen, dass dies oft genug die Folge der permanenten Kämpfe war.
6 Beck, Paul N.: Inkpaduta. Dakota Leader, Norman 2014, S. 69.
7 LaPointe: Sitting Bull, S. 35.
8 Die Comanche versengten etwa Teile von Armen und Beinen, amputierten die verbrannten Körperteile und wiederholten diese Prozedur, vgl. Oth, René: Die wahre Geschichte der Indianer. Ursprung, Überlebenskampf, und Alltag der Stämme Nordamerikas, Augsburg 1999, S. 115.
9 McMurtry: Crazy Horse, S. 44-50.
10 Ibid, S. 57.
11 Brown, Dee: Begrabt mein Herz an der Biegung des Flusses, Hamburg 1972, S. 262.
12 Drury, Bob/Clavin, Tom: The Heart of Everything That Is. The Untold Story of Red Cloud, An American Legend, New York 2013.
13 Linderman, Frank B.: Plenty Coups. Chief of the Crows, Lincoln 1962, S. 294-295.
14 Taylor: Die Plains, in: ders. et al. (Hg.): Ureinwohner Nordamerikas, S. 81.
15 Stammel: Legende und Wirklichkeit, S. 279.
16 Brown: Begrabt mein Herz, S. 98.
17 Taylor: Die Plains, in: ders. et al. (Hg.): Ureinwohner Nordamerikas, S. 72.
18 Bungert, Heike: Die Indianer. Geschichte der indigenen Nationen der USA, München 2020, S. 79.
19 McMurtry: Crazy Horse, S. 47.
20 Stammel: Legende und Wirklichkeit, S. 220.
21 Taylor, Colin: Plateaus und Hochbecken, in: ders. et al. (Hg.): Indianer. Die Ureinwohner Nordamerikas – Geschichte, Kulturen, Völker und Stämme, Gütersloh/Köln 1992, S. 102.
22 Stammel: Legende und Wirklichkeit, S. 258.
23 Ibid, S. 258-259.
24 Brown: Begrabt mein Herz, S. 104.
25 Taylor: Die Plains, in: ders. et al. (Hg.): Ureinwohner Nordamerikas, S. 78.
26 Stammel: Legende und Wirklichkeit, S. 81, vgl. ebenso LaPointe: Sitting Bull, S. 33.
27 Stammel: Legende und Wirklichkeit: S. 185.
28 McMurtry: Crazy Horse, S. 47-48.
29 Standing Bear, Luther: My people, the Sioux, Boston/New York 1928, S. 114.
30 Eastman: Boyhood, S. 8, als pdf-Dokument abrufbar unter: http://pinkmonkey.com/dl/library1/digi152.pdf, abgerufen am 3.06.2017.
31 Bungert: Die Indianer, S. 82.
32 Die Schlacht am Rosebud im Jahr 1876 nannten die Cheyenne die „Schlacht, in der das Mädchen seinen Bruder rettete“. In dieser Schlacht kämpften mindestens zwei weitere Frauen mit, vgl. Dull Knife Kollege (Hg.): We, the Northern Cheyenne People, S. 68. Im Fall der Schlacht am Little Bighorn River wenige Tage später sind vier Kombattantinnen namentlich bekannt, zum Beispiel eine Lakota-Frau namens Moving Robe Woman, vgl. Lutz: Who-is-Who, S. 98.
33 Eastman: Boyhood: S. 17, als pdf-Dokument abrufbar unter: http://pinkmonkey.com/dl/library1/digi152.pdf, abgerufen am 3.06.2017.
34 Stammel: Legende und Wirklichkeit, S. 257, vgl. auch Bray, Kingsley M.: Crazy Horse. A Lakota Life, Norman 2006, S. 15.
35 Taylor: Die Plains, in: ders. et al. (Hg.): Ureinwohner Nordamerikas, S. 63.
36 Frison, George C.: Der moderne Mensch in der Neuen Welt, in: Buhrenhult, Göran (Hg.): Menschen der Urzeit. Die Frühgeschichte der Menschheit von den Anfängen bis zur Bronzezeit, Köln 2004, S. 200.