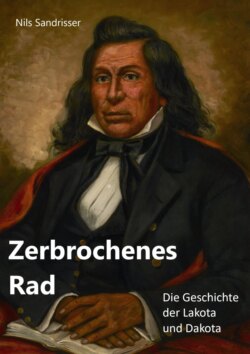Читать книгу Zerbrochenes Rad - Nils Sandrisser - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Vorwort Vorwort: Darf man noch Indianer sagen?
ОглавлениеDas Wort „Indianer“ ruft in uns Bilder wach. Bilder, die die meisten von uns aus Westernfilmen kennen. Vor dem geistigen Auge erscheinen wilde Krieger, das pechschwarze Haar lang und in Zöpfe geflochten, mit Federn darin. Bunt bemalt, mit Lendenschurz und Mokassins. Die typische Szene: Indianer brausen auf scheckigen Pferden auf eine Wagenburg zu und im Kreis um sie herum, schwingen ihre Tomahawks, spannen ihre Bögen. Eine gesichtslose, schreiende Masse aus wilden Reitern, die von den weißen Insassen der Wagen einer nach dem anderen abgeknallt werden.
Das Wort „Indianer“ ruft aber nicht nur Bilder wach, sondern löst auch Assoziationen zu diesen Bildern aus. Im Kopf sitzt das Bild des „edlen Wilden“, einerseits ein harter und wenig zimperlicher Krieger, der keinen Schmerz kennt, andererseits naturverbunden und spirituell. Vergleicht man diese Assoziationen mit jenen, die Europäer von Ureinwohnern aus anderen Erdteilen hatten und haben, ist das sogar nicht unbedingt das schlechteste. Zweifellos wurzelt diese romantische Verklärung in einem schlechten Gewissen und auch darin, dass die Verklärer ihrer eigenen industriellen Zivilisation reichlich überdrüssig sind. In Deutschland hat wohl vor allem Karl May das Bild des Indianers geprägt. Seine Leser glaubten ihm zunächst und übernahmen in ihre Vorstellungen die Geschichten und Figuren, die vor allem seiner Fantasie entsprangen. Aber es war eine durchaus wohlgesinnte Fantasie. Winnetou und viele andere indianische Helden zeichnet Karl May als überaus angenehme Persönlichkeiten, als edle Wilde eben. Das Wort „Indianer“ klingt in der deutschen Sprache daher positiv.
Man darf darüber aber nicht vergessen, dass andere Nationen andere Bilder beim Wort „Indianer“ vor Augen haben. Das Klischee sieht mitunter so aus: Ein Indianer ist eine Elendsgestalt, arm und arbeitsscheu, die würdelos um Whisky bettelt. Im amerikanischen Westen waren es häufig solche Vertreter, die die weißen Siedler zu Gesicht bekamen und mit allen Angehörigen dieser Völker gleichsetzten. Nachvollziehbar, wenn man bedenkt, dass jene Indigenen, die noch ihr traditionelles Leben lebten und diesem Bild nicht entsprachen, sich von den Weißen tunlichst fernhielten. „Indianer“ kann also auch einen abwertenden Beiklang haben. Die meisten der heutigen amerikanischen Ureinwohner lehnen das englische „Indians“ oder das spanische „indios“ als Selbstbezeichnung ab. Sie bevorzugen als Eigenname „Native Americans“, „First Nations“ oder „indígenas“, in jüngster Zeit auch „American Indians“. Hinzu kommt, dass der Begriff „Indianer“ auf dem geografischen Fehlgriff des Christoph Kolumbus beruht, der sich in Indien wähnte und daher die Menschen Indianer nannte, die jene Bahamas-Insel Guanahani bewohnten, auf der er am 12. Oktober 1492 zum ersten Mal amerikanisches Land betrat.
Sprache beschreibt nicht nur die Wirklichkeit, sie formt unsere gefühlte Realität. Je nachdem welches Wort man wählt, transportiert man automatisch Bilder und Assoziationen. Besonders problematisch ist das, wenn es abqualifizierende Bilder und Assoziationen sind. Darum drehte sich vor einigen Jahren die Debatte um die Frage, ob man das Wort „Neger“ aus Otfried Preußlers bekanntem Kinderbuch „Die kleine Hexe“ tilgen müsse, und in mehreren Städten, zum Beispiel in Frankfurt am Main, diskutierte man, ob eine Apotheke heute noch „Mohrenapotheke“ heißen dürfe.
„Neger“ ist noch nie wertneutral gemeint gewesen. Vor allem in der Kolonialzeit bezeichnete es einen Menschen, der kulturell auf so tiefer Stufe stand, dass er geradezu froh sein musste, dass Weiße ihn kolonisierten, ihn regierten und ihn an ihrer Hochkultur teilhaben ließen. Mit anderen Worten: Die rassistische Bezeichnung „Neger“ diente dazu, Unrecht zu rechtfertigen. Das disqualifiziert sie für den wissenschaftlichen und den Alltagsgebrauch. Ob man deswegen unbedingt Werke der Literaturgeschichte umschreiben muss, ist eine andere Frage. Um die soll es hier aber nicht gehen.
Den negativen Beigeschmack, den das Wort „Indianer“ im Englischen hat, hat es im Deutschen nicht. Nun sind positive Fremdzuschreibungen zwar auch nicht ganz unproblematisch, aber „Indianer“ ist eine Vokabel, die man verwenden kann, zumindest in der deutschen Sprache. Denn sie ist hier nicht abwertend gemeint, und da Rassismus immer abwertend ist, ist sie nicht rassistisch. In anderen Sprachen kann das anders sein. Zudem stellt sich die Frage, ob man überhaupt den Begriff „American Indians“, den vor allem die Indigenen der USA aktuell für sich als Eigenbezeichnung nutzen, sinnvoll ins Deutsche übertragen könnte. Im Englischen dient der Begriff zur Unterscheidung zu Indern, die hier ebenfalls „Indians“ heißen. Hingegen ergäbe es im Deutschen wenig Sinn, von „Amerikanischen Indianern“ zu sprechen, denn es gibt ja keine anderen.
Allerdings: Würde man im direkten Gespräch mit einem heutigen Ureinwohner auf dem Begriff „Indianer“ auch dann beharren, wenn er ihm ausdrücklich missfällt, wäre das bestenfalls unsensibel und schlechtestenfalls herablassend.
Wenn man über die Bedeutung von Begriffen räsoniert, muss man sich auch Gedanken über das Wort „Sioux“ machen. Es hat seinen Ursprung in der Ojibwa-Sprache und ist verächtlich gemeint. Auch im Englischen hat der Name „Sioux“ keinen guten Leumund. Kein Wunder, vor allem die Lakota – oder „Teton-Sioux“ – waren harte Opponenten der US-Regierung in mehreren Kriegen. In den 1860er und 1870er Jahren töteten Lakota und Dakota viele weiße Amerikaner. Insgesamt drei Mal musste die US-Armee im Kampf gegen Indianer Niederlagen einstecken, die keiner der beteiligten Soldaten überlebte, und jedes Mal waren Lakota die Gegner. Im Jahr 1868 schafften diese Indianer sogar etwas, was in der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika ohne Beispiel ist: Sie gewannen einen Krieg gegen die US-Armee. Die vernichtende Niederlage, die eine Koalition von Lakota, Cheyenne und Arapaho der US-Kavallerie im Jahr 1876 am Little Bighorn River beibrachte, ist bis heute im kollektiven Gedächtnis der USA tief eingegraben. Wer immer bei solch einem historischen Ereignis auf der Gegenseite steht, trägt automatisch und für immer den Stempel des bösen Buben.
Freilich bezwangen die Indianer die Expansion der Weißen nur für kurze Zeit, einige Jahre später war ihre Niederlage vollständig. Ihre Geschichte ist deshalb so interessant und lehrreich, weil in ihr wie unter einer Lupe viele Faktoren im Kleinen sichtbar werden, die jenen großen Linien entsprechen, die sich so schlimm für die nordamerikanischen Indianer auswirkten.
Selbst im deutschen Idiom kann man sich als Autor nicht darauf zurückziehen, dass die Bezeichnung „Sioux“ hier okay sei. Ist sie nämlich nicht. Ausgerechnet durch Karl May, sonst der Anwalt der roten Völker, ist der Name vorbelastet. Der Schriftsteller hatte sich nämlich dieses Volk als Oberfieslinge ausgeguckt, immer auf Raub und Mord aus. Dem Oglala-Stamm, den er „Sioux-Ogelallah“ nannte, brummte Karl May die literarische Höchststrafe auf: Ihnen gedachte er die unrühmliche Rolle zu, den strahlenden Helden Winnetou zu meucheln.
Die sieben Völker, die in ihrer Gesamtheit den Euroamerikanern als „Sioux“ bekannt waren, nannten sich selbst – je nach Dialekt – Dakota oder Lakota, was so viel bedeutet wie „Freunde“ oder „Verbündete“. Sie haben heute oft „Sioux“ als Eigenname übernommen, zumindest dann, wenn sie sich selbst in englischer Sprache beschreiben. Sie heißen etwa „Standing Rock Sioux Tribe“ oder „Yankton Sioux Tribe“. Gleichwohl haben sie die Eigenbezeichnungen ihrer eigenen Sprache nicht vergessen. Auch wenn die Mehrzahl sie heute nicht mehr spricht, bevorzugen sie für sich die Namen Dakota oder Lakota. Es gibt keinen Grund, sie nicht so zu nennen, jedenfalls außerhalb angeführter Zitate. So viel Respekt sollte man schon haben für die Menschen, über die man schreibt.
Unbegrenzt lässt sich dieses Prinzip aber nicht anwenden – vor allem dann nicht, wenn am Ende ein lesbarer Text herauskommen soll, was einem Journalisten natürlich besonders wichtig ist. Würde man die Cheyenne ebenso konsequent „Tsetsêhestâhese“, die Arapaho „Hinono‘eino“ und die Ojibwa "Anishinabe" nennen, käme ein sperriges, unlesbares Konvolut heraus. Glücklicherweise haben die Fremdbezeichnungen Cheyenne, Ojibwa, Arapaho, Shoshone oder Crow nicht den gleichen despektierlichen Unterton wie das Wörtchen Sioux. Die Nachbarvölker der Lakota und Dakota dürfen in diesem Buch also die Namen weiterführen, unter denen die Welt sie kennengelernt hat.