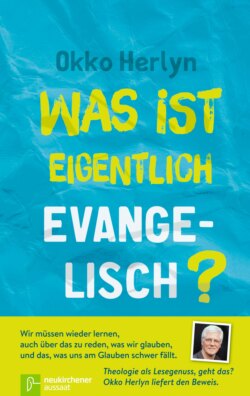Читать книгу Was ist eigentlich evangelisch? - Okko Herlyn - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеVI. Einfach glauben
1. „Manche Sachen, die wir getrost belachen“
Es klingt vielleicht merkwürdig, aber die Antwort auf die Frage, wie man sich denn nun jener guten Botschaft, die einen befreit aufatmen lässt, gegenüber verhalten soll, ist: einfach glauben. Wir müssen es zunächst in der Tat so schlicht sagen. Dennoch ist es sicher ein wenig erklärungsbedürftig, zumal sofort etliche Einwände am Horizont aufflackern. Einfach glauben? Ja, was denn? Wie denn? Weshalb denn? Ist es nicht so, dass wir mittlerweile – Gott sei Dank! – gerade nicht mehr „einfach“ alles glauben, was uns von irgendwoher vorgesetzt wird? Sind wir als aufgeklärte Mitteleuropäer – Gott sei Dank! – nicht längst über den Status religiöser Unmündigkeit hinaus? Geht es nicht gerade auch in einem evangelischen Christentum, das sich doch sonst so viel auf seine Aufgeklärtheit und Rationalität zugute hält, um einen mündigen Glauben, der den vielen Fragen einer modernen Welt einigermaßen standhalten kann? Und jetzt sollen wir als Erstes nichts weiter als einfach glauben?
Gemach. Bevor wir uns in weiteren Empörungen ergehen, müssten wir uns vielleicht einmal in Ruhe über das verständigen, was wir überhaupt unter Glauben verstehen. Da gibt es ja eine Menge verschiedener Ansichten. „Ich glaube nur an das, was ich sehen kann“, lautet eine davon. Gemeint ist offenbar: Für mich ist nur wahr, d. h. real existierend, was ich sehe. Eine seltsame Ansicht, mit Verlaub gesagt. Denn nach dieser Logik müsste man sogleich etwa die Schwerkraft, den Duft einer Rose oder den Wohlklang einer Mozartsonate für nicht-existent erklären.
Halt, könnte ein anderer sagen, das „Sehen“ steht hier ja nur stellvertretend für alle sinnliche Wahrnehmung. Jener Satz meint doch im Kern: Ich halte nur das für wahr und real existierend, was ich überhaupt sinnlich wahrnehmen kann: nicht nur sehend, sondern auch riechend, schmeckend, hörend, fühlend. Biblisch befänden wir uns da übrigens in respektabler Gesellschaft. Als der auferstandene Christus erneut unter seine Jünger tritt, will einer von ihnen, Thomas, das einfach nicht wahrhaben, solange er den Herrn nicht sinnlich erfasst hat: „Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich’s nicht glauben“ (Johannes 20,25). Die Sache mit dem „nur glauben, was ich sehe“, gibt es also scheint’s schon länger und ist mitnichten eine ausschließliche Angelegenheit des aufgeklärten, modernen Menschen von heute.
Doch auch die Logik mit der allgemeinen sinnlichen Wahrnehmung will nicht so recht einleuchten. Kann ich etwa die Richtigkeit des Pythagorassatzes, der für die Berechnung vieler Häuser, Brücken und Maschinen elementar wichtig, also sehr real existierend ist, sinnlich wahrnehmen? Kann ich etwa die Schönheit eines Rilke-Gedichts, die Stringenz eines schlagenden Arguments oder den umwerfenden Witz einer Situationskomik sehen, riechen, schmecken, hören, tasten? Gewiss brauche ich meine Sinne, um ein Gedicht überhaupt lesen oder ein Argument überhaupt hören zu können. Aber die Schönheit eines Gedichts, die Stringenz eines Arguments, der Witz einer Situation – sie alle befinden sich doch offensichtlich noch einmal auf einer anderen Ebene. „Ich glaube nur an das, was ich sehen kann“? Da möchte man doch zunächst einfach mit Matthias Claudius antworten: „Seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsre Augen sie nicht sehn.“
Man könnte sicher noch manch andere „Sachen, die wir getrost belachen“, nur weil wir sie nicht sehen, schmecken oder betasten können, nennen. Auch die Wahrhaftigkeit einer Liebesbekundung, die Tragfähigkeit eines Vertrauensvorschusses oder die Hoffnung auf bessere Verhältnisse können wir nicht einfach sehen, schmecken oder betasten. Sind sie deshalb weniger existent? Weniger wichtig? Weniger bedeutsam für die Gestaltung unseres realen Lebens und unserer realen Welt?
2. Sich vertrauensvoll einlassen
Wenn wir verstehen wollen, was es – zumindest für den evangelischen Glauben – mit „glauben“ auf sich hat, müssen wir vielleicht noch einmal neu anfangen. Und weil wir gelernt haben, dass es für den evangelischen Glauben von grundlegender Bedeutung ist, zunächst einmal die Bibel aufzuschlagen, wollen wir das auch jetzt tun.
Im Alten Testament wird uns z. B. von Abraham erzählt, einem Menschen, der mit seiner Familie, seinem Gesinde und Vieh in Haran wohnt, einer Stadt im Norden. An ihn ergeht das Wort Gottes: „Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will.“ (1. Mose 12,1) Wenig später lesen wir: „Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte.“ (12,4) Wir können fragen: Wie kommt ein Mensch, von dem wir annehmen dürfen, dass er durchaus lebenserfahren ist und seine fünf Sinne beieinander hat, dazu, einfach mir nichts, dir nichts alles stehen und liegen zu lassen und sich in eine völlig ungesicherte Zukunft hinein zu begeben? Verspäteter jugendlicher Leichtsinn oder altersbedingte Verrücktheit? Die Bibel selbst deutet sein Verhalten anders. „Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit.“ (15,6) Wir haben hier eine feine Spur aufgenommen für das, was die Bibel unter „glauben“ versteht. Es ist offenbar ein schlichtes Vertrauen gemeint: Abraham vertraute dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Das macht Sinn, auch wenn der Vorgang mit Sinnlichkeit erst einmal gar nichts zu tun hat.
Hatten wir so etwas Ähnliches nicht schon einmal mit den „Sachen, die wir getrost belachen, weil unsre Augen sie nicht sehn“? Wer beweist mir denn etwa die Wahrheit, Realität und Tragfähigkeit des zu mir gesprochenen Satzes „Ich liebe dich“? Die Wahrheit eines solchen Satzes erweist sich für mich doch nur dann, wenn ich mich auf ihn schlicht – sollen wir sagen: vertrauensvoll? – einlasse. Die Schönheit einer liebenden Beziehung lebt doch ganz und gar von solch einem vertrauensvollen Sich-auf-einander-Einlassen. Wer in einer liebenden oder auch nur freundschaftlichen Beziehung anfängt, zu kontrollieren, etwas abzusichern oder gar zu beweisen, hat im Grunde die Liebe schon zerstört. Der Rest ist – bestenfalls – eine Geschäftsbeziehung.
Wenn wir die kleine Abrahamgeschichte richtig verstanden haben, so scheint es ähnlich auch in der Beziehung zwischen Mensch und Gott zu sein. Unter dem Aspekt der Absicherung oder sinnlichen Beweisführung ist sein Verhalten in der Tat völlig verrückt, um nicht zu sagen verantwortungslos, zumindest seiner Familie gegenüber. Unter dem Aspekt des Sich-Einlassens auf eine liebende Zuwendung indes ist sein Verhalten durchaus nachvollziehbar. Abraham lässt sich ja nicht blindlings auf ein Nichts ein, sondern auf eine ihn zuvor erreichende Zusage: „Ich will dich segnen. Und du sollst ein Segen sein.“ (12,2) Im Vertrauen darauf macht er jenen „verrückten“, aber eben nun doch auch nachvollziehbaren Schritt ins Unbekannte. Es ist wie bei zwei Liebenden, die Ja zueinander sagen. Für Außenstehende vielleicht verrückt. Aber für die Liebenden selbst, die sich nun einmal auf einander eingelassen haben und einander eben vertrauen, womöglich völlig „plausibel“, real und tragfähig.
3. Keine Geschäftemacherei
Die Abrahamgeschichte steht nun gewissermaßen Pate, wenn in der Bibel von „glauben“ die Rede ist. Der Apostel Paulus etwa bezieht sich verschiedentlich ausdrücklich auf ihn (etwa Römer 4, Galater 3, Hebräer 11). Wo Menschen glauben, reagieren sie auf eine sie zuvor erreichende Zuwendung, vertrauen sie einer liebenden Beziehung, die Gott zuvor gestiftet hat und ihnen nun machtvoll zusagt. Und es bleibt dabei: Man kann auch in der Beziehung zu Gott nach Absicherung, nach Beweisen oder sinnlichen Handgreiflichkeiten verlangen oder spöttisch fragen: „Wo ist nun dein Gott?“ (Psalm 42,4) „Glauben“ würde die Bibel das nicht nennen. Man kann sich aber auf Gottes Zusage auch einlassen und seinem Wort schlicht vertrauen. Und ähnlich den Liebenden machen die Menschen in der Bibel – und nicht nur sie – mit solch einem Vertrauen nicht selten ganz neue und durchaus auch wunderbare Erfahrungen.
In späterer Zeit ist dieses Verständnis des Glaubens in der Formel „sola fide“ zusammengefasst worden: „allein durch den Glauben“. Er bezieht sich auf den bereits erwähnten Satz des Apostels Paulus: „So halten wir dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben“ (Römer 3,28). Und nun verstehen wir vielleicht auch, weshalb dieser Satz den Reformatoren so wichtig war. „Sola fide“ war ihnen nämlich das exakte biblische Gegenmodell zu dem Glaubensmodell, das ihnen die römische Kirche der damaligen Zeit bis dahin als das einzig richtige im wahrsten Sinne des Wortes „verkauft“ hatte: Glauben als fromme Leistung. Glauben als religiöse Übung oder gar Opfer. Als mildtätiges Handeln oder auch zahlungskräftige Spende. Als Rosenkranzbeterei, Heiligenverehrung, Reliquienkult, Pilgerfahrt und Selbstentsagung. Paulus würde formulieren: Glauben als „Werk“. Wir könnten auch sagen: als eine geschäftliche Vorleistung für eine nur von der Kirche zu vergebende Ware, eben der Gnade.
Nun verstehen wir vielleicht auch, weshalb gerade an diesem Punkt die Reformatoren so empfindlich reagiert haben. Dieses – damalige römische – Verständnis des Glaubens war für sie nicht nur das exakte Gegenteil, sondern der eklatante Widerspruch, ja die freche Leugnung und brutale Vernichtung dessen, was uns die Bibel als Glauben nahelegt: nämlich das schlichte Vertrauen in Gottes Zusage. „Sola fide“ meint für den evangelischen Glauben also nicht die Flucht in eine religiöse Infantilität, nicht ein nostalgisches Zurück in voraufklärerische Zeiten oder gar Verzicht auf den gesunden Menschenverstand. Es meint die vertrauensvolle Annahme des Evangeliums, das weder erworben noch verdient oder bezahlt, sondern – eben – nur einfach geglaubt werden kann.