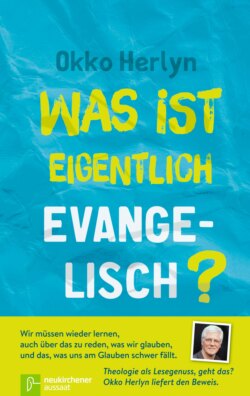Читать книгу Was ist eigentlich evangelisch? - Okko Herlyn - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIV. Einem Anderen angehören
1. „Think pink“?
„Evangelisch“ kommt von „Evangelium“. So weit, so gut. Und es steht der Evangelischen Kirche gewiss nicht schlecht zu Gesichte, wenn sie sich bereits von ihrem Namen her mit eben einer guten Sache identifiziert. Wir haben uns bereits klargemacht, dass es hierbei nicht um irgendeine gute Sache geht. Auch nicht um ein bestimmtes Prinzip, die Dinge des Lebens grundsätzlich positiv zu sehen. So wie uns das ja mittlerweile von allen Seiten gepredigt wird, eben vor allem „positiv zu denken“. Wie viele selbsternannte „positive“ Menschen laufen mittlerweile mit breiter Brust durch die Gegend. Man schämt sich fast schon, wenn man in sich auch gelegentlich noch andere, düstere Seiten oder Stimmungen wahrnimmt. Bezeichnend, dass die altbekannte Begrüßungsfloskel „Wie geht’s?“ mehr und mehr durch ein „Geht’s gut?“ ersetzt wird. Als wenn etwas anderes gar nicht mehr erlaubt sei. Was ist das eigentlich für eine Gnadenlosigkeit, mit der uns allenthalben eingeredet wird, die Dinge vor allem anderen möglichst „positiv“ zu sehen, auch wenn einem mitunter zum Heulen zumute ist? „Think pink“ nennen die Amerikaner diese fast neurotische Zwangsverordnung zum Positiven.
Und nun also auch die Evangelischen mit ihrem programmatischen Namensbezug zum Evangelium, also zu einer eben „guten“ Sache. Religiöse Paten des „Think pink“? Ohne jemanden zu nahe treten zu wollen, kann man bei manchen Christinnen und Christen manchmal fast den Eindruck bekommen. Da liegt so ein seliger Schimmer auf den Gesichtern. So ein fast eingefrorenes Fröhlichsein. Da werden mitunter auffallend rasch ein paar Loblieder in die Saiten geklampft. Auffallend hurtig und beredt Bekenntnisse abgelegt, dass mit dem Evangelium mit einem Mal alles gut geworden sei. Auffallend häufig und unangefochten der liebe „Herr Jesus“ im Munde geführt. Meint das der Evangelist Markus, wenn er das Evangelium unmissverständlich als das „Evangelium von Jesus Christus“ (Markus 1,15) bezeichnet?
2. Die Wahrheit: ein Name
Erinnern wir uns noch einmal an Martin Luther. Überliefert ist die bekannte Szene, die sich im Jahre 1521 auf dem Reichstag zu Worms zugetragen haben soll. Den versammelten Fürsten samt Kaiser widersteht der kleine Mönch Martin mit den Worten: „Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen.“ Lassen wir einmal dahingestellt, inwieweit dieser Satz von Luther selbst gesagt oder ihm zumindest ziemlich glaubhaft in den Mund gelegt worden ist – er ist jedenfalls Ausdruck dessen, dass Luther von etwas überwältigt war. Überwältigt von einer Wahrheit, die einen unverwechselbaren Namen trägt: Jesus Christus. „Ich bin die Wahrheit“, sagt Jesus lapidar (Johannes 14,6). Nur um dieser Wahrheit willen konnte Luther „nicht anders“.
Die grundlegende Wahrheit des Evangeliums also: ein Name. Oder genauer gesagt: eine Geschichte. Die unverwechselbare Geschichte Gottes mit dem Menschen, wie sie in der Person Jesu Christi anschaulich geworden ist. Die Erkenntnis war zu Zeiten Luthers deshalb nicht selbstverständlich, weil er sich einer Institution gegenübersah, nämlich der Römischen Kirche, die von sich aus beanspruchte, die Wahrheit gepachtet zu haben, und die deshalb meinte, diese Wahrheit machtvoll und wohldosiert verteilen zu können: durch verordnetes Denken, durch Sakramentsverwaltung, durch vorgeschriebene Frömmigkeitsformen, durch repressive Bußpraktiken und einträglichen Ablasshandel. Die Kirche des späten Mittelalters war für Luther zu einem unterdrückerischen System verkommen, mit dem sie sich selbst an die Stelle der Wahrheit und also an die Stelle Christi zu setzen versuchte. Was Wahrheit zu sein hatte, war von Rom bestimmt und deshalb oft am Ende ziemlich genau das, was der Kirche ideologisch, politisch und auch materiell nützte. Dagegen Luthers grundlegende Entdeckung, wie man sie später auf die bündige Formel brachte: „Christus allein“. Lateinisch: „solus Christus“.
Christus allein. Zwei unscheinbare Wörtchen. Und doch merken wir, welch ungeheure Gewalt, ja geradezu Kampfansage seiner Zeit in ihnen steckte. Christus allein die Wahrheit, das hieß dann ja: den Wahrheits- und Machtanspruch der Heiligen Kirche in Frage stellen. Das hieß dann ja: sich auf eine Konkurrenz einlassen, sich auf einen Kampf vorbereiten. Um der Wahrheit willen Autoritäten vom Sockel stürzen. War Martin Luther besonders mutig? Wir wissen es nicht so genau. Was wir von ihm persönlich wissen, ist eher, dass er oft ziemlich verzagt und angefochten war. Die Kraft, Kaisern, Königen und Päpsten zu widerstehen, kam ihm offensichtlich nicht von einem ihm sozusagen in die Wiege gelegten Temperament her, sondern von der ihm geschenkten Gewissheit: Christus allein. Nur deshalb konnte er offenbar nicht anders.
3. Ein mitunter brisantes Bekenntnis
Welche Bedeutung hat die Erinnerung an diese grundlegende Erkenntnis der Reformation für die Evangelische Kirche heute? Für eine Kirche, die mittlerweile nun doch in einer sehr anderen Zeit lebt. Das feindliche Gegenüber zur Römischen-Katholischen Kirche ist ja – Gott sei es gedankt – lange vorbei. Auch wenn etwa Papst Benedikt XVI. noch vor nicht allzu langer Zeit der evangelischen Kirche das Kirchesein „im eigentlichen Sinn“ rundweg abgesprochen hat. Aber sonst scheint weit und breit niemand in Sicht, der die Wahrheit gepachtet zu haben meint, dem man nun also in neuer Weise das „Christus allein“ entgegenschleudern müsste. Im Gegenteil: Wir leben inzwischen doch eher in einer Gesellschaft, in der es überhaupt keine – und schon gar keine alleinige – Wahrheit mehr zu geben scheint. Was wahr und richtig ist, hat in Zeiten der Pluralisierung jeder für sich zu entscheiden. „Was Gott ist, bestimme ich“, titelte vor Jahren eine psychologische Zeitschrift.
Demgegenüber meint „Solus Christus“ schlicht und einfach: Was Gott ist, bestimme nicht ich, sondern einzig und allein Gott selbst. Und was sich als herrliche Wahlfreiheit („Was Gott ist, bestimme ich“) aufplustert, könnte sich am Ende womöglich als üble Tyrannei entpuppen, die den Menschen in eine heillose Überforderung und Einsamkeit stürzt. Es könnte doch befreiend sein zu wissen, dass die Wahrheit mir vorgegeben ist, dass ich sie gerade nicht ständig neu erfinden muss, dass ich mich auf sie verlassen kann, wie ein Kind sich auf die Liebe der Mutter verlässt, die es ja auch nicht ständig neu erfinden und für sich konstruieren muss. Nicht umsonst bezeichnet der Heidelberger Katechismus diese Gewissheit, „mit Leib und Seele im Leben und im Sterben“ nicht sich selbst, sondern einem anderen, eben Jesus Christus anzugehören, als „Trost“. Ich wüsste jedenfalls dafür weit und breit kein besseres Wort.
Wenn sich also die Evangelische Kirche auch heute noch der Wahrheit des „Christus allein“ verpflichtet weiß, dann nicht um eines Prinzips der religiösen Intoleranz willen. Sondern einzig um der Erkenntnis willen, dass es – gerade auch für den heillos und grausam auf sich selbst zurückgeworfenen modernen Menschen – im Tiefsten heilsam ist, sich einer anderen Wahrheit, einer anderen bergenden Macht, einer anderen Liebe anzuvertrauen. Mit dieser grundlegenden Botschaft wird sich die Evangelische Kirche heute sicher nicht überall Freunde machen. Aber das hatten wir ja schon einmal mit der Erinnerung an Martin Luthers „Ich kann nicht anders“. Unbeugsamkeit kann manchmal eben auch ihr Gutes haben.
Welche geradezu politische Brisanz das „Christus allein“ bekommen kann, wird an einer anderen historischen Erinnerung deutlich. Im Jahr 1934 formulierten die Mitglieder der sogenannten „Bekenntnissynode“ zu Barmen: „Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben.“ Diese Aussage war damals insofern besonders brisant, weil weite Teile gerade auch der Evangelischen Kirche der Meinung waren, man könne Gottes Wort und Willen auch woanders als in Jesus Christus erkennen, etwa in bestimmten geschichtlichen Ereignissen, namentlich im Aufkommen des Nationalsozialismus und in der Person des „rettenden“ Führers. Dagegen das Barmer Bekenntnis: „Jesus Christus … ist das eine Wort Gottes.“ Damals bedeutete das: den Wahrheits- und Machtanspruch „anderer Ereignisse und Mächte, Gestalten und Wahrheiten“, wie es in dem Bekenntnis weiter hieß, in Frage stellen. Genau diesen Anspruch erhob aber der NS-Staat. Nur so ist es überhaupt nachzuvollziehen, dass die „Bekennende Kirche“, selbst wenn sie sich politisch weithin loyal verhielt, von der Gestapo bespitzelt wurde. Manch ein treuer Prediger dieser urevangelischen Wahrheit wanderte allein deshalb hinter Gitter oder bezahlte gar mit seinem Leben.
Das Bekenntnis zu Jesus Christus als dem „einzigen Trost im Leben und im Sterben“ ist mitunter doch noch etwas anderes, Brisanteres oder gar Gefährlicheres als eine heruntergeleierte religiöse Floskel. Christen im Irak, im Iran, in Syrien, Nordkorea, Eritrea oder auch nur in manchen Teilen der Türkei wissen ein leidvolles Lied davon zu singen. Ihre Gewissheit, zu Jesus Christus zu gehören, hat nun so gar nichts mit „think pink“ zu tun. Wohl aber mit einem Wissen darum, dass das „Gute“ des Evangeliums vielleicht noch woanders zu suchen ist als in jener verbreiteten Selbstverordnung, die Dinge immer und vor allem erst einmal „positiv“ zu sehen.