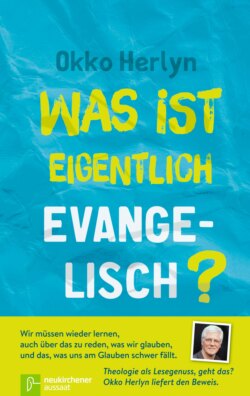Читать книгу Was ist eigentlich evangelisch? - Okko Herlyn - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеV. Befreit aufatmen
1. Ein merkwürdiger Eindruck
„Evangelisch“ kommt von „Evangelium“, also einer guten Botschaft. Manche übersetzen das griechische Ursprungswort „gut“ auch mit „froh“ oder gar „froh machend“. Schön, wenn sich evangelische Christinnen und Christen schon mit ihrem Namen an etwas „Gutem“, „Frohem“ oder gar „froh Machendem“ orientieren. Dass das wenig mit jenem penetranten Zwang zum „positiven Denken“ zu tun hat, haben wir geklärt. Dennoch bleibt die Frage offen, was an dem Evangelium von Jesus Christus eigentlich gut bzw. froh oder sogar froh machend ist. Zumal nicht jeder Christenmensch den Eindruck erweckt, von einer guten oder froh machenden Sache überzeugt oder gar durchdrungen zu sein. Schon vor Jahren spottete der Liedermacher Franz-Josef Degenhardt:
„Da treten sie zum Kirchgang an,
Familienleittiere voran,
Hütchen, Schühchen, Täschchen passend,
ihre Männer unterfassend,
die sie heimlich vorwärts schieben,
weil die gern zu Hause blieben.
Und dann kommen sie zurück
mit dem gleichen bösen Blick.“
Ein Konfirmand antwortet auf die Frage, was das Christentum sei: „Alles, was man nicht darf“. Wie kommt der junge Bursche dazu? Ist das Evangelium vielleicht doch gar keine so „gute“ und „froh machende“ Botschaft, wie behauptet wird? Oder liegt es nur an den unfrohen, muckerigen und zwanghaften Boten dieser Botschaft, also den Christinnen und Christen, dass jene Botschaft so unfroh „rüberkommt“? Immerhin meinte bereits der Philosoph und Sohn eines evangelischen Pfarrers, Friedrich Nietzsche, sich über die Christen seiner Zeit mit den berühmt gewordenen Worten auslassen zu müssen: „Bessere Lieder müssten sie mir singen, dass ich an ihren Erlöser glauben lerne: erlöster müssten mir seine Jünger aussehen!“ Christentum als großes unfrei und unfroh machendes „Muss“, eben „alles, was man nicht darf“. Norbert Alich und Jürgen Becker, zwei Kölner Kabarettisten, haben in dieser Sache zudem einen wichtigen Unterschied zwischen katholisch und evangelisch ausgemacht, wenn sie zum Karneval singen:
„Ich bin so froh, dass ich nicht evangelisch bin,
die haben doch nichts anderes als arbeiten im Sinn.
Als Katholik, da kannste pfuschen, dat eine is gewiss:
am Samstag gehste Beichten und fort ist der ganze Driss!“
In der öffentlichen Wahrnehmung regiert offenbar der merkwürdige Eindruck, dass Christsein – zumal evangelisches – und Fröhlichsein doch eher zweierlei sei. „Sie sehen gar nicht wie ein Pastor aus“ – diesen Satz hörte ich in den Anfangsjahren meines Pfarrdienstes mehr als einmal bei Hausbesuchen. Abgesehen von der darin steckenden kleinen Schmeichelei lebte diese Äußerung aber vor allem von der allgemeinen Anschauung: Die Kirche hat es doch vor allem mit dem Ernsten und Schweren statt mit dem Frohen und Leichten. Als vor einigen Jahren in der Dortmunder Reinoldikirche eine große öffentliche Trauerfeier für drei im Dienst ermordete Polizistinnen stattfand, war tags darauf in der Zeitung zu lesen: „Reinoldikirche. Hierhin kommt Dortmund, wenn es trauert. Hier versucht die Kirche zu geben, was der Kirche ist.“
Die Kirche, so die öffentliche Wahrnehmung und Erwartung, ist doch eher an den dunklen Seiten des Lebens orientiert. Dem entspricht der gerne von politischer Seite der Kirche erteilte Rat, sie solle sich doch gefälligst auf die Seelsorge am einzelnen Mühseligen und Beladenen beschränken. Gemeint ist hier in der Regel: sich aus politischen und gesellschaftlichen Konflikten möglichst heraushalten. Die Kirche solle bitteschön nur das geben, was – angeblich – nur der Kirche ist: nämlich den Betrübten und Trauernden Trost zusprechen. Das alles klingt nicht eben nach einer froh machenden Botschaft.
Aber was mag es dann sein, das den Evangelisten Markus und mit ihm viele andere die Botschaft von Jesus Christus als „gut“ und „froh machend“ bezeichnen lässt?
2. Luthers Entdeckung
Wir erinnern uns: Martin Luthers Widerstand gegen Papst und Kaiser beruhte auf der Überzeugung, von einer anderen Wahrheit zu wissen als der, die ihm und nicht nur ihm von Seiten der damaligen Römischen Kirche entgegentrat. Vielleicht wäre die Wahrheitsverwaltung dieser Kirche für ihn noch angegangen, wenn es denn wirklich die Wahrheit gewesen wäre, die man dort zu verwalten meinte. Aber für Luther verwaltete die Kirche im Kern gar nicht die Wahrheit, sondern die Unwahrheit. Die Unwahrheit nämlich, dass der Mensch vor Gott Anerkennung fände aufgrund seiner guten Werke. Übrigens eine bis heute überaus populäre Unwahrheit, wenn man nur einmal auf das gerade in der Evangelischen Kirche so verbreitete Gutmenschentum sieht. Luther seinerzeit sah diese Unwahrheit konkret vor Augen in der Beicht- und Bußpraxis, im Ablasshandel, im Vollzug des Abendmahls als eines vermeintlichen Opfers, in der Marien-, Heiligen- und Reliquienverehrung, in Prozessionen und Wallfahrten, in Fasten und Almosengeben. Für ihn allesamt Versuche, sich vor Gott ein Verdienst zu erwerben, sich ihm gewogen zu machen, mit ihm gewissermaßen ins Geschäft zu kommen.
Dagegen Luthers Bahn brechende Entdeckung in der Bibel: „So halten wir dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben“ (Römer 3,28). Mit „Glauben“ ist dort bei Paulus nicht irgendeine Religiosität gemeint, sondern der Glaube daran, dass „wir ohne Verdienst gerecht werden aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist“ (3,24). Der Unwahrheit, dass wir vor Gott dadurch gerecht, also von ihm anerkannt und angenommen werden, indem wir uns mit guten und frommen Taten abrackern, dieser Unwahrheit tritt Luther mit der biblischen Wahrheit entgegen, dass das alles überflüssig, ja geradezu kontraproduktiv ist, weil Christus durch seine Gnade bereits dafür gesorgt hat, dass wir vor Gott gerecht dastehen, von ihm anerkannt und angenommen sind. Deshalb die spätere protestantische Parole: allein aus Gnade! Lateinisch: sola gratia. Die Gerechtsprechung des Menschen vor Gott durch Christus sozusagen „gratis“.
Eine Bahn brechende Entdeckung. Genauer: Wiederentdeckung. Denn Luther hatte diese Wahrheit ja nicht bei einer Zen-Meditation oder während eines Waldspaziergangs gemacht, sondern eben aus der Heiligen Schrift gewonnen. Eine wahrhaft andere Wahrheit mit einem völlig anderen Namen, eben: „Evangelium von Jesus Christus“. Anders deshalb, weil diese Wahrheit für ihn nun so gar nichts mehr mit Drohung, Angstmache oder „allem, was man nicht darf“, zu tun hatte. Wohl aber mit einem befreiten Aufatmen und einer „großen Freude“, wie es im Weihnachtsevangelium heißt (Lukas 2,10). „Evangelium heißt eine freundliche Lehre und eine tröstliche Botschaft“, sagt Luther. „Wie wenn ein reicher Mann einem armen Bettler tausend Gulden zusagte. Das wäre ihm ein Evangelium, eine fröhliche Botschaft, die er gern hören und von Herzen fröhlich darüber würde.“ Man geht nicht fehl, in dieser Wiederentdeckung des Evangeliums als einer rundweg guten und erfreulichen Botschaft den Anfang und bleibenden Grund der Evangelischen Kirche zu sehen.
3. Ein empfindlicher Nerv
Lange hat man gemeint, die reformatorische Erkenntnis von der Gerechtsprechung des Menschen „ohne des Gesetzes Werke“ sei etwas von vorgestern. Sei eine Wahrheit, die schon in ihrer ganzen Wortwahl so sehr dem 16. Jahrhundert verhaftet sei, dass sie deshalb dem Menschen von heute nicht mehr zu vermitteln sei. Wer glaube denn heute noch an einen zur Rechenschaft ziehenden Gott? Wer habe denn heute noch das Problem, das Luther umgetrieben habe, eben die Frage: Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wer denke denn heute noch ernsthaft in den Kategorien von Schuld und Sühne, Unrecht und Rechtfertigung?
Aber Vorsicht. Nur weil uns eine bestimmte Begrifflichkeit fremd geworden ist, muss die damit gemeinte Sache noch lange nicht erledigt sein. In der Sache hat das „sola gratia“ eine erstaunliche Aktualität. Es mag sein, dass der Mensch von heute sein Leben nicht mehr wie der Mensch zu Luthers Zeiten vor Gott zu rechtfertigen versucht. Es mag sein, dass da an die Stelle Gottes inzwischen andere Instanzen getreten sind: die Gesellschaft, das Milieu, das, was „man“ zu tun oder zu lassen hat, die Erwartungen anderer oder die eigenen Moralvorstellungen oder Lebenskonzepte. Es mag da mittlerweile viele Götter und Göttinnen geben, die unser Leben bestimmen. Und auch sie fordern von uns reichlich Tribut, reichlich Opfer, reichlich „Werke“: sei es meinen sozialen Status, sei es meine bürgerliche Rechtschaffenheit, sei es mein Sympathisch-, Schön-, Gesund-, Erfolgreich-, Humorvoll- oder sonst wie Attraktivsein. Von all dem hängt doch immer noch massiv ab, ob ich anerkannt, akzeptiert, „okay“ – in der Sprache des 16. Jahrhunderts „gerechtfertigt“ – bin: vor den anderen, vor mir selbst, vor irgendwelchen Glücksmaximen oder sonst welchen Göttern, an denen, wie Luther sagt, „mein Herz hängt“.
„Sola gratia – allein aus Gnade“, das trifft einen empfindlichen Nerv des heutigen Menschen, der zuhöchst von seiner Selbstinszenierung lebt, von dem, was er eben aus sich und seinem Leben „macht“. „Sola gratia“ wirft uns zurück auf die nüchterne, aber eben vielleicht auch befreiende Erkenntnis, dass wir – nicht vor den selbstgemachten modernen Götzen, wohl aber – vor Gott präzise nichts tun müssen, um seine Gunst zu erwerben. Es ist ein tiefes, befreiendes Aufatmen, das von dieser reformatorischen Erkenntnis über die Jahrhunderte hinweg noch zu uns herüberweht. Gott sei Dank muss ich einmal nichts tun. Gott sei Dank kann ich mir einmal einfach etwas schenken lassen. Gott sei Dank bin ich den Stress los, immer gut dastehen, immer etwas vorweisen, immer etwas aus mir und meinem Leben machen zu müssen.
„Sola gratia – allein aus Gnade“ – was für eine wichtige, befreiende Botschaft, die da der christlichen Gemeinde anvertraut ist, gerade heute, in Zeiten, in denen die Parolen von einem auf Deubel-komm-raus „gelingenden Leben“, die Parolen von „Hauptsache Spaß“, „Hauptsache gesund“, „Hauptsache Erfolg“ inzwischen zu Tyrannen geworden sind, unter denen Menschen zusehends leiden, auch wenn ihre Keep-smiling-Masken etwas anderes weismachen wollen. „Sola gratia – allein aus Gnade“ – es könnte sein, dass gerade der Mensch von heute, dieser freudlose Sklave seiner eigenen Selbstinszenierung, im Tiefsten nach nichts anderem so sehr hungert und dürstet wie nach dieser Zusage: Ich bin angenommen und geliebt – „ohne des Gesetzes Werke“, ohne irgendeine Vorleistung, umsonst. Gratis. Sola gratia.
Und: Was für eine wunderbare, wichtige Aufgabe für eine evangelische Gemeinde heute, diese wahrhaft gute Botschaft mit Leidenschaft, Engagement und Fantasie unters Volk zu bringen.