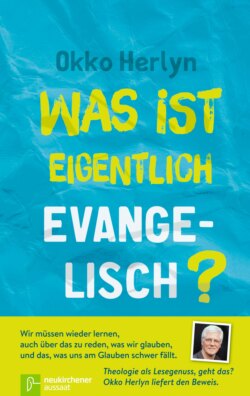Читать книгу Was ist eigentlich evangelisch? - Okko Herlyn - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеI. Was ist eigentlich evangelisch? Gute Frage
1. „Dann geht’s ja noch“
Wir schreiben das Jahr 1971. Wieder einmal bin ich per Anhalter unterwegs. Von Wesel, meinem damaligen Heimatort am Niederrhein, nach Tübingen, meinem Studienort im Schwäbischen. Zum Teil, weil in jenen Zeiten das Geld wie immer ein wenig knapp ist. Zum Teil aber auch, weil „Trampen“ immer so ein wenig den Hauch des Abenteuerlichen hat. In Höhe Bruchsal hält endlich ein Opel Rekord. Ein freundlicher Vertreter Richtung Stuttgart. Immerhin. Wahrscheinlich nimmt er mich mit, weil ihm ein wenig langweilig ist. Schon nach ein paar Minuten sind wir im Gespräch. Was ich denn so machen würde. „Studieren.“ „Aha. Und was, wenn man fragen darf?“ „Theologie.“ „Katholisch oder evangelisch?“ „Evangelisch.“ „Na, dann geht’s ja noch.“
Ich weiß nicht, wie oft in meinem Leben ich solche Dialoge – zum Teil wörtlich – geführt habe. Offenbar sind allein die Stichworte „katholisch“ und „evangelisch“ mit bestimmten festen Vorstellungen verbunden. Katholisch – das ist doch vor allem konservativ, mittelalterlich im Denken, hierarchisch, männerdominiert, moralisierend, sexualfeindlich, rituell erstarrt, politisch eher Mitte-Rechts. Die Kirchen: viel zu viel Prunk und Protz. Und vor allem: „Die Priester, die dürfen ja nicht heiraten.“ Furchtbar. – Evangelisch – das ist dagegen doch viel moderner, aufgeklärter, demokratischer, lebenszugewandter, emanzipierter, in Sexualfragen freier, politisch eher links-liberal. Die Kirchen: wohltuend nüchterner und bescheidener. Und vor allem: „Bei euch dürfen ja auch die Pfarrer heiraten.“ Außerdem muss man als Protestant zum Glück nicht jeden Sonntag in die Kirche rennen wie bei den Katholiken. Irgendwie scheint es bei den Evangelischen alles nicht so sehr drauf anzukommen. „Katholisch oder evangelisch?“ „Evangelisch.“ „Na, dann geht’s ja noch.“
Was katholisch ist, mögen andere beantworten. Aber was ist eigentlich evangelisch? Stimmt das überhaupt, dass man hier „alles nicht so eng sieht“? Und wie ist das: Was haben die eigentlich statt des Papstes? Oder wer sagt sonst, wo es langgeht? Gibt es hier auch so etwas, das man „glauben muss“? Warum haben die keine Beichte? Ist Konfirmation so etwas Ähnliches wie Kommunion? Was ist mit Ehe, Pille, Fasten und Karneval? Oder kann hier jeder glauben und machen, was er will? – Tja, was ist eigentlich evangelisch? Gute Frage.
2. Sich auf die Suche machen
Ich erinnere mich an eine Begegnung mit einer Gruppe von Muslimen. Ein paar Tage zuvor hatten bereits einige aus unserer Gemeinde als Gäste am Freitagsgebet der benachbarten Moschee teilgenommen. Nun stand der Gegenbesuch von Seiten der Muslime in unserem Gemeindehaus an. Nach dem Gottesdienst, an dem die kleine Gruppe muslimischer Männer auch teilgenommen hatte, kommt es zu einem Gespräch im Kirchencafé. Beide Seiten sollen einmal in Kürze sagen, was das Wesentliche ihres Glaubens ist. Die muslimische Seite ist damit rasch durch. Kurz und bündig zählen sie die berühmten „fünf Säulen“ des Islam auf: das Bekenntnis zu dem einen Gott und seinem Propheten Mohammed, das tägliche Gebet, der Ramadan, das Almosengeben und die Wallfahrt nach Mekka. Nun ist unsere Seite an der Reihe. Doch da wird es schon wesentlich einsilbiger. Kann man das überhaupt: in ein paar Sätzen sagen, was evangelisch ist?
Ja, gewiss, irgendwann haben wir einmal im Konfirmandenunterricht etwas gelernt: die 10 Gebote, das Glaubensbekenntnis, das Vaterunser, die eine oder andere Liedstrophe. Als sozusagen „eiserne Ration“ eines Christenmenschen. Im Laufe des Lebens sind einem womöglich die verschiedensten biblischen Texte begegnet: Geschichten, Gleichnisse, Psalmen oder auch nur einzelne Verse – etwa als Tauf-, Konfirmations- oder Trauspruch. Aber irgendwie ist dabei vielleicht der Blick für das Ganze verloren gegangen, für den Kern, den oder die zentralen Inhalte des evangelischen Glaubens.
Neidisch blicken wir dann manchmal womöglich auf andere Frömmigkeitsformen oder gar Religionen, in denen uns Menschen begegnen, die anscheinend sehr viel genauer, sehr viel rascher, klarer und selbstbewusster sagen können, was sie glauben. Menschen, die ihre religiösen Formulierungen, manchmal vielleicht auch nur ihre Formeln abrufbar parat zu haben scheinen. Und mit ihren klaren Formeln auch meist ein klares Weltbild zur Hand haben. Ein Weltbild, in dem es eindeutige Grenzen gibt, etwa zwischen wahr und unwahr, richtig und falsch, gut und böse. Und wo so etwas wie Unsicherheit im Glauben, so etwas wie Zweifel oder Anfechtung gar nicht vorzukommen scheint. Ja, man mag da als schlichter evangelischer Christenmensch manchmal regelrecht neidisch werden.
Ich muss allerdings gestehen: Mich überzeugen solche Glaubenshaltungen, die mit breiter Brust daherkommen, wenig. Mich beeindrucken mehr die Menschen, die auch und gerade in ihrem Glauben Fragende bleiben. Menschen, die den Zweifel und die Anfechtung nicht als einen Feind ansehen, sondern als einen Teil ihres Glaubens akzeptieren. Ich würde mich gerne mit solch einer fragenden und suchenden Haltung auf den Weg machen, wenn es darum geht, was eigentlich evangelisch ist.
Und wie das so ist, wenn man sich auf den Weg macht und sich vielleicht noch ein wenig unsicher fühlt, dann ist es gut, wenn man einen kompetenten Begleiter hat, der sich besser auskennt. Das sollen für uns vor allem die „Väter“ des evangelischen Glaubens, die Reformatoren, sein: Luther, Calvin und wie sie alle hießen. Ihre Namen stehen ja seit der Reformation für ein spezifisch protestantisches „Profil“, wie man heute gerne sagt. Worum ging es ihnen überhaupt – etwa in Abgrenzung zur damaligen römischen Kirche? Und: Was können wir heute in einer völlig veränderten Welt noch mit ihren Einsichten anfangen? Wir leben doch mittlerweile in ganz anderen gesellschaftlichen Verhältnissen, in ganz anderen Denkweisen und mit ganz anderen wissenschaftlichen Erkenntnissen als zu Zeiten der Reformation, also des 16. Jahrhunderts. Auch diese Fragen werden uns zu beschäftigen haben. Ob das immer in knappen fünf Sätzen gelingt, sei allerdings dahingestellt.
3. Keine Nostalgie
Beim Stichwort „Reformation“ fällt uns vielleicht als erstes Martin Luthers berühmter Satz „Hier stehe ich, ich kann nicht anders“ ein. Dumpf dringen die Worte des großen Reformators über die Jahrhunderte hinweg an unser Ohr. Vielleicht stehen wir gerade vor dem berühmten Lutherdenkmal in Worms und blicken ehrfürchtig an der erhabenen, in Gussstahl gegossenen überlebensgroßen Figur empor. Vielleicht waren wir seinerzeit in dem überraschend erfolgreichen Luther-Film und erinnern uns der eindrucksvollen Szene, in der der kleine Mönch aus Wittenberg 1521 auf dem Reichstag zu Worms Kaisern und Königen ins Gesicht hinein tapfer widersteht. Vielleicht denken wir auch zurück an die eine oder andere Religionsstunde, in der uns von einer jungen, eifrigen und erzählbegabten Lehrerin die großen Heldentaten der Väter im Glauben nahegebracht wurden. „Hier stehe ich, ich kann nicht anders.“ Diese Worte sind seit vielen Generationen verbales Markenzeichen des Protestantismus. Protestantismus, so haben wir es gelernt, das hat etwas mit Protest zu tun, mit Rückgrat und Zivilcourage, mit einem Einstehen für die Wahrheit und einer unbedingten Bindung an das Gewissen, mit Unbeugsamkeit und Prinzipientreue.
Wer sich allerdings ein wenig mit der Geschichte der Reformation beschäftigt, merkt bald, dass es sich bei jenem berühmten Satz zu Worms nicht um eine allgemein menschliche oder gar typisch protestantische Tugend handelt. Unbeugsamkeit als solche ist noch kein evangelisches Markenzeichen. Einfach „nicht anders zu können“ kann auch Ausdruck von Unbelehrbarkeit, von innerer Starre, von geistiger Enge und unerträglicher Borniertheit sein. Martin Luther aber konnte nicht deshalb „nicht anders“, weil er nun einmal so ein Dickschädel war, sondern weil er von etwas Anderem, genauer: einem Anderen ergriffen worden war. „Hier stehe ich, ich kann nicht anders“, das heißt nämlich im Kern: Ich weiß von einer anderen Wahrheit als der, die mir täglich drohend entgegentritt. Nur um jener anderen Wahrheit – nennen wir sie beim Namen: nur um Jesu Christi willen – und nicht um eines Prinzips des Neinsagens willen galt es und gilt es vielleicht auch heute noch, „nicht anders zu können“.
Wir wollen versuchen, uns jene Wahrheit, die sich die Reformatoren – und nicht nur sie – ziemlich viel haben kosten lassen, noch einmal in Ruhe vor Augen zu führen. Nicht aus einer protestantischen Nostalgie heraus. Nicht um die Geschichte unserer Kirche zu verklären. Und schon gar nicht um einer evangelischen Selbstbeweihräucherung willen. Sondern um herauszubekommen, welche Erkenntnisse von „damals“ auch heute noch für uns eine Botschaft bergen. Für uns, die wir ja mittlerweile in einer völlig gewandelten Welt leben. Historische Rückblicke sind schön und gut. Aber wenn sie nicht zu uns zu „sprechen“ beginnen, bleiben sie totes Wissen, allenfalls Hobby für ein paar geschichtlich Interessierte. Die Evangelische Kirche – so viel sei bereits jetzt verraten – lebt aber zentral davon, dass in ihr etwas lebendig ist und sich in der Gegenwart unmissverständlich bemerkbar macht. Egal, ob im Kleinen oder Großen.
Doch eins nach dem anderen.