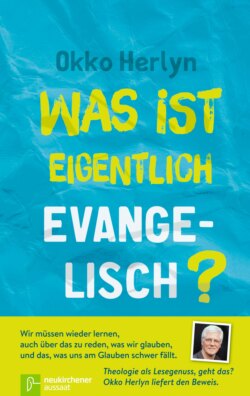Читать книгу Was ist eigentlich evangelisch? - Okko Herlyn - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеII. „Evangelisch“ kommt von „Evangelium“
1. Ein paar Worterklärungen
Was ist eigentlich evangelisch? Man könnte es sich leicht machen und einfach ein schlaues Fremdwörterbuch aufschlagen. Da würden wir dann erfahren, dass das Wort „evangelisch“ von dem lateinischen Wort „Evangelium“ abstammt, das wiederum eine Übersetzung des griechischen Ursprungswortes („euangellion“) ist. „Evangelium“ bedeutet wörtlich übersetzt: „gute Botschaft“.
Das Wort „Evangelium“ kommt vor allem im Neuen Testament vor. Es meint dort durchweg die Botschaft von Jesus Christus. So beginnt z. B. Markus seinen Bericht mit den Worten: „Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus“ (Markus 1,15). Er verwendet hier das Wort „Evangelium“ offenbar deshalb, weil er der Meinung ist, dass es sich bei dieser Botschaft eben um eine „gute“ handelt. Auch die anderen drei neutestamentlichen Autoren, die einen Bericht über Jesus Christus abliefern, also Matthäus, Lukas und Johannes, verstehen ihre Botschaft grundsätzlich als Evangelium, weshalb wir die Berichte dieser vier Autoren auch selbst jeweils als „Evangelium“ und sie selbst als „Evangelisten“ bezeichnen. Im Inhaltsverzeichnis eines Neuen Testaments finden wir dementsprechend das Matthäus-, das Markus-, das Lukas- und das Johannesevangelium.
Genau genommen bezeichnet das Wort „Evangelium“ also zweierlei. Einmal meint es grundsätzlich die gute Botschaft von Jesus Christus. Und zum anderen meint es die literarische Gattung, in der die neutestamentlichen Autoren Matthäus, Markus, Lukas und Johannes ihre Berichte über Jesus Christus verfassen. Literaturwissenschaftler weisen darauf hin, dass es sich bei der Gattung „Evangelium“ um etwas ganz Einmaliges, geradezu um ein Unikum handele. Nirgendwo sonst in der Weltliteratur komme diese spezielle literarische Form vor. Vielleicht ein erstes Anzeichen dafür, dass es sich bei dem Inhalt, den diese Form birgt, nämlich der Botschaft von Jesus Christus, in der Tat um etwas Einmaliges handelt?
Jedenfalls begegnet uns in diesem, also dem literarischen Sinne das Wort „Evangelium“ z. B. im Gottesdienst, wenn es dort heißt, nun folge die „Evangeliumslesung“. Gemeint ist, dass nun ein Text aus den vier Evangelien vorgelesen wird. Davon unterschieden ist dann etwa die alttestamentliche Lesung oder die „Epistellesung“. Das Wort „Epistel“ stammt von dem griechischen Wort „Epistolä“ und bedeutet „Brief“. Bei einer Epistellesung geht es also immer um einen der Briefe, von denen wir im Neuen Testament etliche haben, z. B. den Römerbrief, den 1. Korintherbrief, die Petrus- oder Johannesbriefe.
Das Interessante ist nun, dass der Apostel Paulus in seinen Briefen, die ja literarisch kein Evangelium sind, das Wort „Evangelium“ ebenfalls häufig verwendet, nun aber in dem eingangs erwähnten grundsätzlichen Sinne der „guten Botschaft“ von Jesus Christus. So versteht er sich selbst etwa als „Knecht Jesu Christi“, der „ausgesondert ist zu predigen das Evangelium Gottes“ (Römer 1,1). Immer wieder treffen wir bei ihm – und nach ihm auch bei den anderen neutestamentlichen Autoren – das Wort „Evangelium“ in diesem grundsätzlichen Sinne an. Das hat dazu geführt, dass man nicht selten die ganze biblische Botschaft als „Evangelium“ bezeichnet, also nicht nur die Texte der vier Evangelisten oder die Inhalte der neutestamentlichen Briefe. Martin Luther war sogar der Ansicht, dass uns die gute Botschaft von Jesus Christus in jedem einzelnen Wort des Alten Testaments begegnet, wenn auch mitunter auf sehr verborgene Weise.
Das Wort „evangelisch“ bezieht sich nun vor allem auf diesen grundsätzlichen Sinn des Wortes „Evangelium“. Christinnen und Christen, die sich „evangelisch“ nennen, wollen damit zum Ausdruck bringen, dass ihr Christsein wesentlich davon bestimmt ist, dass sie auf das Evangelium, also die gute Botschaft von Jesus Christus, hören. Welche praktischen Konsequenzen das hat, wird man sehen müssen. Und ob diese grundsätzliche Orientierung am Evangelium einem evangelischen Christenmenschen immer gleich anzumerken ist, steht zunächst auf einem anderen Blatt. Gleichwohl halten wir zunächst einmal fest: „Evangelisch“ kommt von „Evangelium“. So weit, so einfach.
Aber ganz so einfach ist es nicht. Denn warum legt die Evangelische Kirche überhaupt so einen großen Wert darauf, dass diese Grundorientierung am Evangelium schon in ihrem Namen, also gewissermaßen programmatisch zum Ausdruck kommt? Ist das Hören auf das Evangelium für einen Christen – welcher Konfession auch immer – nicht selbstverständlich? Um diese offensichtlich doch nicht ganz so selbstverständliche Selbstverständlichkeit ein wenig zu verstehen, müssen wir für einen Moment die Uhr anhalten und einen kleinen Blick zurück in die Vergangenheit werfen.
2. Ein kleiner Blick zurück
Wann genau das Wort „evangelisch“ zur Bezeichnung bestimmter Christen zum ersten Mal auftaucht, lässt sich nicht mehr exakt ausmachen. Es muss in den Jahren der Reformation gewesen sein. Seit seinem berühmten Thesenanschlag zu Wittenberg im Jahr 1517 hatte sich Martin Luther immer wieder heftig mit seiner Kirche angelegt. Vieles an ihr störte ihn, ja sah er sogar in eklatantem Widerspruch zur Botschaft der Bibel: Ablasshandel, Messopfer, Werkgerechtigkeit, Papsttum, kirchliche Hierarchien, Prunksucht, Heiligenverehrung und Reliquienkult, um nur einiges zu nennen. Luther erkannte als Hauptursache für diese Missstände, dass sich die Kirche seiner Zeit eben nicht mehr, zumindest nicht mehr ausschließlich auf die biblische Botschaft von Jesus Christus bezog. An die Stelle der Heiligen Schrift war aus seiner Sicht die Kirche selbst getreten – mit ihrem Anspruch, das Heil zu verwalten, die Frömmigkeitsformen vorzugeben und unbedingten Gehorsam zu fordern. Was zu glauben oder nicht zu glauben war, war von der Kirche vorgegeben. Wer dem nicht folgte, hatte mit Ausgrenzung und nicht selten auch Verfolgung zu rechnen, um es einmal vorsichtig auszudrücken.
Demgegenüber Luthers erster, wenn man so will: „evangelischer“ Grundsatz: allein die Schrift. Die Kirche ist nicht um ihrer selbst und schon gar nicht um ihres eigenen Machterhalts willen da, sondern ausschließlich, um das Evangelium Gottes in der Welt laut werden zu lassen. Dieses finden wir aber nicht in kirchlichen Traditionen, Lehrsätzen oder noch so frommen Frömmigkeiten. Wir finden es zuallererst und einzig in seinem Wort, so wie es uns eben in dem Text, der Jesus Christus zum Inhalt hat, begegnet, also dem Text der Bibel. Sie, nur sie allein – und nicht etwa auch noch Dogmen und Traditionen – ist das Dokument, der Kanon, die Richtschnur der Wahrheit. Deshalb kritisiert Luther die Römische Kirche auch nie aus einer sozusagen pubertären, antiautoritären Haltung heraus. Er kritisiert sie immer nur über der aufgeschlagenen Bibel. Sie ist die Instanz, an der sich alles messen lassen muss. Sie ist das kritische Korrektiv der Kirche. Deshalb der Grundsatz: allein die Schrift. Lateinisch: sola scriptura. In diesem Sinne hat Luther mitunter auch seine eigenen Schriften als „evangelisch“, also als auf die Heilige Schrift und nur auf diese bezogen bezeichnet.
Dass solch eine radikale Sicht der Dinge nicht lange gut gehen konnte, liegt auf der Hand. Wer lässt sich schon gerne nachsagen, er läge mit seiner Art Christsein völlig daneben, gar im Widerspruch zum Wort Gottes selbst? Die Kirche der damaligen Zeit jedenfalls nicht. Wir kennen die heftigen und nicht selten auch gewalttätigen Auseinandersetzungen der Reformations- und Nachreformationszeit. Zimperlich ging es da auf beiden Seiten nicht eben zu. Bis hin zu den schrecklichen und blutigen Kämpfen etwa des Dreißigjährigen Krieges gut hundert Jahre später.
Was die Selbstbezeichnung der Menschen, denen Luthers Protest gegen die damalige Kirche eingeleuchtet hatte, angeht, so begegnet uns – offenbar in Ermangelung von etwas Geeigneterem – zunächst der Begriff der „Lutherschen“. Ähnlich wie es dann später auch bei den anderen Reformatoren etwa „Zwinglianer“ oder „Calvinisten“ gab, zum Teil bis heute. Doch Luther selbst war die damit verbundene Personalisierung durchaus zuwider. „Was ist schon Luther?“, konnte er schon mal in seiner bekannt drastischen Art von sich geben: „Ein armer, stinkender Madensack.“ Jedenfalls nicht der Held oder gar Religionsgründer, als der er uns auf manch einem Sockel vor Augen gestellt wird. Dennoch hält sich das Wort „luthersch“ hartnäckig – bis hinein in die verschiedenen „lutherischen“ Landeskirchen, von denen es ja einige in Deutschland gibt, oder die verschiedenen „Lutheran Churches“ weltweit. Ohne diesen Kirchen gleich einen unevangelischen Personenkult unterstellen zu wollen.
Bevor sich „evangelisch“ zur Bezeichnung aller der Reformation verbundenen Menschen durchsetze, tauchte im Jahr 1529 noch ein weiterer Begriff auf, der sich ebenfalls bis heute gehalten hat: „protestantisch“. Auf dem damaligen Reichstag zu Speyer setzte die „luthersche“ Minderheit dem Kaiser und den katholischen Ständen eine sogenannte „Protestation“ entgegen. Darin kämpfte sie vor allem für eine allgemeine religiöse Gewissensfreiheit. Die Gegner dieser Protestation, also die Anhänger der Römisch-Katholischen Kirche, bezeichneten diese protestierende Minderheit als „Protestanten“. Weil sich diese wiederum mit solch einer Bezeichnung nicht ganz verstanden fühlten, nannten sie sich fortan mehr und mehr „evangelisch“. Hinzu kamen später die Bewegungen, die auf die Schweizer Reformatoren Ulrich Zwingli und Johannes Calvin zurückgehen und die man in der Regel unter dem Sammelbegriff „reformiert“ antrifft. Schließlich taucht seit dem frühen 19. Jahrhundert auch das Wort „uniert“ auf, womit vor allem die Kirchen bezeichnet werden, auf deren Boden sich Lutheraner und Reformierte vorgenommen haben, friedlich zusammenzuleben.
3. Ein vorläufiges Fazit
Bis heute begegnen im evangelischen Raum alle Begriffe. Wollten wir ein vorläufiges Fazit ziehen, so müssten wir konstatieren, dass jeder von ihnen irgendein Argument für sich hat. In „lutherisch“ ist immerhin die Erinnerung an den Mann wach, der die ganze Geschichte historisch überhaupt ins Rollen gebracht hat. In „reformiert“ meldet sich der berechtigte Anspruch zu Wort, dass die Kirche nicht aus ihrer Tradition, sondern von ihrer steten Erneuerung durch das Wort Gottes lebt. In „protestantisch“ klingt etwas von dem an, dass die Botschaft des Evangeliums nicht einfach identisch ist mit den vielen Botschaften dieser Welt, sondern sich zunächst einmal in Opposition dazu befindet. Selbst in „uniert“ ist ja eine Wahrheit vorhanden, nämlich die, dass es schon zum Auftrag der Kirche gehört, nach Glaubensgemeinschaft zu streben. „Auf dass sie alle eins seien“, wie Jesus sagt (Johannes 17,21).
Doch nach all dem erscheint am Ende das Wort „evangelisch“ wohl noch der sachlich angemessenste Begriff zu sein zur Bezeichnung von Menschen und Kirchen, die sich vor allen anderen Dingen eben auf das Evangelium, also die gute Botschaft von Jesus Christus, beziehen. „Evangelisch“ kommt von „Evangelium“. Insofern kann man evangelisch grundsätzlich nur im Hören der biblischen Botschaft sein. Deshalb steht in einem evangelischen Gottesdienst unbedingt die Predigt, d. h. die Auslegung eines biblischen Textes, im Mittelpunkt. Äußerlich drückt sich das so aus, dass wir in vielen evangelischen Kirchen als Blickfang nicht das Kreuz oder irgendeine künstlerische Darstellung vorfinden, sondern eine aufgeschlagene Bibel vorne auf dem Altar bzw. auf dem Abendmahlstisch. Sie erinnert an den reformatorischen Grundsatz „sola scriptura“. Allein die Schrift. Evangelisch sein geht nicht ohne das Aufschlagen der Bibel.
Doch schon stellen sich neue Fragen ein.