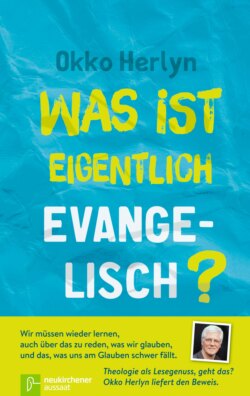Читать книгу Was ist eigentlich evangelisch? - Okko Herlyn - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Hineininterpretieren, was man will?
ОглавлениеKatholikentag Regensburg 2014. Sie sitzt mir mit ihrem recyclebaren Pappbecher mit Kaffee aus fairem Handel gegenüber, und wir kommen so über dies und das ins Gespräch. Obgleich ich sie als eine junge, moderne Frau wahrnehme, die an ihrer Kirche durchaus das eine oder andere auszusetzen hat, nimmt sie beim Thema „Bibelauslegung“ doch eine – wie ich finde – sehr „katholische“ Haltung ein. Dass es da so eine zentrale Instanz – sie meint die päpstliche Lehrautorität – gebe, das habe die Katholische Kirche der Evangelischen doch immerhin voraus. Gruselig, wie beispielsweise bei den Protestanten jeder und jede einfach mitmischen könne und am Ende vieles auch „zerredet“ werde. In Glaubensdingen komme es doch auf eine klare, für alle verbindliche Linie an, die nun einmal „von oben“ festgelegt werden müsse. Meinen Einwand, was denn sei, wenn „von oben“ vielleicht auch einmal etwas Problematisches, womöglich auch einmal etwas ganz Falsches oder gar Gefährliches festgelegt werde, kontert sie mit dem Hinweis, dass sie in theologischen Dingen da doch ein ziemliches Vertrauen in den habe, der das schließlich – anders als sie – studiert habe und von der Kirche dazu geweiht sei. Einem Elektriker oder einem Zahnarzt pfusche sie ja schließlich auch nicht ins Handwerk.
Hat die junge Dame mit ihrer Kritik Recht? Nämlich dass beim Lesen der Bibel doch jeder in sie hineininterpretieren könne, was er mag? Es gibt ja in der Tat Umgehensweisen mit der Bibel, bei denen es vor allem um meine eigenen Assoziationen geht. Etwa: Was fällt mir alles ein, wenn ich in einem biblischen Text z. B. das Wort „Stein“ lese. Der eine mag dabei an die harten, belastenden Seiten seines Lebens erinnert werden, der andere an Erfahrungen, die ihn fest und zuversichtlich werden ließen. Niemand wird bestreiten, dass es Situationen gibt, in denen solch ein Vorgehen durchaus sinnvoll und hilfreich sein kann, etwa wenn es darum geht, einen neuen Zugang zu meinen eigenen Gefühlen und Erfahrungen zu bekommen. Auch bei einem biblischen Text ist es gewiss nicht von vornherein verboten, ihn – ähnlich einem x-beliebigen Meditationsgegenstand – auch einmal als Projektionsfläche meiner Gedanken und Empfindungen in Anspruch zu nehmen. Aber ob ein solcher Umgang mit dem biblischen Text dem, was dieser von sich aus sagen will, immer gerecht wird?
Stellen wir uns einmal spaßeshalber vor, der biblische Text sei irgendein menschliches Gegenüber. Dieses Gegenüber will uns etwas von sich erzählen. Aber bevor es überhaupt dazu kommt, benutzen wir das erstbeste Stichwort, um unsere eigenen Dinge loszuwerden. Unser Gesprächspartner will uns z. B. von seinem Urlaub am Bodensee erzählen. „Ah, da war ich auch schon“, fallen wir ihm ins Wort, „tolle Gegend, meist schönes Wetter. Außerdem gibt es da in Meersburg ein gutes Restaurant, wo man ausgezeichnet Fisch essen kann.“ Während es aus uns nur so heraussprudelt, ist unser Gegenüber gar nicht dazu gekommen, uns das, was es vom Bodensee erzählen möchte, mitzuteilen. Vielleicht hat ihm die Gegend ja gar nicht so gut gefallen. Vielleicht war das Wetter auch nicht so toll. Vielleicht hat es ganz andere Fischrestaurants kennengelernt. Vielleicht will es uns am Ende noch etwas ganz anderes mitteilen, was ihm wichtig ist. Diese Unart, unser Gegenüber gewissermaßen nur als „Stichwortgeber“ zu missbrauchen, ist sicher weit verbreitet. Zum Vorbild, um mit der Bibel ins Gespräch zu kommen, taugt sie jedenfalls nicht.
Aber muss das Lesen der Bibel zwangsläufig der Gefahr erliegen, dass jeder darin findet, was er möchte oder was er schon vorher wusste? Auch ein Gespräch mit einem menschlichen Gegenüber muss ja nicht notwendig so verlaufen, dass wir nur immer von uns selbst reden. Man kann sich ja auch einmal auf den anderen einlassen. Man kann ihm ja auch einmal in Ruhe zuhören. Man kann ja auch hier und da einmal ernsthaft nachfragen, ob wir unseren Gesprächspartner wirklich richtig verstanden haben. Man kann ja auch einmal an dem Interesse zeigen, was den anderen beschäftigt. Neugierig sein, was er uns sagen möchte.
Und so ähnlich scheint es mir auch mit der Bibel zu sein. Sie will uns ja von sich aus etwas mitteilen, womöglich etwas, was wir vorher so gar nicht kannten. Deshalb geht es beim Lesen der Bibel grundsätzlich nicht um ein Hineininterpretieren, sondern, wenn man so will, Herausinterpretieren. Die Bibelwissenschaft benutzt hier seit alters den Begriff „Exegese“. Das kommt aus dem Griechischen und bedeutet wörtlich „Herausführung“. Wer die Bibel interpretiert, hat also gar nicht die Absicht, irgendetwas in sie „hineinzulesen“, sondern umgekehrt das, was in ihr steckt, sozusagen „herauszuführen“, sichtbar zu machen. Auf das zu hören und zu verstehen, was der Text selbst sagen will. Ob das immer auf Anhieb gelingt, steht auf einem anderen Blatt. Beim Aufschlagen der Bibel geht es also, wenn man so will, zunächst um eine bestimmte Haltung. Man mag diese gerne neugierig, respektvoll oder gar demütig nennen.
Und dennoch bleibt mit der Kritik jener jungen Dame eine offene Flanke. Nehmen wir einmal an, wir haben die Bibel aufgeschlagen. Wir haben einen überschaubaren Text in einer sprachlich modernen und verständlichen Form gelesen. Wir haben redlich versucht, in Ruhe hinzuhören und so die Absicht des Textes zu verstehen. Gleichwohl beschleicht uns ein merkwürdiges Gefühl. Könnte man das Ganze vielleicht auch ganz anders verstehen? Haben wir überhaupt begriffen, worum es dort inhaltlich geht? Sind wir dem Text wirklich gerecht geworden? Was ist, wenn – auch bei ernsthaftestem und demütigstem Bemühen aller Beteiligten – am Ende der eine den biblischen Text so und die andere vielleicht völlig anders versteht? Man denke nur an die z. T. erbitterten Streite der verschiedenen theologischen Richtungen, etwa zwischen der historisch-kritischen oder der fundamentalistischen, der tiefenpsychologischen oder der feministischen, der sozialgeschichtlichen oder der narrativen Bibelauslegung. Machen diese verschiedenen Versuche ein wirkliches Verstehen dessen, was die biblischen Texte von sich aus sagen wollen, nicht von vornherein unmöglich?
Vielleicht sollten wir uns in dem Zusammenhang einmal von der negativen Bedeutung des Wortes „Streit“ freimachen. Vom Judentum etwa kann man lernen, dass gerade im Ringen um das rechte Verstehen des biblischen Textes Streit und Widerspruch auch etwas sehr Positives und Befruchtendes sein können. Wo steht denn geschrieben, dass uns die verschiedenen, womöglich auch einander widersprechenden Versuche, einen biblischen Text zu verstehen, immer gleich entzweien müssen? Könnte es nicht sein, dass wir in der friedlichen, respektvollen Auseinandersetzung mit anderen Versuchen der Interpretation am Ende nicht frustriert und erbittert, sondern vielmehr bereichert nach Hause gehen? Es käme zumindest auf den Versuch an. Die Reformatoren haben uns gelehrt, dass wir es bei solch einem Versuch gar nicht nötig haben, „nach oben“ zu schielen, sondern darauf vertrauen dürfen, dass der Heilige Geist jedenfalls das Seine dazutun wird.