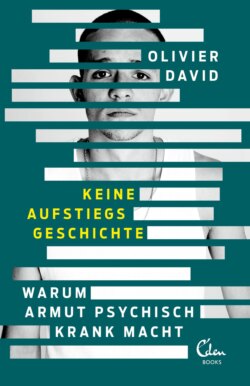Читать книгу Keine Aufstiegsgeschichte - Olivier David - Страница 15
Scheitern als Lebensweg
ОглавлениеIn der Schule wurde ich oft gefragt, woher mein Name stammt. Meine Antwort: »Aus Frankreich!« Ob ein Elternteil denn Franzose sei? »Ja, mein Vater ist Franzose.«
»Also sprichst du Französisch?«
»Nein, na ja, nicht so richtig.«
»Oh, warum denn nicht?«
»Mein Vater hat es mir nicht beigebracht.«
»Aber das kann dein Vater ja jetzt noch.«
»Nein.«
»Wieso nicht?«
»Weil er in China lebt.«
»In Chiiiiiiiiiiiina???«
»Ja, in Shenzhen, im Südosten, das liegt in der Bucht von Hongkong«, antwortete ich meist peinlich berührt.
»Und was macht dein Papa da?«
»Er ist Pirat«, nuschelte ich.
»Pirat?«
»Ja, er macht halt so dies und das. Gerade arbeitet er als Englischlehrer.«
»Moment mal, dein Vater ist Franzose, hat in Deutschland gelebt und arbeitet als Englischlehrer in China? Das ist ja verrückt.«
Ja, ja, du mich auch, dachte ich stets, sprach es aber nie aus.
Immer war ich es, der sich erklären musste, der, dessen Geschichte nicht normal war. Ich hatte es satt, das Leben als Paradiesvogel; als jemand, der beweisen musste, dass sein Name echt war (»Das ist doch nicht dein richtiger Name, oder?«), als jemand, der sich immerzu rechtfertigen musste, warum er nicht fließend Französisch sprach, wo doch sogar zwei Mitschüler aus der Klasse nach einem halben Jahr Austausch die Sprache mehr oder weniger beherrschten.
Ich war mittlerweile zwölf, und mein Vater lebte seit zwei Jahren nicht mehr in Deutschland. Nach einem wenige Monate dauernden Intermezzo in Paris lebte mein Vater nicht mal mehr in Europa, nein, es hatte ihn nach China verschlagen. Weiter weg ging’s nicht. Alles, was mir als Erinnerung an ihn blieb, waren sein Versprechen, dass er sich melden würde, ein paar Fotos in unseren Familienfotoalben und eine CD von Maxime Le Forestier, dem französischen Pendant von Reinhard Mey, die ich fortan rauf- und runterhörte. Alles, was meiner Mutter blieb, war ein Teil seiner Schulden, für die sie gebürgt hatte – und eine große Portion Wut.
Aber wieso China? Einer meiner Onkel handelte in China mit Antiquitäten. Als er erfuhr, dass sein kleiner Bruder Michel bei Gott und der Welt verschuldet war und nicht wusste, was er als Nächstes unternehmen sollte, fragte er ihn, ob er ihn bei seinem Geschäft helfen wolle. Da meinem Vater in Deutschland so langsam die Felle davonschwammen und es ihm auch in Paris nicht gelang, Fuß zu fassen, schlug er ein.
Zu Beginn waren seine unleserlichen Briefe meine einzige Verbindung zu ihm. Bald wurden aus Briefen sporadische Anrufe, bei denen er sich in schwer nachvollziehbare Erzählungen darüber verlor, was er dort trieb, und die durch die schlechte Telefonverbindung und sein Kauderwelsch aus Deutsch und Französisch nur noch mystischer klangen. Alles, was ich wusste, war, dass er sich irgendwann nicht mehr so gut mit seinem Bruder verstanden hatte und sie nun getrennte Wege gingen.
Jedes Mal, wenn mein Vater anrief, hatte er irgendeinen anderen verrückten Job, jetzt arbeitete er eben als Englischlehrer, ohne dass er je mehr als ein paar Brocken Englisch gesprochen hatte, bevor er nach China ausgewandert war.
Langsam entwickelte ich eine Wut auf ihn. Hinter der Wut versteckte sich die unerfüllte Sehnsucht eines kleinen Jungen nach seinem Vater, der ihn zu oft versetzt hatte, auf den man sich nicht verlassen konnte – und der zu allem Überfluss nun auch noch ans andere Ende der Welt gezogen war. Warum war er nach Asien ausgewandert, warum ließ er mich im Stich? Warum konnte er nicht sein wie die Väter meiner Mitschüler:innen, die Geburtstage organisierten, die ihre Kinder fragten, wie ihr Tag gewesen war?
Doch sobald er anrief, wich meine Wut einer fiebrigen Aufregung. Er fragte, wie es mir ging, hörte mir dann aber kaum zu. Wollte ich etwas erzählen, was länger war als ein, zwei Sätze, unterbrach er mich mit der nächsten Geschichte, die ihm gerade eingefallen war, und bemerkte es noch nicht mal.
Die Lücke, die er hinterließ, wurde durch seine Anrufe paradoxerweise eher größer, auch wenn unsere Mutter versuchte, sie, so gut es ging, zu schließen. Ihre Mittel waren begrenzt, aber sie tat, was in ihren Möglichkeiten stand: Sie raufte mit mir, weil Väter das so machen und Jungs das so brauchen; weil die Sozialhilfe hinten und vorn nicht reichte, jobbte sie schwarz in einem Klamotten- und Spielzeugladen für Kinder, und an den Tagen, an denen sie arbeitete, kam sie in der Mittagspause nach Hause, um uns etwas zum Essen zu machen. Von dem Extrageld, das sie dazuverdiente, bekam meine Schwester eine Querflöte, ich einige Monate später eine Gitarre. Wir sollten es besser haben als unsere Mutter, das war ihr wichtig, und dafür sorgte sie. Nach ein paar Stunden hatte ich den Gitarrenlehrer allerdings schon über, ich wollte coole Riffs lernen und keine Tonleitern rauf- und runterklimpern.
Doch so sehr unsere Mutter sich auch bemühte, mir und meiner Schwester eine schöne Kindheit zu bieten – Wochenendausflüge mit dem Bus in die Lüneburger Heide, gemeinsames Frühstück am Samstagmorgen –, ihrer Depression entkamen wir nicht. Weder sie selbst noch meine Schwester noch ich. Wir waren ihren Launen ausgeliefert. Zwei Faktoren kamen bei mir zusammen: zum einen ihr dünnes Nervenkostüm, schon die kleinsten Fehler konnten sie wütend machen; zum anderen fehlte es ihr an Möglichkeiten, die Hürden, die das Leben ihr vor die Füße knallte, zu überwinden. Wenn ich in der Schule mal wieder Stress hatte oder schlechte Zeugnisse nach Hause brachte, was regelmäßig der Fall war, sagte sie, wenn das so weiterginge, würde sie mich von der Schule nehmen. Nervte ich sie, bekam ich zu hören, dass sie mich in eine Pflegefamilie geben würde, da sei ich besser aufgehoben. Die ersten Male sagte sie es in einem halb ironischen Ton, der mich an ihre Mutter, meine deutsche Großmutter, erinnerte, zu der wir keinen Kontakt mehr hatten. Doch bald drohte sie ernsthaft und klagte immer wieder: »Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr.« Dass sie vorhatte, sich umzubringen, sobald ihre beiden Kinder volljährig sein würden, das erfuhr ich erst viel später, aber auch so reichten ihre Drohungen, um aus mir einen angsterfüllten, handlungsunfähigen Jungen zu machen.
Im neoliberalen Diskurs hört man immer wieder die Erzählung vom Scheitern als Chance. Hinfallen, aufstehen, weitermachen, so lautet die Devise, sobald einen ein Schicksalsschlag ereilt. Das Schicksal, mit dem meine Familie zu kämpfen hatte, war die Armut, die uns weder plötzlich noch aus Versehen traf. Meine Mutter wurde in sie hineingeboren, sie hatte keine Wahl, der Platz war ihr zugewiesen. Durch »Scheitern als Chance« wird das Scheitern, die Niederlage, mit einem positiven Sinn aufgeladen, der dem Scheiternden eine Perspektive bietet, einen Neuanfang, eine Chance eben. In den allermeisten Fällen besteht diese Chance in der Möglichkeit, noch mal zu scheitern. Jeder ist seines Glückes Schmied, bedeutet im Umkehrschluss nichts anderes, als dass Scheitern selbst verschuldet ist. Du bist arm und hast es nicht vom Tellerwäscher zum Millionär geschafft? Dann hast du nicht hart genug gearbeitet, warst nicht clever, nicht gerissen genug. Wenn laut einem Bericht von Oxfam2 sechsundzwanzig Milliardär:innen so viel besitzen wie fünfzig Prozent der Weltbevölkerung, ist Scheitern ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens, anders lässt sich das unnatürliche Ungleichgewicht nicht aufrechterhalten.
Scheitern nicht als Chance, sondern als Lebensweg: Unbewusst hatte auch ich mir dieses Credo schon früh auf die Fahne geschrieben. Die Leiterin der Schauspielschule, auf die ich später ging, sagte mir einmal, ich sei es so sehr gewohnt zu scheitern, dass ich Szenen während der Probe oder Impulse im Spiel absichtlich an mir vorbeiziehen ließe, da mir das Gefühl des Scheiterns Sicherheit und Vertrauen gäbe. Was ist das für ein Quatsch?, dachte ich zuerst, doch einige Zeit später wurde mir klar, dass es stimmte. Scheitern war für mich zu einem Nachhausekommen geworden. Auf der Probebühne sah ich den Impuls vorbeifliegen, war aber nicht in der Lage, ihn zu verarbeiten. Ich war wie taub, nur dass ich alles mitbekam und eine innere Stimme mir sagte, dass ich handeln sollte. Wenn ich dann nicht handelte, versorgte mich mein schlauer Körper mit der Tagesration an Niederlage, die ich brauchte, um mein Selbstbild aufrechtzuerhalten. Unbewusst war ich davon überzeugt, dass ich, wenn ich mich selbst sabotierte und keine guten Ergebnisse erzielte, eben nicht so gut sei. Ich ordnete mich selbst ein, was praktisch war, denn dann mussten andere das nicht für mich tun, und ich ersparte mir unangenehme Fremdbewertungen. Bis heute ertappe ich mich dabei, wie ich in der Verharmlosung meiner Leistung, im Witz über meine Schwächen versuche, Bewertungen anderer zuvorzukommen. Aber woher kommt dieser Impuls, sich in der Niederlage zu Hause zu fühlen? Liegt es daran, dass meine Eltern mir selbst die Bewältigung einfacher Aufgaben nicht zutrauten? Dass der Junge lieber nicht in der Küche helfen sollte, er würde ja eh nur alles kaputt machen? Daran, dass mein Vater mich anblaffte, wenn mir etwas herunterfiel oder ich mich beim Spielen verletzte? Dass meine Mutter mir etwas auftrug, es dann aber lieber selbst erledigte, weil sie zu ungeduldig war? Hatte ich das Bild, das meine Eltern sich von mir machten, so verinnerlicht, dass ich es unbewusst schon in der Schule zu meinem Selbstbild gemacht hatte, indem ich mich doof stellte? Eines war klar: Kam es drauf an, konnte ich mich darauf verlassen, dass mein Gehirn nicht funktionierte. Wollte ein Lehrer etwas ad hoc von mir wissen, war mein Gehirn wie blockiert. Ich war wie zugeschnürt, als käme kein Sauerstoff durch. Ich konnte mich selbst beobachten, wie ich gegen eine Wand lief, hinter der die Antworten nur darauf warteten, von mir befreit zu werden. Aber diese Wand war aus Beton, und ich war zu schwach, sie zu durchbrechen.
Meine Flucht war das Skateboardfahren. Ein Brett, zusammengehalten von zwei Achsen, einer Handvoll Schrauben und Muttern, vier Rollen, acht Kugellagern, einem Griptape. Fertig war meine Ding gewordene Freiheit. Das Argument der Faust, das ich auf dem Schulhof zur Genüge angewandt hatte, tauschte ich gegen den willkommenen Schmerz des Sturzes ein. Ich kannte keinen, der sich so oft maulte, wie ich es tat. Immer bekam ich mitten auf einer Treppe, mitten auf einem Rail, mitten beim Trick Panik, kickte mein Board weg und stürzte. Als Ergebnis dieser andauernden Kurzschlussreaktionen drohte mein Körper zu einer einzigen großen Narbe zu werden, weshalb ich einen Großteil meiner Stürze, meiner Prellungen und Schürfwunden vor den Augen meiner erschöpften Mutter verbergen musste, wollte ich kein Skateverbot bekommen. Ganz am Anfang, ich konnte kaum richtig auf dem Brett stehen, übte ich am nahe gelegenen Bahnhof einfach nur, den Hügel runterzufahren. Um mich zu vergewissern, ob mir von hinten Passant:innen oder Radfahrer:innen in die Quere kommen würden, drehte ich mich um. Ein Paar stand etwa dreißig Meter entfernt an der Ampel, ansonsten hatte ich freie Bahn. Ich fuhr an, stellte beide Füße parallel hintereinander auf das Skateboard, und zack, verlor ich die Kontrolle. Ich fiel, und um mich herum wurde es dunkel. Als das Licht wieder anging, wusste ich nicht, ob eine Minute oder eine Stunde vergangen war. Wie in einem Film reckten sich vom Himmel zwei Köpfe zu meiner verunglückten Gestalt herunter. Es war das Paar, das es mittlerweile über die Straße geschafft hatte und nun fragte, ob ich Hilfe bräuchte. Also eher eine Minute als eine Stunde. Ein rasender Schmerz schoss mir in den Schädel, ich blutete ein wenig aus einer Stelle an meinem Hinterkopf, und mir wuchs eine riesige Beule. Die Fragen der beiden, ob sie einen Krankenwagen rufen sollten, wo ich wohne und ob sie mich begleiten sollten, verneinte ich und ging leicht taumelnd und mit flauem Magen die wenigen Hundert Meter zurück nach Hause. Dort angekommen wunderte meine Mutter sich zwar, dass ich schon so zeitig zurück war, aber sie hatte gerade anderes zu tun, als sich um mich zu kümmern. Ich legte mich am helllichten Tag ins Bett und schlief. Vermutlich hatte ich eine Gehirnerschütterung, doch größer war die Sorge, ihren Unmut auf mich zu ziehen, weshalb ich sie lieber nicht belästigte. In der darauffolgenden Woche ließ ich das Skateboard stehen und wachte jeden Tag mit einem Brummschädel auf, bis meine mutmaßliche Gehirnerschütterung wieder auskuriert war.
Trotz oder vielleicht gerade wegen der vielen Faktoren, die einer behüteteren Kindheit im Weg standen, dachte ich jahrelang, ich wäre etwas Besonderes. Nicht in dem Sinn, in dem jeder Mensch etwas Einzigartiges an sich hat, nein, ich dachte wirklich, ich wäre etwas komplett Außergewöhnliches. Jahrelang malte ich mir immer wieder still und heimlich aus, ich würde von mir unbekannten Erwachsenen beobachtet und protegiert, und wenn der richtige Zeitpunkt käme, würde man mich auf der Straße ansprechen und mir mitteilen, was Sache sei. So Harry-Potter-mäßig, nur ohne das Zaubern. Ich war davon überzeugt, ich wäre für etwas berufen, das höher und größer war als alles, was ich kannte, und diese Erwachsenen, die ich mir herbeifantasierte, verfügten natürlich ebenfalls über dieses Wissen. Immer wieder, wenn mich ein Mann auf der Straße eine Sekunde länger anguckte als normal, dachte ich: Jetzt geht es los. Jetzt wird sich alles ändern. Was sich genau ändern würde oder wozu ich berufen war, darüber machte ich mir keine Gedanken.
2 https://www.globalcitizen.org/de/content/oxfam-report-billionaires-inequality