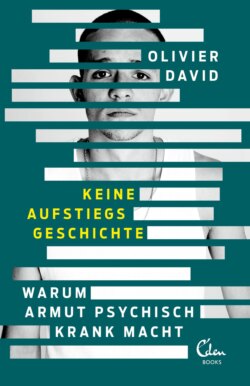Читать книгу Keine Aufstiegsgeschichte - Olivier David - Страница 9
Aus den Angeln gehoben
ОглавлениеAn einem tristen Herbstnachmittag irgendwann Mitte der 1990er-Jahre veränderte sich unsere Welt zu Hause von Grund auf. Draußen war es schon dunkel, und meine Mutter telefonierte in ihrem Zimmer, das eigentlich unser Wohnzimmer war, aber wegen der schlechten Stimmung schliefen mein Vater und sie bereits seit über einem Jahr getrennt. Meine Schwester und ich lebten in dieser Zeit in den mikroskopisch kleinen Freiräumen zwischen Zornesfalten, Versuchen eines normalen Alltags und apokalyptischen Streits unserer Eltern. Bloß nicht im falschen Moment die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, das war unser Sport, nur war meine Schwester darin um einiges besser als ich.
Die Tür zum Wohnzimmer stand halb offen, meine Schwester lehnte leicht gebückt am linken Türrahmen, ich, auf Knien, darunter. Wir lauschten. »Ja«, sagte unsere Mutter in den Hörer, »im Badezimmer ist auch alles gepackt, die Zahnbürste und seine Sachen habe ich schon rausgelegt.« Meine Schwester lugte zu mir nach unten, ich schielte zu ihr hoch. Glaubte sie das, was ich glaubte? Wie auf Kommando schoss ich ins Badezimmer, meine Schwester hinterher, um zu überprüfen, ob ich recht behalten sollte und wir umziehen würden. Ich machte das Licht an, doch auf der Waschmaschine neben der Tür stand bloß Papas Kulturbeutel. War sie noch nicht dazu gekommen, unsere Sachen zu packen? In der Küche lag ein Stapel Handtücher bereit, und es herrschte eine seltsame Aufregung. Würden wir umziehen? Und wenn ja, wohin? Als unsere Mutter wenig später den Hörer auflegte und nach uns rief, hatte sie keine guten Nachrichten. Wir würden nicht umziehen, sie und Papa hätten sich getrennt, und das bedeutete, dass Papa jetzt ausziehen müsste.
»Aber wo geht Papa dann hin?«, fragte ich.
»Das muss Papa jetzt selber gucken, das kann ich euch nicht sagen«, antwortete unsere Mutter. Unser Vater schlief noch ein oder zwei Nächte in seinem roten Renault-Kastenwagen, der vor der Tür parkte, ehe er vorübergehend bei Fifi unterkam, einem Franzosen, der seinen Lebensunterhalt als Straßenclown verdiente.
Es dauerte nicht lange, da machte die Neuigkeit auch in der Schule die Runde. »Deine Eltern haben sich getrennt«, raunte Dennis mir auf dem Pausenhof meiner Schule verschwörerisch zu. Als ich widersprach, rannte er davon und rief: »Ich werd es allen erzählen.« Ich lief hinterher, mit einem Stein im Bauch und Furcht im Gesicht, bereit, mein Geheimnis zu verteidigen.
Meine Schwester und ich gingen auf eine Waldorfschule, obwohl meine Mutter sich das Schulgeld dafür nicht leisten konnte. Damit die Waldorfschule kein reines Elitenprojekt blieb, wurden pro Klasse immer eine Handvoll Kinder aus ärmeren Familien zugelassen, deren Eltern monatlich nur einen geringen zweistelligen Beitrag für den Schulverein zahlen mussten. Nach der Trennung lebte unsere Mutter von Sozialhilfe, aber natürlich wollte sie, dass wir eine schöne Kindheit hatten, wozu auch eine passende Schule gehörte, die uns förderte und die nötige Bildung vermittelte. Wir sollten bessere Chancen haben als sie. Sie glaubte an das Konzept der Waldorfschule, die es sich zur Aufgabe macht, jedes Kind ganzheitlich zu sehen, das heißt mit seinen Stärken und Schwächen, und dementsprechend auf eine individuelle Förderung setzt. Schwächen und Mängel, die gab es bei uns allemal. Die Probleme meiner Schwester – sie hatte als Frühchen unter anderem mit einer unterentwickelten Lunge zu kämpfen – stachen weniger ins Auge, aber auch sie hatte ihr Päckchen zu tragen. Ich hatte mit Konzentrationsproblemen zu kämpfen, mit zu viel Energie und Aggression. Nach den Pausen wollte ich nicht in den Unterricht zurück, und im Klassenraum fand ich alles spannend, nur nicht das, was vorn an der Tafel geschah.
Nachdem mein Vater ausgezogen war, schien unsere Welt wie aus den Angeln gehoben, und es war völlig unklar, ob sie je wieder ins Gleichgewicht kommen würde. Der plötzliche Tod meines Klassenlehrers, der während einer Wanderung in den Alpen einen Herzinfarkt erlitten hatte, machte es noch schlimmer. Ich war acht Jahre und ein paar Monate alt und hatte mich nicht länger im Griff. In fast jeder Pause kloppte ich mich mit irgendwem, meist war der Grund vergessen, bevor die letzte Träne getrocknet war. Auch wenn ich nicht der einzige Raufbold der Klasse war, sorgte mein auffälliges Verhalten für Befremden. Ich wurde zum laut polternden Außenseiter, der ständig für Aufregung sorgte.
Es war ein kalter Wintertag nach den Frühjahrsferien in der zweiten Klasse. Kaum hatte die alte Kuhglocke geklingelt, das Signal, dass die große Pause vorbei war, ging es um die Wurst. Wie zur Hölle sollte ich heil zurück in den Klassenraum kommen? Von meiner Schwester konnte ich keine Hilfe erwarten, sie ging in die fünfte Klasse und verbrachte ihre Pausen in einem anderen Teil des Pausenhofs. Wenn ich mich mit älteren Schülern anlegte, was immer mal wieder vorkam, konnte ich mich sonst auf ihre Hilfe und ihr Verhandlungsgeschick verlassen, doch an diesem Tag war ich auf mich allein gestellt. Auf dem mit Rinde bedeckten einzigen Weg zurück ins Schulgebäude wurde ich von meinen Mitschüler:innen erwartet. Mich rechts zwischen den kahlen Bäumen und Büschen am Zaun entlang vorbeizudrücken, war keine Option, sie würden mich kommen sehen. Wo war die kleine Außenseiterbande, als deren Anführer ich mich sah, wenn man sie brauchte? Mitja mit dem weizenblonden Pilzkopf, der mit Holzschuhen und Lederrucksack zur Einschulung erschienen war, Benni, der Lulatsch, und Sven, dessen Vater gestorben war. Wenn’s darauf ankam, stand ich allein da, so war es schon immer gewesen. Meine Freunde sind feige, aber ich werd mich wehr’n.1 Ich musste da jetzt durch. Ich ging los, doch schon nach wenigen Metern wurde ich von der Seite angerempelt. Ich hörte sie lachen, die Jungs aus meiner Klasse. Egal, weiter. Zu meiner Linken war die Mauer, rechts hatte ich zwei, drei Meter, bei einer Attacke bliebe kaum Platz, um auszuweichen. Vor und hinter mir gingen ahnungslose Schüler:innen aus anderen Klassen vom Schulhof in Richtung Schulgebäude, die nicht sahen, für welchen Krieg sie gerade als Statist:innen herhielten. So gut es ging, versuchte ich, mich zwischen ihnen zu verstecken, aber ich hatte keine Chance. »Na, du Feigling«, rief Laura mir zu, im Gesicht ein dämonisches Grinsen. Lauras Freundin Clara ging das nicht weit genug. Ein Batzen Spucke verließ ihren vor Wut verzerrten Mund und traf mich im Gesicht. Mir blieb keine Zeit, die Rotze wegzuwischen. Ich spuckte zurück, schubste sie weg, da kamen von links auch schon Tim und Robin. Ich begann zu rennen.
»Wenn sie dich in einer Sandkiste verfolgen, Olivier, weißt du, was du dann machst? Wenn du merkst, dass du nicht schnell genug bist und sie dich gleich eingeholt haben, dann gibst du noch mal alles, und dann musst du dich, so schnell du kannst, fallen lassen und zu einem Päckchen zusammenrollen.« Das Wort Päckchen klang aus dem Mund meines Vaters wie ›Päkschen‹. Er machte es mir vor, während er erklärte, wie ich mich seiner Meinung nach zu verhalten hatte. Er ging vor mir auf die Knie und schlang die Arme schützend um seinen Kopf. »Weißt du, was dann passiert, mon fils?« Er guckte zu mir hoch, ich schüttelte den Kopf. Mein Vater rappelte sich wieder auf. »Wenn du es richtig anstellst, dann stolpern sie über dich, und du stehst schnell wieder auf und kannst sie treten.« Er machte es mir vor.
Und was ist, wenn weit und breit keine Sandkiste zur Verfügung steht, in die ich mich fallen lassen kann, ohne mich zu verletzen, Papa? Das hätte ich ihm in dem Moment gern zugerufen, während ich über den asphaltierten Schulhof ins Schulinnere flüchtete. Da er mich aber nicht hören konnte, und weil mein Gesicht noch von Claras Spucke glänzte, hielt ich den Mund und lief. Im Schulgebäude angekommen, drängelte ich mich durch, bis ich in der Jungstoilette ankam. Ich nahm mir Papier aus dem Spender, verdrückte mich in eine der Kabinen und wischte mir das brennende Gemisch aus Rotze und Tränen aus dem Gesicht.