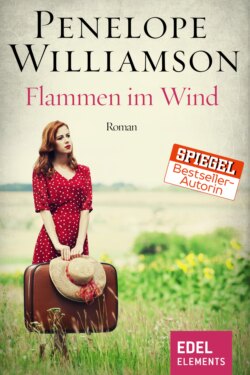Читать книгу Flammen im Wind - Penelope Williamson - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Viertes Kapitel
ОглавлениеAls Maeve Rourke zum ersten Mal in die Augen des Mannes schaute, der zu ihrem Liebhaber werden sollte, trafen beider Blicke sich über dem liegenden Leib der Jungfrau Maria.
Später entschied sie dann, dass es dieser absurde Moment gewesen sein musste, der sie verführt hatte. Denn bisher hatte sie ihr Leben immer so eingerichtet, wie es sein sollte; hatte sich eine Straße gezeichnet, gerade, gut ausgeschildert und leicht zu verfolgen. Sie war neunzehn an diesem Tag, an dem ihr Herz ihr einen Streich spielte und ihr klarmachte, dass es einen freien Willen und einen ganz eigenen Richtungssinn hatte.
Mit sechs Jahren hatte sie beschlossen, ihr Leben sorgfältig zu planen, sonst würde vermutlich alles schief gehen. Sie lebte damals in Irland, und obwohl sie später nur wenige Erinnerungen an jene Zeit hatte, konnte sie sich an jedes Detail dieses besonderen Morgens erinnern.
In ihrer Erinnerung steigt Rauch vom Feuer in der kleinen sibín mit ihren soliden Lehmwänden und dem Strohdach auf. Sie sitzt auf einem Schemel und hält eine Schale Kartoffelbrei auf dem Schoß, Brei, so dünn, dass sie leichter durch ihn hindurchsehen kann als durch das Wasser, das sie in der Regentonne hinter dem Haus sammeln.
Und immer kommt in ihren Erinnerungen ihre Mem barfuß über den festgetrampelten Lehmboden geschlurft und öffnet die Tür, sodass der Sonnenschein warm und weiß in die fensterlose Hütte eindringt. Und Dunkelheit und Rauch und die anderen brutalen Erinnerungen an die vergangene Nacht vertreibt.
Das Leben ihrer Mutter spielte sich im Dunkeln ab. Es lastete auf ihrer Seele wie ein Turm aus schweren Steinen, die einer nach dem anderen dort abgelegt worden waren. Schon mit sechs Jahren wusste Maeve, wie die Steine zusammengekommen waren. Einer für jeden Trauerflor, mit dem die Tür verhangen wurde, wenn wieder ein Kind geboren und begraben worden war. Einer für jeden Tag, an dem ihre Mutter auf einem Stoppelfeld nach Kartoffeln grub, mit schwerem Leib, in dem ein weiteres Kind auf seinen Tod wartete. Einer für jede Winternacht, in der kein Torf im Kamin brannte und der Wind kalt über die kargen Moore und die schwarzen Felsen wehte. Stein um Stein für die anderen Nächte, in denen ihr Da auf dem Strohhaufen in der Ecke sich grunzend auf dem Körper der Mutter bewegte und die Mutter weinte.
Stein um Stein, einer nach dem anderen, und deshalb suchte ihre Mutter immer das Sonnenlicht, sogar an den kältesten Tagen.
Doch an diesem Morgen hatte Da nichts von der Sonne wissen wollen. Er starrte die Lichtflut an, die durch die Tür spülte, seine Mundwinkel hingen schlaff herab, seine roten Augen zwinkerten.
»Mach die Scheißtür zu«, hatte ihr Da gesagt, mehr nicht, aber ihre Mem gehorchte mit hängenden Schultern und verkniffenem Mund. In der Sekunde, ehe sich die sibín ein weiteres Mal mit düsterem Rauch füllte, hatte Maeve die große Hand ihres Vaters angeschaut, mit der er seinen poitín-Krug umklammerte. Sie sah die drahtigen roten Haare, die sich auf seinen dicken Fingerknöcheln kräuselten, und die dunklen Sommersprossen auf seiner Haut, die auch Blutspritzer ihrer Mutter hätten sein können.
Und sie dachte, niemals werde ich einen rothaarigen, sommersprossigen Mann mit so großen, schweren und dicken Händen wie Torfbriketts heiraten, die immer bereit und willens dazu sind, sich zur Faust zu ballen.
Nein, das hatte sie nicht wirklich gedacht, nicht in konkreten Worten – dazu war sie zu jung gewesen. Aber auf jeden Fall hatte das Versprechen, das sie sich an jenem Morgen gemacht hatte, in ihrem Herzen Wurzeln geschlagen. Schon damals hatte sie die Kraft und die Ausmaße ihres Willens gekannt.
Niemals würde sie das Leben ihrer Mutter leben.
An dem Tag, an dem Maeve Rourke zum ersten Mal in die Augen des Mannes blickte, der ihr Liebhaber werden sollte, war sie in die St. Louis Kathedrale gegangen, um der sengenden Sommersonne zu entkommen. Sie hatte Irland schon vor vier Jahren verlassen, hatte bereits vier Sommer in New Orleans verbracht, aber noch immer hatte sie sich nicht an die entsetzliche Hitze gewöhnen können.
Sie setzte sich in der Nähe des Altars der Allerseligsten Jungfrau vom Rosenkranz in eine Bank, nicht um zu beten, sondern weil ihre Füße geradezu teuflisch wehtaten. Sie betete allerdings einige Gegrüßet seist du, Maria,sozusagen als Buße für das, was sie vorhatte. Kaum war das letzte »Amen« über ihre Lippen geglitten, als sie auch schon ihre neuen hoch geknöpften Schuhe öffnete und sie zusammen mit ihren schwarzen Baumwollstrümpfen abstreifte.
Sie wackelte mit den nackten Zehen, als sie sich vorbeugte, um die Schmerzen aus ihren Blasen zu reiben, und dabei sah sie ein Paar Gipsfüße, die aus der Bank vor ihrer hingen.
Sie erhob sich halbwegs und lugte über den hohen, gerundeten Endpfosten der Bank. Die Allerseligste Jungfrau vom Rosenkranz lag der Länge nach auf der Bank, als sei sie vorübergehend von ihrem Marmoraltar gestiegen, um ein kleines Nickerchen zu halten.
Ein Absatz kratzte über Stein und Maeve schaute auf. Ein Mann stand im Mittelgang und auch er starrte die in der Bank liegende Statue an. Er hob den Kopf, ihre Augen begegneten einander und sie teilten ein langsames Lächeln.
Maeves Blick wanderte zurück zu der liegenden Jungfrau. Deren weiße Gipshände waren auf ihrer Gipsbrust zum Gebet gefaltet, ihre blauen Gipsaugen starrten zum Deckengewölbe empor. Sie hatte, wie Maeve jetzt sah, wo sie sie aus nächster Nähe betrachten konnte, einen reichlich rosa und prüden Mund, aber sicher hatte sie nie unter Blasen gelitten.
Bei diesem Gedanken hätte Maeve fast lachen müssen. Sie biss sich in die Lippe und schluckte energisch. Dann presste sie die Hände wie zum Gebet aneinander und bedeckte ihr Gesicht.
Der Mann im Mittelgang lachte wirklich und versuchte im letzten Moment, es wie ein Husten klingen zu lassen. Maeve schnaufte.
Sie schnappte sich ihre Schuhe, ihre Strümpfe und ihre Einkaufstasche und rannte los, wobei sie so hart mit der Hüfte gegen die Bankkante schlug, dass sie dort später einen Bluterguss entdeckte und nicht begreifen konnte, woher der stammen mochte. Sie lachte dermaßen, als sie den in der Sonne brütenden Platz wieder erreichte, dass sie sich nicht mehr auf den Beinen halten konnte, sondern sich auf eine schmiedeeiserne Bank setzen und die Hand auf ihre stechende Seite pressen musste.
Er folgte ihr; aber sie hatte gewusst, dass er das tun würde. Sein Gesicht war gerötet und ein wenig feucht. Seine Augen, die auf sie herabblickten, als sie da auf der Bank saß, glänzten durch seine Lachtränen. So witzig konnte er eigentlich auch wieder nicht gewesen sein, der Anblick der Jungfrau Maria, die in einer Kirchenbank ein Nickerchen machte. Maeve konnte nicht begreifen, warum sie beide noch immer dermaßen lachten, zwei Fremde, miteinander.
Er lächelte, als er mit der Hand auf die Kathedrale hinter ihnen deutete. »Was glauben Sie wohl, wie sie ...«
Maeve schüttelte den Kopf und presste ihre Lippen aufeinander, um ihn nicht anzulächeln. »Ach, die Heiligen mögen uns beschützen. Sicher war der Anblick meiner nackten Füße einfach zu viel für sie.«
Er lachte und schon prustete auch sie wieder los, und ihr Lachen mischte sich unter das Klingeln der Straßenbahnglocken, das Klappern von Maultierhufen auf Pflastersteinen, den Lärm der Schiffe, die im Hafen Bananen löschten.
Als ihr Lachen verklungen war, schien auch die ganze Welt verstummt zu sein. Die jetzt folgende Ruhe besaß ein Gewicht, das aus der Intimität stammte, die sie eben geteilt hatten.
Sie schaute verstohlen zu ihm auf. Er war lässig gekleidet in ein enggeknöpftes Leinenjackett mit hohem Kragen. Er sah kreolisch aus, mit seinen dunklen Haaren und Augen sowie durch seine Haltung – altes Blut, altes Geld, alter Name.
Sie saß auf einer Bank neben einem blühenden Magnolienbaum. Die Luft, die sie umgab, war fast unangenehm süß. Unter ihren bloßen Füßen brannten die Pflastersteine im Sonnenlicht. Dieses Gefühl gefiel ihr, es war beruhigend und erregend zugleich. »Sie haben nicht zufällig einen Schuhknöpfer bei sich?«, fragte sie.
Er griff sich wirklich in die Taschen, als bestehe die Möglichkeit, einen zu finden, dann schüttelte er lächelnd den Kopf.
Diesmal erwiderte sie sein Lächeln, und das länger, als richtig gewesen wäre. »Macht nichts. Ich hab schon Blasen auf den Blasen, so ist das.«
Sie erhob sich und strich die frische weiße Schürze gerade, die sie sich am Morgen umgebunden hatte, ehe sie auf den French Market gegangen war. In diesem Moment war ihr Lächeln auch schon wieder verflogen. Jetzt kratzte ihr Hals, und ihre Nase war zu. Sie war aus einem Grund, den sie nicht benennen konnte, den Tränen lächerlich nahe. Er sah sie an und schien zu wissen, was sie dachte, was unfair war, da ihre Gedanken für sie selbst ein Geheimnis waren.
»Ich muss noch einkaufen«, sagte sie.
Er tippte seinen Strohhut an, doch statt sich abzuwenden, trat er dichter an sie heran. So dicht, dass seine Schulter ihre fast berührte und sie die Lachfältchen an seinen Mundwinkeln und ein kleines Muttermal von der Größe einer Aschenflocke über seinem Wangenknochen sehen konnte.
»Darf ich Sie begleiten?«, fragte er. »Ich kann Ihre Schuhe für Sie tragen.«
Er streckte die Hand aus. Es war eine schöne Hand. Schlank und langfingrig, und er trug einen Trauring. Aber auch ihr Finger wies einen Ring auf, und den konnte er sehr gut sehen, da sie die Handschuhe ausgezogen hatte, um ihre Schuhe aufknöpfen zu können. Sie wollte ihm danken und ihn dann wegschicken. Sie drückte ihm ihre Schuhe in die Hand.
Der Himmel über ihnen war hart und von der erbarmungslosen Sommersonne fast ausgebleicht. Sie gingen zusammen über den Markt, im Schatten der Laubengänge, vorbei an Kisten voller Warzenmelonen und Erdbeeren und dicken kreolischen Tomaten. Vorbei an Sträußen von Schalotten und großen silbernen Knoblauchzöpfen. Vorbei an Krabben auf Eis und Austernpyramiden und Körben voller blauscheriger Krebse. Sie trug ihre kleine Einkaufstasche über dem Arm, aber er ging neben ihr, und deshalb war sie zu verwirrt, um etwas zu kaufen.
Seine Anwesenheit neben ihr beunruhigte sie, nicht, weil es sich nicht schickte – sie, eine verheiratete Frau, barfuß mit einem fremden Mann auf dem Markt. Seine Anwesenheit beunruhigte sie, weil er sie dazu brachte, sich etwas von ihm zu wünschen, doch was das war, konnte sie nicht einmal in Gedanken erfassen. In Worte kleiden konnte sie es schon gar nicht.
Er schaute nicht immer wieder verstohlen zu ihr hinüber, so, wie sie das machte; er musterte sie ganz offen. Sie wusste, was er war, und sie wusste, was er wollte.
Sie erreichten das Ende des Laubengangs, wo eine Schwarze auf dem Boden saß und einen großen Korb frittierter Reiskuchen auf ihrem Kopf balancierte. »Bels calas«, rief sie mit der Stimme einer Opernsängerin. »Bels calas, tout chauds.«
Er kaufte für alle einen Reiskuchen, sogar für die Cala-Frau selbst. Maeve bedankte sich und lächelte, und dann, als sei ihm diese Idee eben erst gekommen, als habe es bisher keine Rolle gespielt, fragte er nach ihrem Namen. Sie stotterte, als sie ihn nannte, als gehöre er nicht wirklich ihr oder solle zumindest nicht ihr gehören.
»Maeve«, wiederholte er und ließ ihren Namen über seine Zunge rollen, wie um ihn zu kosten. »Wie wunderschön.«
Sie spürte, wie bei diesem Kompliment ein weiteres seltsames Lächeln über ihr Gesicht huschte.
Auf dem Fluss tutete ein Schlepper und eine große Schar Möwen erhob sich vom Ziegeldach über dem Markt. Maeve und der Mann warfen die Köpfe in den Nacken und sahen zu, wie die Vögel zwischen den Türmen der Kathedrale davonflogen. Sie wollte ihm sagen, sie müsse jetzt nach Hause, komme ohnehin schon zu spät.
»Manchmal nach dem Einkaufen«, sagte sie, »mache ich auf dem Deich einen Spaziergang.«
Der Deich faszinierte sie schon seit ihrem ersten Moment in New Orleans. Von der Straße her konnte man zu dem hohen, mit Gras bewachsenen Hang hochblicken und Masten und Schornsteine am Himmel vorbeiziehen sehen, als sei der Himmel selbst ein Fluss.
Sie gingen eine Weile über die Deichkrone, dann setzten sie sich in den lindgrünen Schatten einiger Weiden, zwischen vereinzelt stehenden Butterblumen. Er hatte seine Jacke ausgezogen, damit sie sich darauf setzen konnte. Dann krempelte er sich die Hemdsärmel auf und legte die Unterarme auf seine angezogenen Knie. Er hatte auch den Hut abgenommen und ließ ihn von seinen langen Fingern baumeln.
Seine Haare glänzten lila und schwarz wie ein Krähenflügel. Sein Mund sah weich und füllig genug aus, um einer Frau zu gehören.
Sie wandte den Blick von ihm ab und betrachtete die grauen Lehmufer des Flusses. Diese waren übersät mit Hunderten von kleinen Erdschornsteinen, die die Lehmtaucher gebaut hatten – diese hässlichen, harten Käfer, die sich in Heuschrecken verwandelten und solchen Lärm machten, dass sie nachts nicht schlafen konnte. Zwischen Zuckerrohr und Schornsteinen waren Häuser aus Treibholz errichtet worden. Es musste seltsam sein, in diesen Treibholzhäusern zu leben. Sie hätte sich niemals dafür entschieden.
Seine Stimme durchbrach ihre Gedanken. Er fragte, was sie sehe, wenn sie den Fluss anschaute.
Und sie antwortete ohne nachzudenken: »Ich sehe einen Himmel für Lehmtaucher.«
Er warf den Kopf in den Nacken und lachte. Sie starrte seinen Hals an, die Bewegungen der starken Muskeln und den auf seiner Haut glitzernden Schweiß. Seine Haut war nicht olivenfarben, wie die so vieler Kreolen, sondern tiefgold wie Apfelwein, der in der Sonne funkelt.
Sie freute sich darüber, dass sie ihn zum Lachen gebracht hatte, und als er damit fertig war, erzählte er ihr, was er sah, wenn er den Fluss anblickte. Seine Worte klangen wie Poesie und sie versuchte nicht, darin irgendeinen Sinn zu erkennen.
Als er sich nach ihrem Mann und ihren Kindern erkundigte, erzählte sie ihm von Mike und den beiden Söhnen, als sei ihr das alles überhaupt nicht peinlich. Sie wusste, was sie war und was er von ihr wollte, und sie ließ ihn ihre Unschuld und ihre Ehre stehlen, obwohl er sie noch nicht einmal angerührt hatte.
Er sagte: »Meine Frau und ich bekommen bald unser erstes Kind. Ich hoffe natürlich auf einen Sohn.« Er lächelte und seine Zähne leuchteten weiß und ebenmäßig in seinem dunklen Gesicht. »Aber ich bin mit allem zufrieden, was sie mir schenkt.
Maeve wickelte ihren Rock fester um ihre angezogenen Beine. Sie wusste, dass sie aufstehen, ihm noch einen schönen Tag wünschen und weggehen müsste. Sie hatte es auch vor, tat es aber dann nicht.
Als sie nach Hause kam, war die Stillzeit schon so lange vorbei, dass ihre Brüste schmerzten und Milch austrat. Aber trotzdem blieb sie noch einen Moment auf der Vortreppe stehen. Am Himmel hatten sich dunkle Regenwolken zusammengezogen, aber das Haus glühte golden, als habe es den Sonnenschein des Morgens nur für sie aufbewahrt. Die rote Bougainvillea, die sich am Spalier über ihrer Haustür anklammerte, zitterte im Wind.
Ihr Mike verdiente gut bei der städtischen Polizei und war stolz darauf, wie ausgezeichnet er sie versorgte. Er hatte ihr ein Heim geschenkt, die eine Hälfte eines neuen Doppelhauses. Sie verdankte ihm so neue Schuhe, dass sie davon Blasen bekam, und ein farbiges Mädchen namens Tulie, das ihr beim Kochen und Putzen half und auf ihre Kinder aufpasste, wenn Maeve mit einem anderen auf dem Deich spazieren ging.
In ihrer Hand hielt sie einen Schlüssel, der sich wie ein Brenneisen in ihr Fleisch bohrte. Es war der Schlüssel zu einem Haus in der Conti Street. Sie dachte, sie hätte ihn dem Mann eigentlich ins Gesicht schleudern müssen. Sie beschloss, auf die Rückseite des Hauses zu gehen und den Schlüssel in den Regenwasserspeicher zu werfen, wo er für immer verloren sein würde.
Sie steckte den Schlüssel in die Tasche.
Sie ging durch das Haus und dann in die Küche. Ihr älterer Sohn, Paulie, war in den Geschirrschrank gekrabbelt und schlug Topfdeckel gegeneinander. Auf irgendeine Weise schaffte Tulies frisch geborenes Baby es, trotz des Lärms zu schlafen, in einem Korb, der oben auf dem Eisschrank stand. Auf dem Herd blubberte ein Topf mit roten Bohnen.
Tulie saß am Kiefernholztisch mit der blau karierten Wachstuchdecke, dem gelben Schmalztopf und dem Salzstreuer, die immer in der Mitte standen. Das Mädchen stillte Daman für sie, und die rosa Lippen des Kleinen zogen an der Brustwarze der Kleinen. Seine winzige Hand griff nach ihrer Brust, die rund und braun und weich war wie ein Bratapfel.
»Tut mir Leid, dass ich so spät komme«, sagte Maeve. »Ich hoffe, er hat nicht zu sehr geschrien.«
Tulie lächelte. Sie hatte eine breite Lücke zwischen ihren Vorderzähnen, und eines Tages hatte sie Maeve vorgeführt, dass sie wie ein Junge hindurchpfeifen konnte. Und sie hatte schöne dunkle Augen, wie Brunnen, die immer sorgfältig ausgeleert worden zu sein schienen, ehe sie ihre dichten Wimpern hob, um andere hineinblicken zu lassen. Maeve dachte, dass die Sklaven vermutlich das Starren ihrer Herren mit einer solchen Leere in ihren Augen beantwortet hatten.
»Ach, egal, lassen Sie sich Zeit, Miss Maeve«, sage Tulie. »Ich habe genug Milch für unsere beiden Jungs.«
»Ich war in der Kathedrale«, sagte Maeve. »Und dann habe ich einen Spaziergang auf dem Deich gemacht. Barfuß.« Sie hob die Schuhe vor Tulie hoch. Sie hätte sie fast vergessen, hätte sie fast auf dem Deich liegen lassen. Er war zu den Weiden zurückgelaufen, um sie zu holen.
Tulie lächelte beim Anblick der Schuhe, ihre Gedanken aber behielt sie für sich.
Maeves Brüste taten jetzt schrecklich weh und verloren Milch. Sie hätte Tulie gern ihren Sohn abgenommen, hätte ihn in den Armen gehalten und sein Nuckeln gespürt, seinen Babygeruch nach Milch und Talcum und weichem, feuchtem Fleisch eingeatmet. Doch sie blieb stehen, schwieg, sah zu, wie seine Lippen sich bewegten, als er an Tulies Brust saugte, wie seine Fäustchen sich ballten und wieder öffneten. Paulie kam nach ihr, doch Day war der Sohn seines Vaters; blond, mit diesem bereitwilligen Lächeln und den Grübchen. Auch seine Augen hatte er vom Vater geerbt. Mitternachtsblau, so wurden sie bezeichnet, aber Maeve hatte diesen Ausdruck nie verstanden, denn alle Mitternachtshimmel, die sie je gesehen hatte, waren pechschwarz gewesen.
Später an diesem Abend, als Mike zum Essen nach Hause kam, sah sie, dass seine Augen fast dieselbe Farbe hatten wie seine Polizistenuniform, und sie fragte sich, warum ihr das nie zuvor aufgefallen sei.
Als sie ihm seinen Teller mit roten Bohnen, Reis und gebratenem sac-à-lait hinstellte, erzählte sie ihm von ihrem Spaziergang auf dem Deich. Sie fragte ihn, was er sehe, wenn er den Fluss anschaute.
Mike Rourke schüttelte den Kopf. »Was ist das denn für eine Frage«, sagte er mit dem Mund voll Bohnen. »Ich sehe Wasser. Trübes Wasser.«
Sie starrte ihn an und hasste sich für ihre Gedanken, ihre Gefühle. Er war ein guter Versorger und ein guter Mann, war fast immer nett zu ihr und lieb zu seinen Söhnen. Immer wieder nahm er die Kinder in den Arm und schmuste mit ihnen.
Wortlos wandte sie sich von ihm ab und ging ins Schlafzimmer. Sie legte sich aufs Bett, sprang dann aber wieder auf. Sie ging ins Badezimmer, ließ kaltes Wasser ins Waschbecken laufen und bespritzte sich damit das Gesicht.
Mikes Rasiersachen lagen ordentlich im Regal über dem Becken: Porzellanbecher, Dachshaarpinsel, das Perfection Rasiermesser mit Garantie.
Sie starrte das Rasiermesser ihres Mannes an und dachte daran, wie sie manchmal nachts wach wurde, wenn ihr Mann neben ihr schlief, und wie sie dann eine schmerzhafte, widerhallende innere Leere empfand. Heiße Tränen quollen aus ihren Augen und kullerten über ihr Gesicht, in ihre Ohren, und sie fragte sich, wann Mike Rourke, ohne Vorwarnung und ohne Grund, dieses Ding geworden war, vor dem sie davonlaufen wollte wie vor ihrem Vater.
Sie griff zum Rasiermesser ihres Mannes, wog es in der Hand, um sein Gewicht zu spüren. Ihre Mutter hatte sich mit dem Rasiermesser umgebracht. Mike hatte ihr einmal gesagt, dass die meisten Leute das nicht richtig machten – sie schnitten seitwärts, statt von oben nach unten. Aber ihre Mom hatte gewusst, was sie zu tun hatte.
Maeve klappte das Messer auf und ließ ihren Finger über die Klinge fahren. Ihre Haut platzte, und der Schmerz und das rasch und dunkel hervorquellende Blut versetzten ihr einen Schock. Das Rasiermesser rutschte ihr aus der Hand und fiel klirrend zu Boden.
Sie schaute in den Spiegel über dem Becken und sah eine fremde Frau mit dunklen Haaren, dunklen Augen und einem dunklen Gesicht. Sie nannte den Namen der fremden Frau, so, wie er ihn am Morgen auf dem Markt ausgesprochen hatte, ließ ihn über ihre Zunge rollen.
»Maeve ... Maeve ... Maeve ...«
Als sie in die Küche ging, tropfte Blut von ihrem Finger.
»Gütiger Jesus«, schrie Mike, als er sie sah. Er sprang auf, riss sich die Serviette vom Hals und wickelte sie um die kleine blutende Wunde. »Was hast du denn gemacht?«
»Ich wollte wissen, wie sich das anfühlt«, sagte sie, aber das stimmte nicht ganz. Sie hatte wissen wollen, ob sie überhaupt etwas fühlen würde.
Er starrte sie an. Er sah verängstigt aus.
»Es tut weh«, sagte er.
»Ach, Liebling.« Er versuchte, sie zu küssen, aber sie wandte sich ab. Einen Moment lang glaubte sie, sich ergeben zu müssen. »Ich möchte allein sein«, sagte sie.
Sie ging wieder ins Schlafzimmer und legte sich aufs Bett. Sie zog die Knie bis an die Brust an. Sie zog den Schlüssel aus der Tasche und presste ihn zwischen ihre Handflächen, dann presste sie ihre gefalteten Hände zwischen ihre angezogenen Knie. Sie beschloss, später aufzustehen, auf den Hof zu gehen und den Schlüssel in den Regenwasserspeicher zu werfen, wo er für immer verloren sein würde.