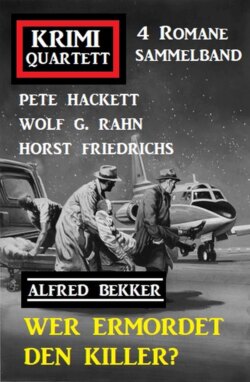Читать книгу Wer ermordet den Killer? Krimi Quartett 4 Romane Sammelband - Pete Hackett - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6
ОглавлениеBount lauschte. Alles war still im Haus. Er musste diesen Strother Lynch aufspüren. Es war kein angenehmes Gefühl, den Burschen hinter seinem Rücken zu wissen. James Stanley hätte ihm dessen Zimmer zeigen können, doch der Rancher ließ sich nicht mehr blicken. Also wandte sich Bount zur Küche, aus der lebhafte Geräusche und eine melancholische Melodie klangen.
Die Tür stand offen. In der Küche agierte eine beleibte Negerin, die völlig in Gedanken versunken war, denn sie bemerkte den Neuankömmling nicht. Sie sang ein altes Spiritual. Ihre Stimme klang weich und traurig. Dazu klapperte sie mit einer Vielzahl von Töpfen und fuhr erschrocken herum, als Bount sich diskret räusperte.
Sie ließ einen Topf scheppernd fallen und griff nach einem breiten Messer, mit dem sie kurz vorher anscheinend ein Huhn geschlachtet hatte.
„Jesses!“, rief sie, und ihre wulstigen Lippen zitterten. „Haben Sie mich erschreckt.“
„Schlechtes Gewissen?“, fragte Bount lächelnd und ließ das Messer nicht aus den Augen.
Tessa wurde immer verwirrter. Sie wischte sich die feuchten Hände an der nicht mehr ganz sauberen Schürze ab und verbarg sie hinter ihrem Rücken. Mitsamt dem Messer.
„Wer … wer sind Sie, Sir?“
„Ein Gast Mister Stanleys. Kochen Sie nicht zu wenig! Ich habe einen Mordshunger.“
Wieder erschrak die Schwarze.
„Sagen Sie nicht so etwas“, bat sie vorwurfsvoll.
„Aber es ist nun mal Tatsache. Ich bin hungrig. Ich habe eine weite Reise hinter mir.“
„Mordshunger ist ein böses Wort“, beharrte Tessa. „Es macht mir Angst.“
Erst jetzt verstand Bount. Die Gute hatte ihn ein wenig zu wörtlich genommen. Er grinste.
„Nun, hübsche Köchinnen verspeise ich nur im Notfall“, erklärte er beruhigend. „Ich wollte eigentlich zu Mister Lynch. Ich schätze, da bin ich hier falsch.“
„Es sind eine Menge Leute hier, die nicht hergehören“, erwiderte Tessa unwillig. Zweifellos meinte sie damit auch ihn.
Er hatte versäumt, den Rancher genauer über sein Personal zu befragen. Tessa und Jim machten jedenfalls einen reichlich abenteuerlichen Eindruck. Falls Stanley sie nicht gut behandelte, war es durchaus denkbar, dass sie den Drang verspürten, sich gegen ihren Herrn aufzulehnen.
„Würden Sie mir, bitte, sein Zimmer zeigen?“, bat er.
„Ich kann jetzt nicht weg“, antwortete sie brüsk. „Das Essen muss pünktlich auf dem Tisch stehen. Mister Stanley kann sonst sehr ungehalten werden.“
Bount ahnte, dass er in diesem Haus wenige Freunde finden würde. Aber musste deshalb gleich jeder ein Mörder sein?
Er fragte sich zum Beispiel, ob Tessa Gelegenheit gehabt hatte, in Rapid City ihren Herrn mit einem auf ihn zurasenden Auto zu bedrohen. Stanley hatte ihm im Vorbeifahren die Stelle gezeigt.
Wahrscheinlicher war, dass die Haushälterin überhaupt nicht mit einem Kraftfahrzeug umgehen konnte. Allerdings war nicht auszuschließen, dass sie sich mit Jim verbündet hatte. Vielleicht konnte er diese Frage gleich an Ort und Stelle klären.
Bount hielt seine Hände so, dass Tessa sehen konnte, dass er keine Waffe darin hielt. Langsam näherte er sich ihr, und sie wich schrittweise zurück.
„Ich habe zu arbeiten!“, stieß sie heftig hervor. Sie drehte sich um, legte das Messer so neben sich, dass sie es jederzeit erreichen konnte, und zog einen Topf, in dem es brodelte, vom Herd.
„Ich heiße Reiniger“, stellte sich Bount vor. „Ich bin hier, um das ...“
Weiter kam er nicht. Tessa stieß mit einem schrillen Aufschrei den Topf vom Herd, und Bount konnte sich gerade noch durch einen beherzten Sprung vor dem kochenden Wasser in Sicherheit bringen. Die Schwarze starrte ihn entsetzt an. Abwehrend hob sie ihre Hände. Dann rannte sie aufheulend davon.
Bount folgte ihr nicht. Er ahnte, was die Frau in Wirklichkeit so erschreckt hatte. Auch ihm war der Schuss nicht entgangen. Und anschließend hatte jemand geschrien. Dieser Schrei war ihm durch Mark und Bein gegangen.
Er rannte los. Ungefähr hatte er die Richtung ausgemacht, aus der der Schuss gekommen war.
Auf der Treppe stieß er mit Leuten zusammen, denen er noch nicht vorgestellt worden war. Eine Schusswaffe trug keiner in der Hand. Das hatte Bount auch nicht erwartet.
Zwischen dem Hauptgebäude und dem Bunkhouse stieß er auf einen Mann, der am Boden lag. Es war James Stanley. Eine Kugel war ihm in die Stirn gedrungen. Der Rancher musste sofort tot gewesen sein. Doc Caan, der Sekunden später eintraf, erschrak. Dann beugte er sich über den Mann und bestätigte dessen Tod.
„Wie furchtbar“, stammelte er. „Ich wurde hergebeten, um seinen Totenschein auszustellen, und nun ist es tatsächlich notwendig.“
Bount stellte überrascht fest, dass der Rancher von vorn erschossen worden war. Dazu noch aus ziemlich kurzer Entfernung. Und das, obwohl er mit seiner Ermordung gerechnet hatte. Da er offenbar nicht den Versuch unternommen hatte, ebenfalls zur Waffe zu greifen, oder aber nicht mehr dazu gekommen war, musste er seinem Mörder in keiner Weise Misstrauen entgegengebracht haben.
Bount dachte automatisch an Jim. Er sah sich nach dem Neger um, entdeckte ihn aber nirgends.
Dafür fiel ihm ein Mann in Jeanskleidung auf, der ausgesprochen nervös wirkte. Er hatte ein verkniffenes Gesicht und versicherte gerade dem Reverend, dass er sich zur Tatzeit nicht in der Nähe befunden habe. Er sei erst durch den Schuss und den Schrei angelockt worden.
Bei den beiden Frauen, die kalkweiß bei den Ställen standen, handelte es sich mit Sicherheit um Mabel Taylor, die gekommen war, um den Rancher zu beerben, und deren Mutter Gladys.
Strother Lynch kam nur zögernd näher. Er ignorierte den Detektiv und wandte sich an den Doc.
„Ich habe keinen Wagen kommen oder abfahren hören. Der Mörder muss sich noch auf der Ranch befinden.“
Der Meinung war auch Bount. Er erkundigte sich nach dem Telefon. Es stand fest, dass umgehend die Polizei verständigt werden musste. Bis die Beamten eintrafen, wollte er seine Augen offenhalten. Er war wütend, dass er den Mord nicht hatte verhindern können, aber der Killer hatte zu schnell zu geschlagen.
Tessa sah ihn mit ihren großen Augen erstaunt an.
„Telefon? So etwas gibt es hier nicht. Jim wird in die Stadt fahren, um den Sheriff zu holen.“
Die Negerin hatte sich erstaunlich schnell von ihrem Schreck erholt, aber als einzige kam sie für den Mord nicht in Frage.
Der Gedanke, Jim wegfahren zu lassen, gefiel Bount nicht. Wenn er der Mörder war, würde er als Erstes die Tatwaffe verschwinden lassen. Je nachdem, welches Motiv er für die Tat gehabt hatte, würde er möglicherweise den Sheriff gar nicht benachrichtigen, sondern schleunigst verduften.
Dasselbe galt für alle anderen Anwesenden.
Bount wäre am liebsten selbst gefahren, aber dann hätte er die ganze Gesellschaft allein zurücklassen müssen. Und einer von ihnen war eventuell der Mörder.
Das musste allerdings nicht sein. Der Killer konnte sich auch irgendwo auf dem Gelände verborgen halten. Vielleicht schlug er ein zweites Mal zu. Vielleicht wartete er auch ab, was weiter geschah.
„Sie werden in die Stadt fahren, Tessa“, entschied er. Bei dieser Regelung konnte am wenigsten schiefgehen.
Die Frau schüttelte den Kopf.
„Ich kann nicht fahren. Ich mache jetzt das Essen.“ Sie drehte sich um und ging ins Haus zurück.
„Sind Sie jetzt eigentlich hier der Hausherr, Mister Reiniger?“, erkundigte sich der Reverend. „Mister Stanley erwähnte doch, dass Sie die Ranch kaufen wollen.“
Strother Lynch lachte gehässig auf.
„Da haben Sie sich einen Bären aufbinden lassen, Reverend. Der Bursche ist ein Berufsschnüffler. Der Teufel mag wissen, warum er hier ist. Ganz bestimmt nicht, um in dieser Einöde Rinder zu züchten. Eins aber weiß ich mit Sicherheit: Er trägt immer eine Pistole mit sich herum. Es würde mich nicht wundern, wenn eine Patrone aus seinem Magazin fehlte.“
Bount hielt mühelos seinem Blick stand.
„Wenn Sie dieses Thema schon anschneiden, Lynch, auch Sie können recht gut mit der Waffe umgehen. Ich weiß, dass Sie sich etwas in den Kopf gesetzt haben, was mein vorzeitiges Ableben betrifft. Ich möchte dringend davon abraten. Sie brächten sich in eine unerfreuliche Situation. Was damals geschehen ist, hatten Sie sich selbst zuzuschreiben. Suchen Sie nicht die Schuld bei anderen!“
„Aber ist es wahr, dass Sie Mister Stanley angelogen haben? Sie interessieren sich gar nicht für die Ranch?“ Reverend Pool ließ deutlich erkennen, dass er die Lüge in jeder Form für eine Sünde ansah.
Bount sah keinen Grund, noch länger Versteck zu spielen.
„Mister Stanley hatte mich beauftragt, seinen Tod zu verhindern“, erklärte er. „Er ahnte, dass er ermordet werden sollte. Es wurden schon vorher zwei Anschläge auf ihn verübt.“
„Das hat er uns gegenüber auch behauptet“, bestätigte der Doc. „Ich muss aber zugeben, dass ich ihm die Story nicht geglaubt habe. Tut mir leid. Ich habe ihm unrecht getan.“
„Wollten Sie nicht zu Stanley, kurz bevor auf ihn geschossen wurde?“, erinnerte Strother Lynch.
Doc Caan lächelte den Mann mit den gelben Haaren freundlich an.
„Das ist richtig. Warum fragen Sie?“
„Lassen Sie’s sich von dem Schnüffler erklären! Das ist schließlich sein Job.“
„Mister Lynch spricht damit einen Verdacht gegen Sie aus“, sagte Bount ruhig. „Derjenige, der als Letzter bei dem Rancher war, muss zwangsläufig auch sein Mörder sein. Oder lebte er noch, als Sie ihn verließen?“
Der Arzt lachte hilflos.
„Nehmen Sie es mir nicht übel, wenn ich Ihren kriminalistischen Gedankengängen nicht so rasch folgen kann. Ich bin nur ein Mediziner und kein Lieutenant. Ich wollte Mister Stanley allerdings bitten, mich zum Flugplatz bringen zu lassen, da ich meine Gegenwart hier für unnötig ansah. Schließlich habe ich in Utah eine Praxis, die ich schon zu lange im Stich gelassen habe.“
„Sie wurden aus Utah geholt, um hier in South Dakota einen Totenschein auszustellen?“ Bount wunderte sich. „Kam Ihnen das nicht sonderbar vor?“
Caan hob die Schultern.
„Ich hatte ja vorher keine Ahnung, wohin wir fliegen würden“, verteidigte er sich. „Ich wurde von einem gewissen Scott abgeholt und mit einer Privatmaschine direkt hier abgesetzt. Scott flog sofort wieder zurück. Ich erfuhr erst hinterher, dass Mister Stanley gar nicht tot war. Kein Wunder, dass ich an einen Betrüger glaubte.“
„Sie haben meine Frage noch nicht beantwortet“, beharrte Bount. „In welcher Verfassung befand sich Mister Stanley, als Sie ihn verließen?“
„Ich habe ihn gar nicht gefunden. Mister Lynch schickte mich ins Kaminzimmer, aber dort war er nicht. Da hörte ich auch schon den Schrei. Mehr kann ich dazu nicht sagen.“
Es war seltsam. Alle Anwesenden schienen unter nicht zutreffenden Vorwänden hergelockt worden zu sein. Wer dahintersteckte, lag vorläufig noch im Dunkeln. Ein Motiv zeichnete sich aber bereits ab. Der Mörder wollte seine Spur verwischen. Es sollten sich genügend Menschen auf der Ranch aufhalten, die keine stichhaltige Erklärung für ihr Hiersein hatten.
Bount war gespannt, welche Geschichten Strother Lynch und der Bursche in Jeanskleidung erzählen würden. Bevor er sie fragen konnte, tauchte Jim auf.
Als er den Toten entdeckte, sah es aus, als wollte er davonlaufen.
„Bleiben Sie hier, Jim!“, befahl Bount. „Uns interessiert brennend, was Sie während der letzten Viertelstunde gemacht haben.
„Holz!“, kam es dumpf, beinahe drohend zurück.
„Dabei waren Sie aber ausgesprochen leise. Ich habe nichts gehört. Was haben Sie denn da in der Hand?“ Er deutete auf den Briefumschlag, den der Neger in seiner mächtigen Faust hielt.
„Er lag auf der Treppe“, berichtete Jim. „Ich wollte ihn Mister Stanley bringen.“
„Immerhin erstaunlich, dass Sie wussten, wo der Ermordete zu finden war“, meldete sich Peter Brass. Offensichtlich war es ihm recht, dass ihn noch keiner verdächtigt hatte.
„Ich habe gesucht“, gab Jim zurück.
„Geben Sie her!“, verlangte Bount.
Er nahm den Brief entgegen und öffnete den zugeklebten Umschlag. Ein unscheinbarer Zettel kam zum Vorschein. Auf ihm standen nur wenige Zeilen:
„Ich begrüße Sie als meine Gefangenen. Ich habe nicht die Absicht, einen von Ihnen zu töten. Wer jedoch versucht, die Ranch zu verlassen, wird dies bereuen. Keiner Ihrer Angehörigen oder Freunde weiß, wo Sie geblieben sind. Man wird Sie also nicht finden. Behalten Sie die Ruhe und die Nerven! Ich melde mich wieder. Dann werden Sie erfahren, was ich von Ihnen verlange.“
Gladys Taylor gab einen Seufzer von sich und fiel in Ohnmacht.
Im nächsten Moment schrien alle durcheinander.